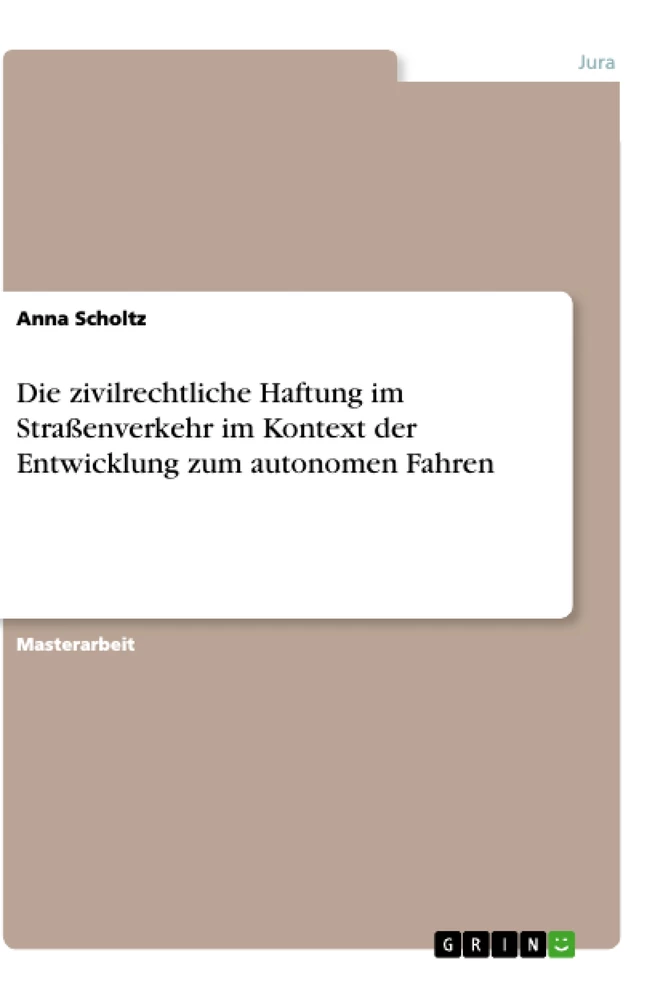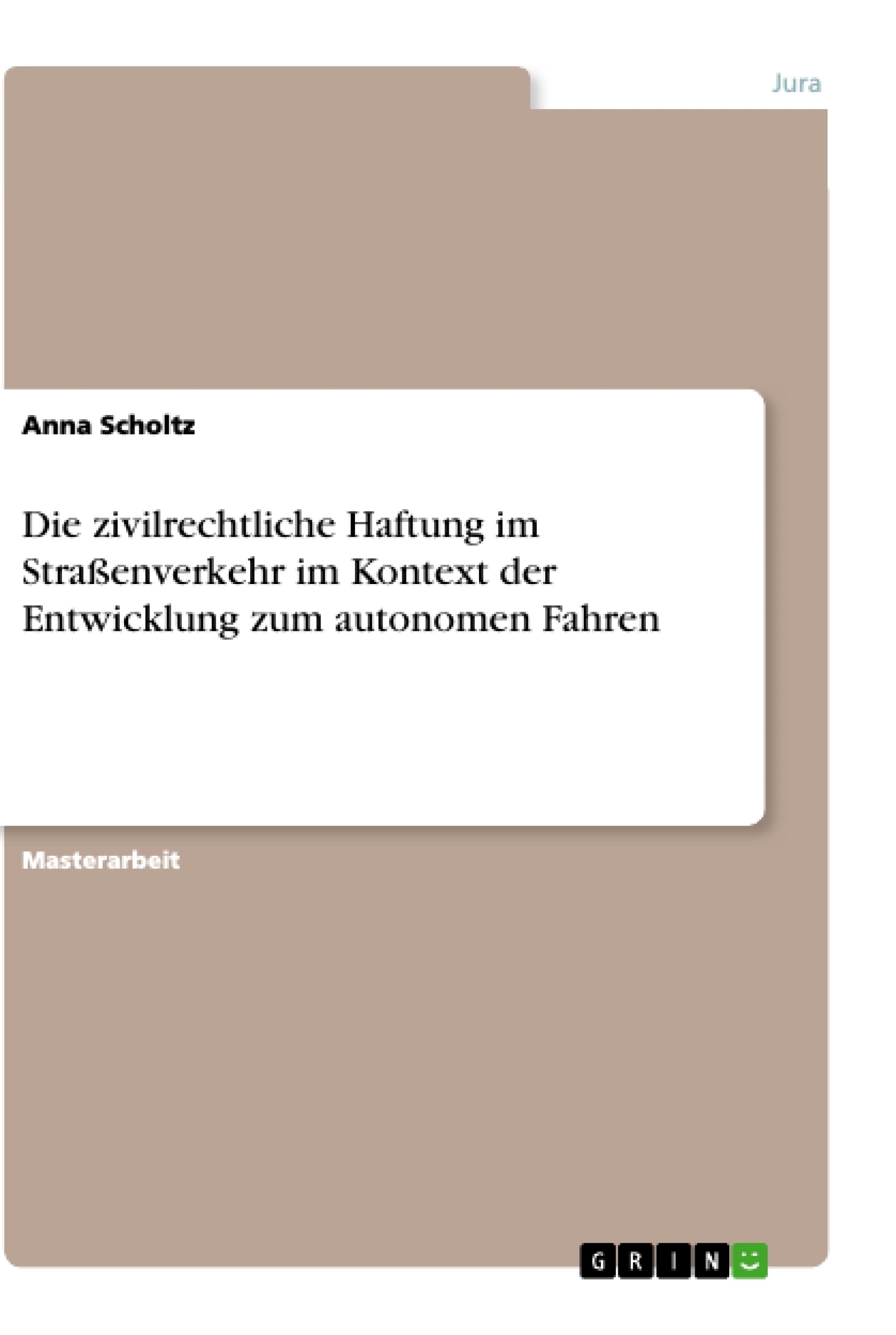Die Arbeit betrachtet die Haftungsverteilung zwischen Fahrzeughalter, Fahrzeugführer und Fahrzeughersteller für den Einsatz hoch- oder vollautomatisierter Fahrsysteme. Es werden haftungsrechtliche Probleme aufgezeigt, welche die Nutzung der derzeit zugelassenen Automatisierungstechnik zur Folge hat. Anschließend erfolgt ein Ausblick auf die weitere Entwicklung hin zum autonomen Fahren. Der bestehende Rechtsrahmen wird auf das autonome Fahren angewendet und resultierende Probleme dargestellt. Um diese zu lösen, werden alternative Ansätze zur Regulierung der Haftung beim autonomen Fahren betrachtet.
Ziel ist es, einen Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Diskussion um die fortschreitende Fahrzeugautomatisierung zu leisten und dessen rechtssichere Einschätzung zu ermöglichen. Dazu wird die Haftung beim hoch- und vollautomatisierten sowie autonomen Fahren dargestellt und beurteilt, ob die bestehende Rechtsordnung den Entwicklungen der Automobilindustrie gerecht wird. Es wird erforderlicher Regulierungsbedarf erarbeitet und Lösungsvorschläge aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Einführung zum Thema
- II. Gegenstand der Arbeit
- III. Ziel der Arbeit
- IV. Gang der Darstellung
- B. Die technischen Grundlagen der Fahrzeugautomatisierung
- I. Begriffsdefinitionen
- 1. Künstliche Intelligenz
- 2. Autonomie
- 3. Roboter
- 4. Fahrsystem
- II. Klassifizierung automatisierter Fahrzeuge
- 1. Klassifizierung nach der Bundesanstalt für Straßenwesen
- 2. Klassifizierung nach SAE J3016
- 3. Die 6 Stufen der Fahrzeugautomatisierung
- a) Stufe 0: Keine Automation
- b) Stufe 1: Assistiertes Fahren
- c) Stufe 2: Teilautomatisiertes Fahren
- d) Stufe 3: Hochautomatisiertes Fahren
- e) Stufe 4: Vollautomatisiertes Fahren
- f) Stufe 5: Autonomes Fahren
- C. Entwicklung der deutschen Gesetzgebung
- I. Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren (2015)
- II. Achtes StVG-Änderungsgesetz (2017)
- 1. Zielsetzung und Inhalt
- 2. Hoch- oder vollautomatisierte Fahrfunktionen im Sinne des StVG
- III. Gesetz zum autonomen Fahren (2021)
- D. Die Haftung des Fahrzeughalters beim hoch- oder vollautomatisierten Fahren
- I. Haftung nach § 7 Abs. 1 StVG
- 1. Betrieb eines Kraftfahrzeugs
- 2. Haftungsausschluss und Haftungsbegrenzung
- II. Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB
- III. Das Verhältnis zur KFZ-Haftpflichtversicherung
- E. Die Haftung des Fahrzeugführers beim hoch- oder vollautomatisierten Fahren
- I. Haftung nach § 18 Abs. 1 StVG
- 1. Auslegung der Fahrzeugführereigenschaft
- 2. Allgemeine Verhaltensanforderungen
- 3. Spezifische Verhaltensanforderungen
- a) Bestimmungsgemäße Verwendung
- b) Überwachungspflicht
- c) Übernahmepflicht
- aa) Unverzüglichkeit der Übernahme
- bb) Offensichtliche Umstände
- cc) Notfallsituationen
- d) Informationspflicht
- II. Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB
- III. Beweisbarkeit
- F. Die Haftung des Fahrzeugherstellers beim hoch- oder vollautomatisierten Fahren
- I. Haftung nach § 1 ProdHaftG
- 1. Software als Produkt
- 2. Produktfehler im automatisierten Fahrbetrieb
- a) Konstruktionsfehler
- aa) Technische Anforderungen
- bb) Programmierung der Steuerungsübergabe
- b) Instruktionsfehler
- aa) Anforderungen an die Instruktionspflicht
- bb) Die Systembeschreibung des Fahrzeugherstellers
- c) Fabrikationsfehler
- 3. Haftungsausschluss
- II. Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB
- 1. Die deliktische Produzentenhaftung
- 2. Produktbeobachtungspflicht
- G. Zwischenfazit zur Haftung beim hoch- oder vollautomatisierten Fahren
- H. Die Haftung beim autonomen Fahren de lege lata
- I. Haftung des Fahrzeughalters
- II. Haftung des Fahrzeugpassagiers
- III. Haftung des Fahrzeugherstellers
- IV. Zwischenfazit zur Haftung beim autonomen Fahren de lege lata
- V. Ausblick auf das Gesetz zum autonomen Fahren
- I. Die Haftung beim autonomen Fahren de lege ferenda
- I. Der Hersteller als Fahrzeugführer
- II. Einführung einer elektronischen Person
- 1. Betrachtung rechtsdogmatischer Vorbilder
- 2. Ausgestaltung der elektronischen Person
- a) Register
- b) Sitz und Gerichtsstand
- c) Haftung der elektronischen Person
- 3. Resultierende Problematiken
- a) Abgrenzbarkeit
- b) Grundrechtsfähigkeit
- c) Wirtschaftliche Zielsetzung
- d) Haftungsmasse
- 4. Kritische Würdigung
- III. Gefährdungshaftung des Fahrzeugherstellers
- 1. Ausgestaltung der Gefährdungshaftung des Fahrzeug-herstellers
- 2. Das Verhältnis zur Haftung des Fahrzeughalters
- 3. Die Tatbestandsmerkmale
- a) Betrieb des Fahrzeugs
- b) Geschützte Rechtsgüter
- c) Haftungsbegrenzung
- d) Ergänzende Regelungen
- 4. Entwurf einer Haftungsnorm
- 5. Kritische Würdigung
- J. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die zivilrechtliche Haftung im Straßenverkehr im Kontext der Entwicklung zum autonomen Fahren. Sie analysiert die Haftungsverhältnisse zwischen Fahrzeughalter, Fahrzeugführer, Fahrzeughersteller und anderen Verkehrsteilnehmern im Zusammenhang mit hoch- und vollautomatisierten Fahrfunktionen sowie beim autonomen Fahren.
- Technische Grundlagen der Fahrzeugautomatisierung
- Entwicklung der deutschen Gesetzgebung
- Haftungsverhältnisse beim hoch- oder vollautomatisierten Fahren
- Haftungsfragen beim autonomen Fahren de lege lata
- Haftung beim autonomen Fahren de lege ferenda
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die technischen Grundlagen der Fahrzeugautomatisierung, indem es verschiedene Begriffsdefinitionen erläutert und verschiedene Klassifizierungen automatisierter Fahrzeuge vorstellt. Kapitel zwei beleuchtet die Entwicklung der deutschen Gesetzgebung zum autonomen Fahren und analysiert relevante Gesetze und Regelungen. Kapitel drei untersucht die Haftung des Fahrzeughalters beim hoch- oder vollautomatisierten Fahren unter Berücksichtigung des StVG und des BGB. Kapitel vier widmet sich der Haftung des Fahrzeugführers in diesem Kontext und analysiert die Auslegung der Fahrzeugführereigenschaft sowie spezifische Verhaltensanforderungen.
Kapitel fünf untersucht die Haftung des Fahrzeugherstellers beim hoch- oder vollautomatisierten Fahren unter Berücksichtigung des Produkthaftungsgesetzes und des BGB. Kapitel sechs bietet ein Zwischenfazit zur Haftung beim hoch- oder vollautomatisierten Fahren, bevor Kapitel sieben die Haftung beim autonomen Fahren de lege lata analysiert. Kapitel acht diskutiert die Haftung beim autonomen Fahren de lege ferenda und analysiert verschiedene Haftungsmodelle, darunter die Einführung einer elektronischen Person und die Einführung einer Gefährdungshaftung des Fahrzeugherstellers.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen des zivilrechtlichen Haftungsrechts im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren. Im Fokus stehen die Haftung des Fahrzeughalters, des Fahrzeugführers und des Fahrzeugherstellers, sowie die Entwicklung des deutschen Rechts im Bereich des autonomen Fahrens. Weitere wichtige Begriffe sind: Künstliche Intelligenz, Autonomie, Roboter, Fahrsystem, Produkthaftungsgesetz, StVG, BGB, Gefährdungshaftung, elektronische Person.
- Arbeit zitieren
- Anna Scholtz (Autor:in), 2021, Die zivilrechtliche Haftung im Straßenverkehr im Kontext der Entwicklung zum autonomen Fahren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1138894