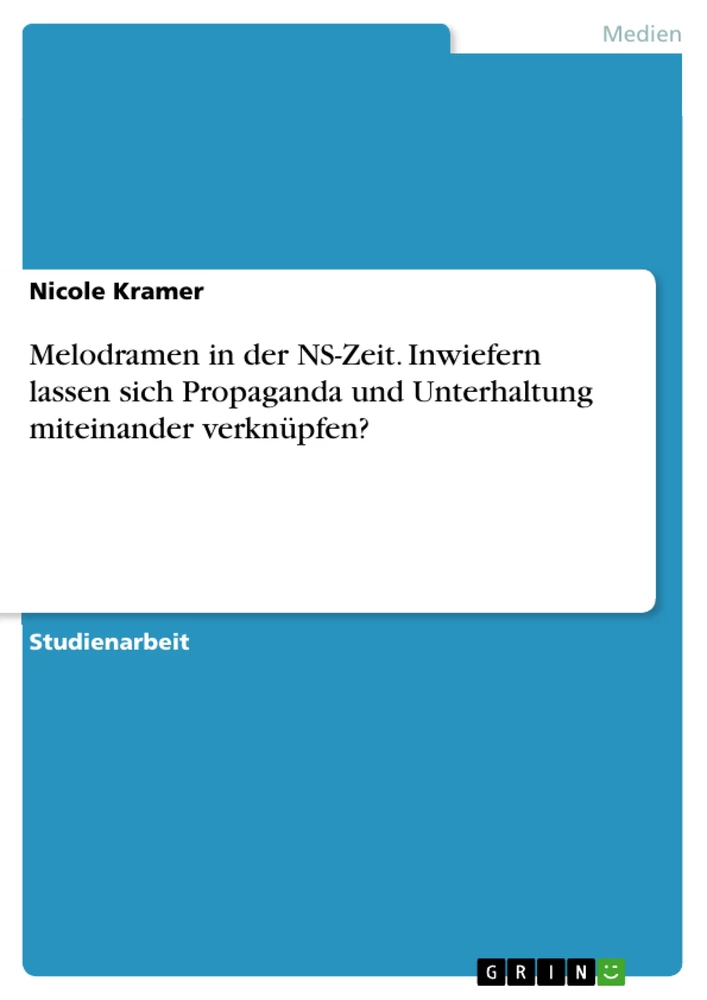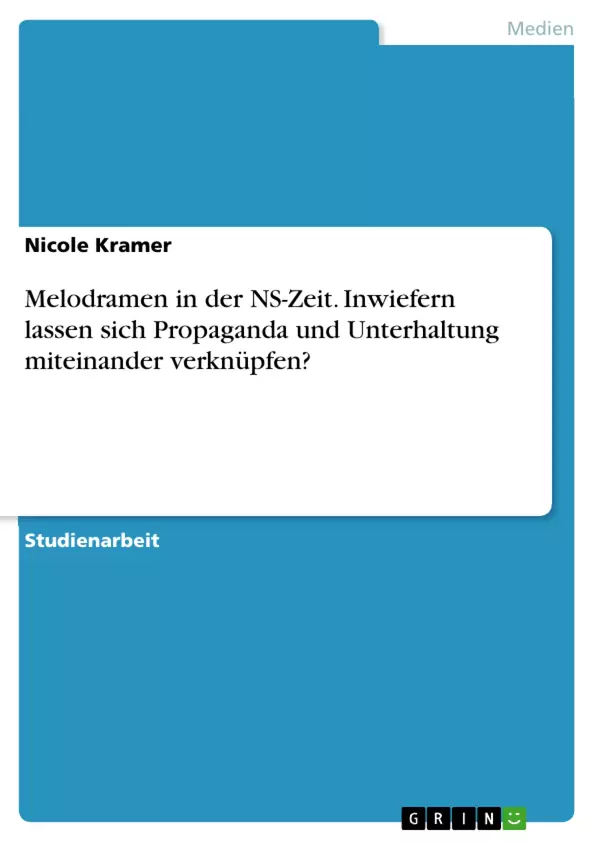Inwiefern lassen sich Propaganda und Unterhaltung miteinander verknüpfen? In dieser Arbeit soll diese Verbindung näher beleuchtet werden. Vor allem soll Veit Harlans Film Jud Süß näher betrachtet werden und wie er als Film funktioniert. Die filmische Konkretisierung, was als melodramatisch bezeichnet wird, kann sehr unterschiedliche Formen annehmen, deshalb gilt es zunächst zu erklären, was unter einem Melodrama, vor allem in Hinblick auf den Regisseur Veit Harlan verstanden wird.
Das Spektrum der Spielfilme, die zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland entstanden sind, ist außergewöhnlich breit. Adolf Hitler war Liebhaber von Unterhaltung, die man eher als harmlos definieren kann. Dazu zählten: Liebesfilme, Komödien, Operetten, Lustspiele und Revuefilme ,,mit aufregenden Figuren in glamouröser Umgebung.’’ Joseph Goebbels, der Propagandaminister von Hitler, der auch ,,zuständig für die Filmproduktion des Regimes (war), hatte andere Vorlieben’’. Für ihn waren eher Filme interessant, die auf historischen oder auch literarischen Stoffen basieren, ,,auch Filme im Künstlermilieu, Dramen, die Ereignisse überhöhen und verdichten, auf dass im Publikum das nationale und politische Gewissen gestärkt werde.’’ Hitler verabscheute es jedoch, wenn Politik in Filmen betrieben wurde. Seine Aussage hierzu war: ,,Mir ist es zum Ekel, wenn unter dem Vorwand der Kunst Politik gemacht wird.’’ Dahingehend versicherte Goebbels 1933, ,,dass unter seiner Ägide die Filmkunst frei bleibe’’. Jedoch sagte Goebbels in der gleichen Rede auch, dass man nicht denken solle, ,,dass die gegenwärtige Krise eine materielle ist; die Filmkrise ist vielmehr eine geistige, sie wird bestehen, solange wir nicht den Mut haben, den deutschen Film von der Wurzel aus zu reformieren.’’ Diese gegensätzliche Haltung, könnte bereits zeigen, dass ,,selbst das Allereinfachste in Dienst genommen wurde.’’ Gab es während der NS-Zeit überhaupt Filme, ,,die im Zwischenraum von Wille und Konzept, von Vision und Kunst entstanden sind, ohne ideologische Zügel, Filme voller Kraft und Tiefe - jenseits des Geforderten und Gewollten?’’
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Film im „Dritten Reich“
- Propaganda und/oder Unterhaltung im „Dritten Reich“
- Genre und Melodrama im „Dritten Reich“
- Veit Harlan und seine Melodramen
- Jud Süß
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verbindung von Propaganda und Unterhaltung im deutschen Film während der nationalsozialistischen Herrschaft. Sie analysiert, wie die Filmindustrie im „Dritten Reich“ sowohl als Propagandainstrument genutzt wurde, als auch gleichzeitig Unterhaltung für die breite Masse bieten sollte. Die Arbeit konzentriert sich dabei insbesondere auf das Melodram, ein Genre, das im NS-Kino eine wichtige Rolle spielte, und dessen Einsatz für propagandistische Zwecke untersucht werden soll.
- Die Rolle des Films im „Dritten Reich“ als Propagandainstrument
- Die Verbindung von Propaganda und Unterhaltung im NS-Kino
- Die Bedeutung des Melodramas als Genre im NS-Kino
- Die Analyse von Veit Harlans Film „Jud Süß“ als Beispiel für ein melodramatisches Propagandawerk
- Die Frage, inwieweit Propaganda und Unterhaltung in einem Film miteinander verschmelzen können.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet das breite Spektrum der Spielfilme, die während der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland entstanden sind, und stellt die gegensätzlichen Ansichten von Hitler und Goebbels bezüglich der Rolle des Films dar. Sie führt den umstrittenen Regisseur Veit Harlan ein und stellt dessen Film „Jud Süß“ als Beispiel für ein melodramatisches Propagandawerk vor.
- Kapitel 2 analysiert die Filmindustrie im „Dritten Reich“, die als wichtiges Propagandainstrument und zugleich als Wirtschaftszweig von großer Bedeutung war. Es wird die Gleichschaltung der deutschen Filmindustrie und die staatliche Kontrolle über die Filmproduktion dargestellt.
- Kapitel 2.1 befasst sich mit der Frage, wie Propaganda und Unterhaltung im „Dritten Reich“ miteinander verknüpft wurden. Es wird die Strategie von Joseph Goebbels erläutert, Propaganda in Unterhaltungsfilme zu integrieren, um eine subtile und wirkungsvolle Beeinflussung der Bevölkerung zu erzielen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Propaganda, Unterhaltung, Melodrama, Filmindustrie, „Drittes Reich“, Veit Harlan, „Jud Süß“ und die Verbindung dieser Begriffe im Kontext der nationalsozialistischen Herrschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurden Propaganda und Unterhaltung im NS-Film verknüpft?
Goebbels Strategie war es, ideologische Botschaften subtil in populäre Genres wie Melodramen zu integrieren, um die Bevölkerung wirkungsvoll zu beeinflussen.
Warum gilt „Jud Süß“ als Beispiel für propagandistisches Melodrama?
Veit Harlans Film nutzt melodramatische Mittel, um Emotionen zu schüren und eine antisemitische Ideologie massentauglich aufzubereiten.
Was war Hitlers Einstellung zum politischen Film?
Hitler bevorzugte eher „harmlose“ Unterhaltung (Komödien, Operetten) und lehnte allzu offensichtliche Politik unter dem Vorwand der Kunst ab.
Wer war Veit Harlan?
Harlan war einer der bedeutendsten Regisseure der NS-Zeit, bekannt für seine ästhetisch aufwendigen, aber ideologisch tief verstrickten Melodramen.
Gab es im NS-Staat Filme ohne ideologische Zügel?
Die Arbeit hinterfragt, ob in den Zwischenräumen von Kunst und Konzept Werke entstanden sind, die jenseits des staatlich Gewollten existieren konnten.
- Quote paper
- Nicole Kramer (Author), 2019, Melodramen in der NS-Zeit. Inwiefern lassen sich Propaganda und Unterhaltung miteinander verknüpfen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1139574