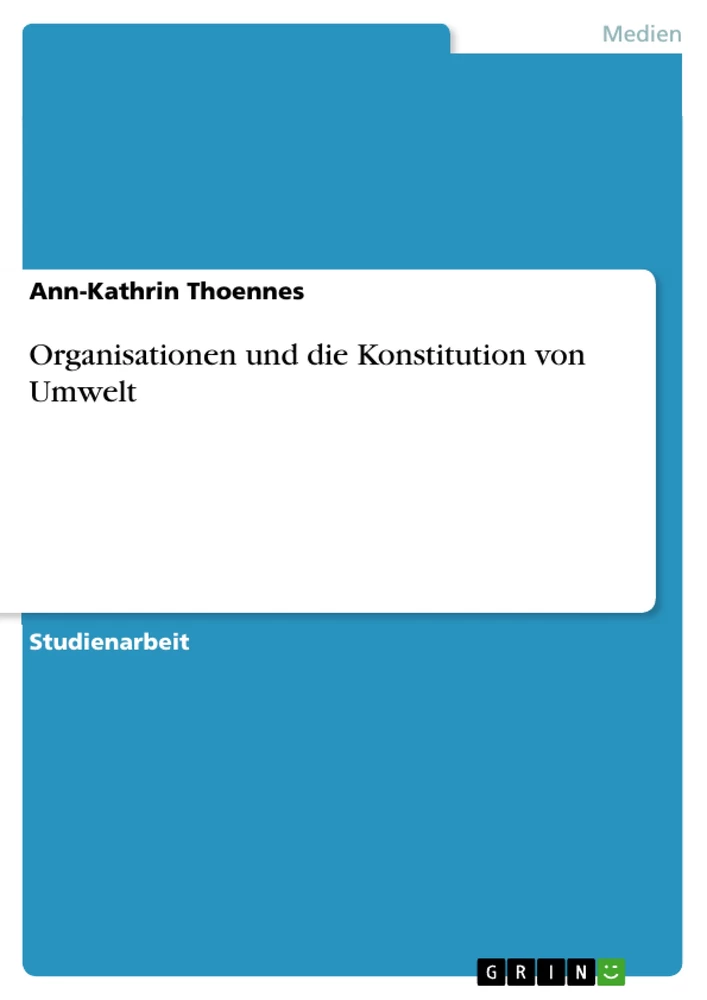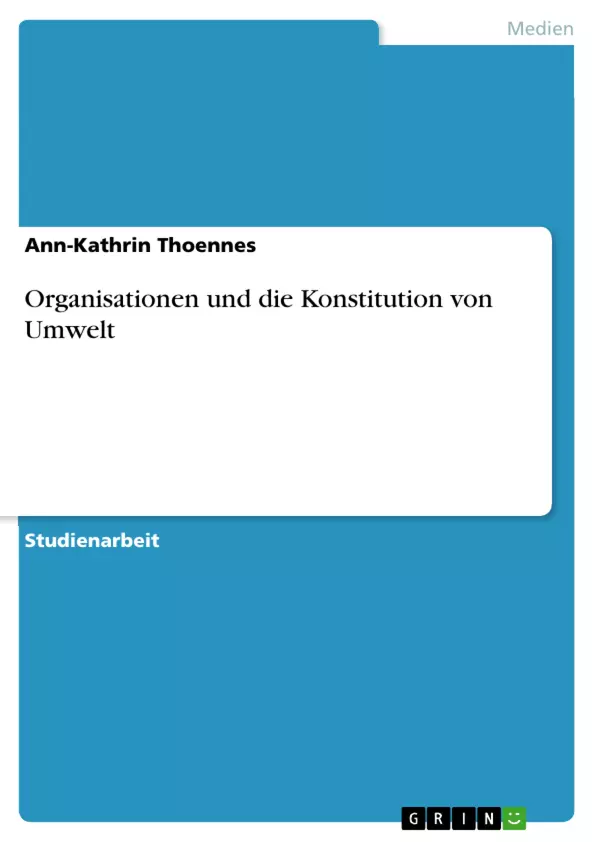Existiert Umwelt unabhängig vom Menschen oder ist sie subjektiv bestimmt?
Mit dieser Frage beschäftigen sich nicht nur Literaten und Philosophen, sondern auch Organisationstheoretiker wie Karl Weick. Im Unterschied zu vielen anderen Wissenschaftlern geht er davon aus, dass Organisationen und Umwelten nicht unabhängig voneinander existieren. Vielmehr ist für ihn Realität insofern subjektiv bestimmt, als Organisationen sie durch ihre Handlungen selbst konstituieren. Wie das geschieht, soll die vorliegende Arbeit zeigen.
In einem ersten Teil werden primäre Aussagen des Werks „Der Prozeß des Organisierens“ von Karl Weick vorgestellt und durch Beispiele veranschaulicht. Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung geht es dabei insbesondere um die Begriffe des ökologischen Wandels, der Gestaltung, der Selektion und der Retention.
Wie relevant das Thema „Organisationen und die Konstitution von Umwelt“ für die Kommunikationswissenschaft, insbesondere aber für den praktischen Journalismus ist, soll im zweiten Teil der Arbeit anhand des Beispiels der kontinuierlichen Fernsehforschung beantwortet werden. Hierbei geht es zunächst um die Methoden der Einschaltquotenmessung, aber auch um die Verwendung der Nutzungsdaten durch die auf dem Markt agierenden Organisationen. Inwiefern der Marktbeitritt des ZDF, die dadurch bedingte zunehmende Konkurrenzsituation und schließlich die Einführung des dualen Rundfunksystems in Deutschland als ökologischer Wandel im Sinne Weicks bezeichnet werden können und welche Folgen die Veränderungen der Fernsehlandschaft für die Erhebung von und den Umgang mit Einschaltquoten hatten, zeigt ein weiteres Kapitel. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit Gestaltung im Kontext der kontinuierlichen Fernsehforschung. Er beantwortet die Frage, welche Aspekte bei der Erhebung und Auswertung der Einschaltquoten von wem in welcher Intensität berücksichtigt werden und warum. Dabei wird gezeigt, dass in diesem Zusammenhang die unterschiedlichen Interessen öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten einerseits sowie privatrechtlicher Fernsehanbieter und Vertreter der Werbewirtschaft andererseits ausschlaggebend sind für die Gestaltung von Umwelten. Mit dem Selektionsprozess setzt sich Punkt 2.2.3 der Arbeit auseinander. Zentrale Fragen sind: Wie werden Einschaltquoten interpretiert? Und: Ist die derzeit verbreitete Auslegung sinnvoll oder lässt sie bestimmte Faktoren unberücksichtigt? Im letzten Punkt schließlich geht es um die Retention im Sinne Weicks. Aufgrund der hohen Bedeutung für die Praxis soll dabei insbesondere beantwortet werden, inwieweit die Marktteilnehmer die von ihnen verwendeten Interpretationen sowie ihr eigenes Denken und Handeln hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der Prozess des Organisierens nach Karl Weick
- 1.1 Ökologischer Wandel
- 1.2 Gestaltung
- 1.2.1 Gestaltung als Einklammerung
- 1.2.2 Gestaltung als sich selbst bestätigende Aussage
- 1.2.3 Gestaltung von Schranken
- 1.2.4 Zusammenfassung: Das Wesen der Gestaltung
- 1.3 Selektion
- 1.3.1 Selektion als retrospektive Sinngebung
- 1.3.2 Inputs der Selektion
- 1.3.3 Zusammenfassung: Das Wesen der Selektion
- 1.4 Retention
- 1.4.1 Retention als Speicherung gestalteter Umwelten
- 1.4.2 Die Notwendigkeit des Diskreditierens
- 1.4.3 Der Einfluss neuer Technologien
- 1.4.4 Zusammenfassung: Das Wesen der Retention
- 2. Der Organisationsprozess und die Konstitution von Umwelt am Beispiel der kontinuierlichen Fernsehforschung
- 2.1 Die kontinuierliche Fernsehforschung in der Praxis
- 2.1.1 Die Einschaltquotenmessung
- 2.1.2 Die Funktion von Einschaltquoten
- 2.2 Der Prozess des Organisierens im Kontext der kontinuierlichen Fernsehforschung
- 2.2.1 Ökologischer Wandel: Markteintritt des ZDF, zunehmende Konkurrenzsituation, Einführung des dualen Rundfunksystems
- 2.2.2 Gestaltung: Konzentration auf planungsrelevante Aspekte
- 2.2.3 Selektion: Interpretation der Einschaltquoten als Spiegel der Publikumswünsche
- 2.2.4 Retention: Speicherung gestalteter Umwelten
- 2.1 Die kontinuierliche Fernsehforschung in der Praxis
- Schluss
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Organisationen ihre Umwelt selbst konstituieren. Anhand des Werks „Der Prozeß des Organisierens“ von Karl Weick wird der Prozess des Organisierens in vier Elemente unterteilt: Ökologischer Wandel, Gestaltung, Selektion und Retention. Die Arbeit zeigt, wie diese Elemente im Kontext der kontinuierlichen Fernsehforschung zum Tragen kommen und wie die Einschaltquotenmessung als Beispiel für die Konstitution von Umwelt durch Organisationen dient.
- Der Prozess des Organisierens nach Karl Weick
- Die Bedeutung des ökologischen Wandels für die Konstitution von Umwelt
- Die Rolle der Gestaltung in der Interpretation von Umwelten
- Die Selektion als Prozess der Sinngebung
- Die Retention als Speicherung gestalteter Umwelten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Arbeit vor: Existiert Umwelt unabhängig vom Menschen oder ist sie subjektiv bestimmt? Sie führt in die Theorie von Karl Weick ein, der davon ausgeht, dass Organisationen ihre Umwelt durch ihre Handlungen selbst konstituieren.
Kapitel 1 stellt die vier Elemente des Organisationsprozesses nach Weick vor: Ökologischer Wandel, Gestaltung, Selektion und Retention. Der ökologische Wandel beschreibt Veränderungen in der Umwelt, die als Rohmaterialien für die Sinngebung dienen. Die Gestaltung umfasst die Auswahl und Interpretation von Informationen, die für die Organisation relevant sind. Die Selektion bezieht sich auf die Interpretation von Informationen und die Konstruktion von Sinn. Die Retention schließlich beschreibt die Speicherung von gestalteten Umwelten und die Weitergabe von Wissen.
Kapitel 2 untersucht den Organisationsprozess im Kontext der kontinuierlichen Fernsehforschung. Es wird gezeigt, wie die Einschaltquotenmessung als Beispiel für die Konstitution von Umwelt durch Organisationen dient. Der Markteintritt des ZDF, die zunehmende Konkurrenzsituation und die Einführung des dualen Rundfunksystems werden als ökologischer Wandel im Sinne Weicks betrachtet. Die Gestaltung von Umwelten durch die verschiedenen Akteure im Fernsehmarkt wird anhand der unterschiedlichen Interessen von öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern sowie der Werbewirtschaft erläutert. Die Selektion von Informationen und die Interpretation der Einschaltquoten werden ebenfalls untersucht. Schließlich wird die Retention im Kontext der Fernsehforschung betrachtet, wobei die Frage nach der Hinterfragung von Interpretationen und dem eigenen Denken und Handeln im Vordergrund steht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Prozess des Organisierens, die Konstitution von Umwelt, die Theorie von Karl Weick, den ökologischen Wandel, die Gestaltung, die Selektion, die Retention, die kontinuierliche Fernsehforschung, die Einschaltquotenmessung, der Fernsehmarkt, die Interessen von öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern sowie der Werbewirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Karl Weicks zentrale These zur Umwelt von Organisationen?
Weick geht davon aus, dass Organisationen ihre Umwelt nicht einfach vorfinden, sondern sie durch ihr eigenes Handeln und ihre Interpretation aktiv erschaffen (Enactment/Gestaltung).
Was versteht man unter „retrospektiver Sinngebung“?
Sinn entsteht nach Weick erst im Nachhinein (retrospektiv). Organisationen schauen auf ihre vergangenen Handlungen zurück und interpretieren diese, um Ordnung in die Umwelt zu bringen.
Wie dient die Fernsehforschung als Beispiel für Weicks Theorie?
Einschaltquoten sind keine objektive Realität, sondern ein konstruiertes Maß. Sender gestalten ihre Umwelt, indem sie Quoten als „Beweis“ für Publikumswünsche selektieren und danach handeln.
Was bedeutet „Retention“ im Organisationsprozess?
Retention ist die Speicherung von erfolgreichen Interpretationen. Organisationen behalten das Wissen bei, das ihnen in der Vergangenheit geholfen hat, die Umwelt zu verstehen.
Welchen Einfluss hatte das duale Rundfunksystem auf die Fernsehlandschaft?
Die Einführung privater Sender veränderte die Umwelt der öffentlich-rechtlichen Sender radikal (ökologischer Wandel) und zwang sie zu neuen Formen der Gestaltung und Selektion ihrer Strategien.
- Quote paper
- Ann-Kathrin Thoennes (Author), 2007, Organisationen und die Konstitution von Umwelt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114005