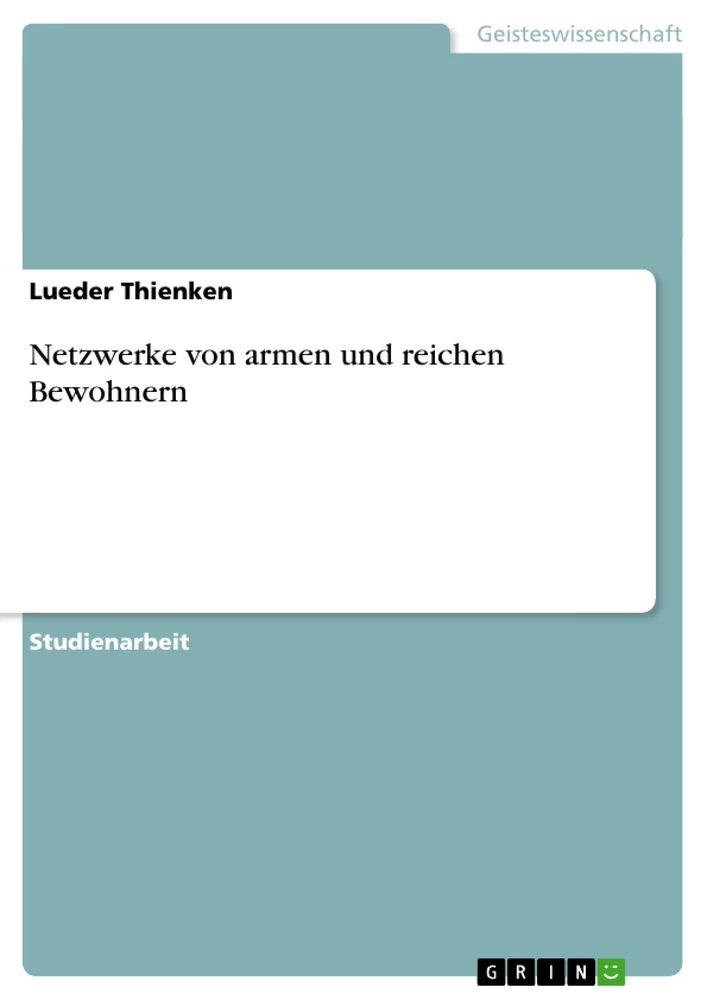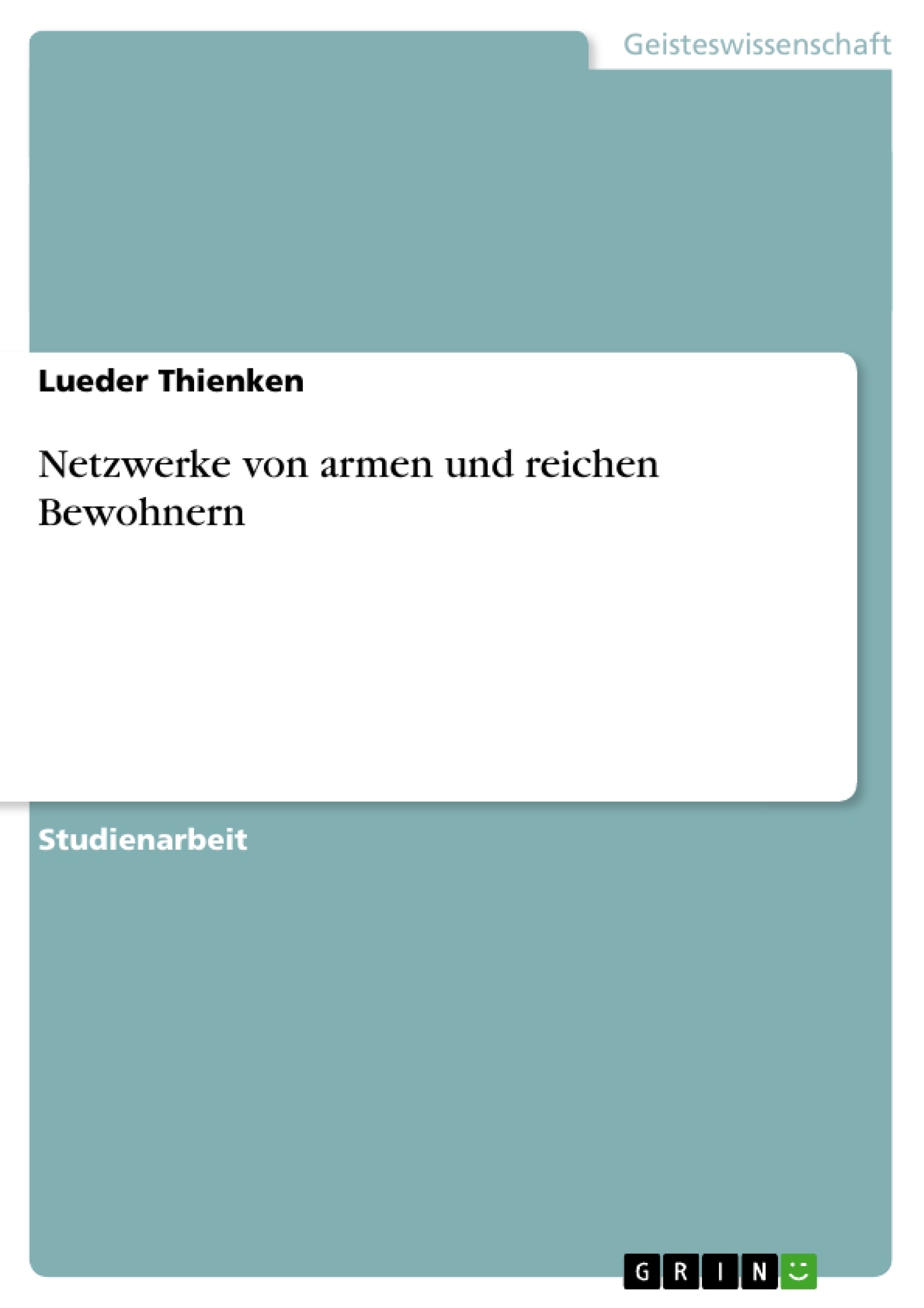Diese Arbeit widmet sich der Fragestellung, in wie fern sich das soziale Netzwerk einer Person auf deren Berufs- und Einkommenschancen auswirkt und deren soziale Mobilität beeinflussen kann. Hierzu werden einige theoretische Aspekte vorgestellt, darunter der Ansatz der „weak und strong ties“ von Mark Granovetter, der die Stärken schwacher Beziehungen in ihrem höheren Informationsfluss sieht, die starken Beziehungen jedoch aufgrund ihrer unterstützenden Funktion in Krisensituationen wertschätzt. Da statusniedere Personen meist auf ein verlässliches Netzwerk angewiesen sind, mangelt es ihnen an nötigen Bekanntschaften, die ihnen nützliche Informationen zu einem besseren Arbeitsplatz übermitteln könnten. Dieses Dilemma führt neben den ohnehin schon existierenden ökonomischen und bildungsbezogenen Nachteilen zusätzlich zu einer Verfestigung der sozio-ökonomischen Immobilität der sozial benachteiligten Bevölkerung.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung: Das Problem sozialer Ungleichheit
- 2. Netzwerke und Soziales Kapital
- 3. Das Ego-zentrierte Netzwerk als eine Form der Netzwerkanalyse
- 4. Die Stärken der „,schwachen Beziehungen“ (weak ties)
- 5. Die Stärken der „,starken Beziehungen“ (strong ties)
- 6. Der Einfluss von Status
- 7. Soziales Kapital und Stellensuche
- 8. Der Einfluss städtischer Siedlungen
- 9. Zusammenhang von Siedlungsgröße und Netzwerk
- 10. Fazit
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss sozialer Netzwerke auf die Berufs- und Einkommenschancen von Personen und deren soziale Mobilität. Sie beleuchtet die Rolle von „weak ties“ und „strong ties“ im Kontext sozialer Ungleichheit und analysiert die Auswirkungen von Status und städtischen Siedlungen auf die Netzwerkstruktur und -funktionen.
- Die Bedeutung von „weak ties“ und „strong ties“ für den Informationsfluss und die Unterstützung in Krisensituationen
- Der Einfluss von Status auf die Verfügbarkeit von nützlichen Kontakten und die Verfestigung sozialer Ungleichheit
- Die Rolle von städtischen Siedlungen und deren Größe auf die Netzwerkstruktur und -funktionen
- Die Auswirkungen von Netzwerken auf die Chancen des sozialen Aufstiegs
- Die Bedeutung von „Embeddedness“ für die Verfestigung von Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem der sozialen Ungleichheit und die Bedeutung von Netzwerken für die soziale Mobilität dar. Kapitel 2 definiert Netzwerke und soziales Kapital und erläutert die Konzepte von „bridging“ und „bonding“. Kapitel 3 beschreibt das ego-zentrierte Netzwerk als eine Form der Netzwerkanalyse. Kapitel 4 und 5 diskutieren die Stärken von „weak ties“ und „strong ties“ im Hinblick auf Informationsfluss und Unterstützung. Kapitel 6 untersucht den Einfluss von Status auf die Netzwerkstruktur und -funktionen. Kapitel 7 beleuchtet die Rolle von sozialem Kapital bei der Stellensuche. Kapitel 8 und 9 analysieren den Einfluss städtischer Siedlungen und deren Größe auf die Netzwerkstruktur und -funktionen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen soziale Ungleichheit, Netzwerke, soziales Kapital, „weak ties“, „strong ties“, Status, städtische Siedlungen, soziale Mobilität, Berufs- und Einkommenschancen, Informationsfluss, Unterstützung, „Embeddedness“.
Häufig gestellte Fragen
Was sind "weak ties" und warum sind sie wichtig?
"Weak ties" sind schwache Beziehungen (Bekannte), die laut Mark Granovetter einen höheren Informationsfluss bieten und oft bei der Stellensuche helfen.
Welche Funktion haben "strong ties"?
Starke Beziehungen (Familie, enge Freunde) bieten vor allem emotionale und materielle Unterstützung in Krisensituationen.
Wie beeinflusst der soziale Status das Netzwerk?
Personen mit niedrigem Status haben oft weniger Zugang zu informativen Netzwerken, was ihre sozio-ökonomische Immobilität verstärkt.
Was bedeutet "Embeddedness" im Kontext sozialer Ungleichheit?
Es beschreibt die Einbettung des Einzelnen in soziale Strukturen, die entweder Aufstiegschancen eröffnen oder Ungleichheit verfestigen können.
Welchen Einfluss hat die Siedlungsgröße auf Netzwerke?
Die Arbeit untersucht, wie das Leben in Städten im Vergleich zu kleineren Siedlungen die Struktur und Funktion persönlicher Netzwerke verändert.
- Quote paper
- Lueder Thienken (Author), 2007, Netzwerke von armen und reichen Bewohnern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114051