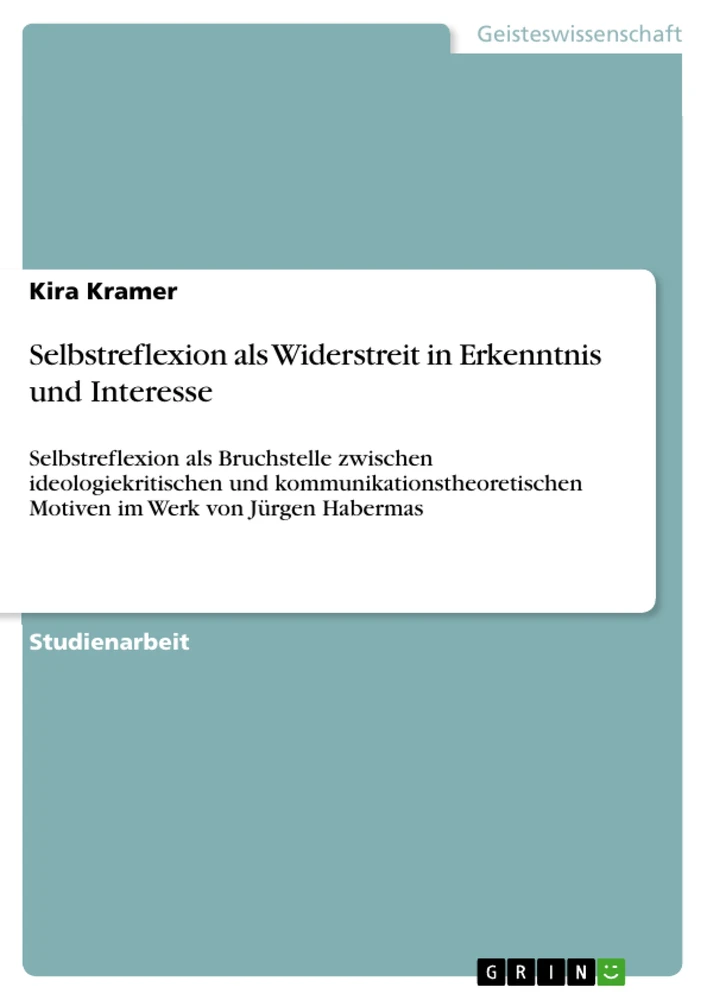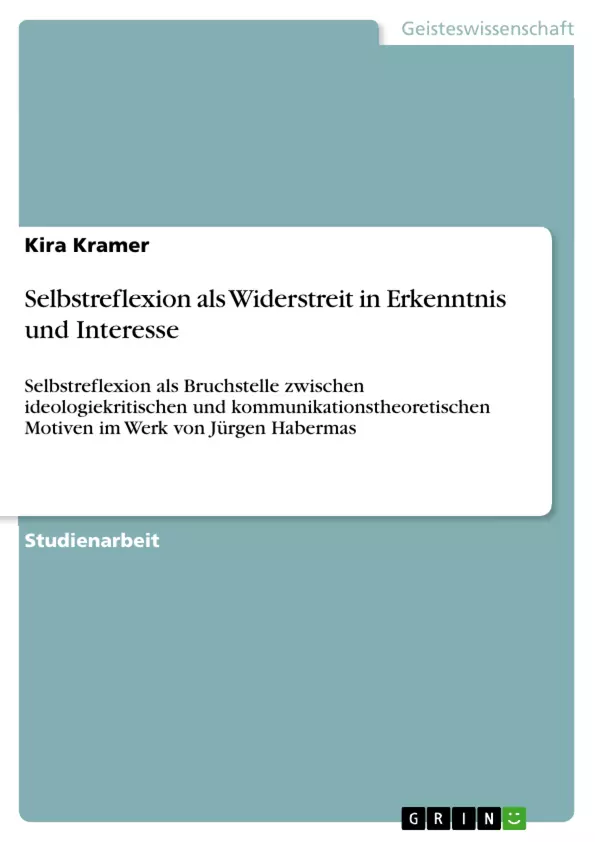In der Hausarbeit soll der Begriff der Selbstreflexion hinsichtlich der Doppelverwendung in Erkenntnis und Interesse untersucht werden, um die Diskrepanz zwischen Nachkonstruktionen und Kritik als theoriegeschichtlichen Konflikts in Habermas Werk zwischen Ideologiekritik einerseits und Kommunikationstheorie andererseits zu deuten.
Hierfür werde ich zunächst auf die von Iser und Strecker vorgeschlagene Einteilung der Habermaschen Theorieentwicklung tiefer eingehen. Diese Einteilung liefert die Vorarbeit, um daran anschließend den Begriff der Selbstreflexion zu untersuchen. Neben einer Positionsbestimmung des Begriffs in Erkenntnis und Interesse versuche ich sowohl seine kritische Wendung als auch seine spätere Funktion als Nachkonstruktion in ein Verhältnis zu setzen.
Im Ergebnis möchte ich zeigen, dass, obwohl die kritische Selbstreflexion in Erkenntnis und Interesse die primäre Rolle beansprucht, der Kritikbegriff gegenüber ‚orthodoxer‘ Ideologiekritik bereits so modifiziert wird, dass die wesentlichen Weichen für eine Verschiebung in Richtung Kommunikationstheorie und einer damit einhergehenden Priorisierung der rationalen Nachkonstruktion gestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Erkenntnis und Interesse als theoriegeschichtliche Bruchstelle
- 2. Drei Modelle zum Verständnis von Habermas' Werk
- 2.1 Ideologiekritik
- 2.2 Erkenntnisanthropologie
- 2.3 Kommunikationstheorie
- 3. Selbstreflexion: Zwischen Kritik und rationaler Nachkonstruktion in Erkenntnis und Interesse
- 3.1 Die Position der Selbstreflexion
- 3.2 Selbstreflexion als Kritik
- 3.3 Selbstreflexion als rationale Nachkonstruktion
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff der Selbstreflexion in Habermas' "Erkenntnis und Interesse" und analysiert dessen Doppeldeutigkeit als ideologiekritische Funktion und rationale Nachkonstruktion. Ziel ist es, die Diskrepanz zwischen diesen beiden Verwendungen als theoriegeschichtlichen Konflikt zwischen Habermas' ideologiekritischem und kommunikationstheoretischem Modell zu deuten.
- Die Entwicklung von Habermas' Theorie in drei Phasen (Ideologiekritik, Erkenntnisanthropologie, Kommunikationstheorie).
- Die doppelte Bedeutung der Selbstreflexion in "Erkenntnis und Interesse".
- Die Verschiebung von der kritischen Selbstreflexion zur rationalen Nachkonstruktion in Habermas' Werk.
- Der Theoriekonflikt zwischen Ideologiekritik und Kommunikationstheorie.
- Die Rolle der Selbstreflexion als Methode und innerer Antrieb des emanzipatorischen Erkenntnisinteresses.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Erkenntnis und Interesse als theoriegeschichtliche Bruchstelle: Diese Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Doppeldeutigkeit des Selbstreflexionsbegriffs in Habermas' "Erkenntnis und Interesse" vor. Sie verortet das Werk an einer theoriegeschichtlichen Schnittstelle zwischen Habermas' ideologiekritischem und kommunikationstheoretischem Modell, wobei die Selbstreflexion als zentrales Element dieses Konflikts fungiert. Die Einleitung skizziert die spätere Revision des Begriffs durch Habermas und kündigt die Struktur der Arbeit an, die auf der Dreiteilung von Iser und Strecker aufbaut und die Selbstreflexion in ihren kritischen und rekonstruktiven Funktionen untersucht.
2. Drei Modelle zum Verständnis von Habermas' Werk: Dieses Kapitel beschreibt die von Iser und Strecker vorgeschlagene Dreiteilung von Habermas' Werk in die Phasen der Ideologiekritik, der Erkenntnisanthropologie und der Kommunikationstheorie. Es werden die Hauptwerke jeder Phase (Strukturwandel der Öffentlichkeit, Erkenntnis und Interesse, Theorie des kommunikativen Handelns) zugeordnet und die jeweiligen Verteidigungsstrategien des "Projekts der Moderne" verglichen. Das Kapitel betont den graduellen Aufbau der Phasen und die qualitative Veränderung des Begriffsapparats über die Zeit, mit zunehmender Distanz zur Kritischen Theorie der ersten Generation.
2.1 Ideologiekritik: Dieser Abschnitt fokussiert auf Habermas' ideologiekritische Phase, repräsentiert durch "Strukturwandel der Öffentlichkeit". Es wird der Strukturwandel der Öffentlichkeit von einer nicht-ideologischen Form im frühen Bürgertum zu einer ideologischen Kategorie im 20. Jahrhundert analysiert. Habermas' genealogische Darstellung, ausgehend von einem Idealbild der frühen bürgerlichen Öffentlichkeit, zeigt die Entstehung der Ideologie durch die Spaltung sozialer Klassen und die damit verbundene Unterminierung der Voraussetzungen für eine nicht-ideologische Öffentlichkeit. Das Kapitel hebt hervor, wie der Vernunftanspruch der Öffentlichkeit die partikularen Interessen verschleiert.
Schlüsselwörter
Selbstreflexion, Habermas, Erkenntnis und Interesse, Ideologiekritik, Kommunikationstheorie, Erkenntnisanthropologie, Emanzipatorisches Erkenntnisinteresse, Rationale Nachkonstruktion, Theoriegeschichte, Projekt der Moderne, Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Häufig gestellte Fragen zu "Erkenntnis und Interesse": Selbstreflexion bei Habermas
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Begriff der Selbstreflexion in Jürgen Habermas' Werk "Erkenntnis und Interesse" und analysiert dessen doppelte Bedeutung als ideologiekritische Funktion und rationale Nachkonstruktion. Sie konzentriert sich auf die Diskrepanz zwischen diesen beiden Verwendungen und deutet diese als theoriegeschichtlichen Konflikt zwischen Habermas' ideologiekritischem und kommunikationstheoretischem Modell.
Welche Phasen von Habermas' Werk werden betrachtet?
Die Arbeit unterteilt Habermas' Werk in drei Phasen, wie von Iser und Strecker vorgeschlagen: die Ideologiekritik (repräsentiert durch "Strukturwandel der Öffentlichkeit"), die Erkenntnisanthropologie und die Kommunikationstheorie ("Theorie des kommunikativen Handelns"). Die Analyse verfolgt die Entwicklung des Selbstreflexionsbegriffs über diese Phasen hinweg.
Welche Rolle spielt die Selbstreflexion in Habermas' Werk?
Die Selbstreflexion ist ein zentrales Element in Habermas' Werk. Die Arbeit zeigt ihre doppelte Funktion auf: einerseits als ideologiekritische Methode zur Entlarvung von Herrschaft und Ideologie, andererseits als rationale Nachkonstruktion, die auf ein konsensfähiges Verständnis abzielt. Die Verschiebung zwischen diesen beiden Funktionen ist ein zentraler Aspekt der Analyse.
Wie wird der Konflikt zwischen Ideologiekritik und Kommunikationstheorie dargestellt?
Der Konflikt wird als ein theoriegeschichtlicher dargestellt, der sich in der Entwicklung des Selbstreflexionsbegriffs widerspiegelt. Die Arbeit untersucht die graduelle Abwendung von der strengen Ideologiekritik der frühen Phase hin zur Kommunikationstheorie, die stärker auf Konsens und rationale Verständigung ausgerichtet ist.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und einen Schluss. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage vor. Kapitel 2 beschreibt die drei Phasen von Habermas' Werk. Kapitel 3 analysiert die Selbstreflexion in ihren kritischen und rekonstruktiven Funktionen. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen. Kapitel 2.1 fokussiert sich speziell auf die ideologiekritische Phase und den "Strukturwandel der Öffentlichkeit".
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Selbstreflexion, Habermas, Erkenntnis und Interesse, Ideologiekritik, Kommunikationstheorie, Erkenntnisanthropologie, Emanzipatorisches Erkenntnisinteresse, Rationale Nachkonstruktion, Theoriegeschichte, Projekt der Moderne, Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Was ist das zentrale Ergebnis der Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie der Selbstreflexionsbegriff in Habermas' Werk eine Entwicklung von einer kritischen, ideologieentlarvenden Funktion hin zu einer rationalen, rekonstruktiven Funktion durchläuft. Diese Verschiebung wird als Ausdruck eines Theoriekonflikts zwischen dem frühen, ideologiekritischen und dem späteren, kommunikationstheoretischen Modell interpretiert.
- Citation du texte
- Kira Kramer (Auteur), 2021, Selbstreflexion als Widerstreit in Erkenntnis und Interesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1140893