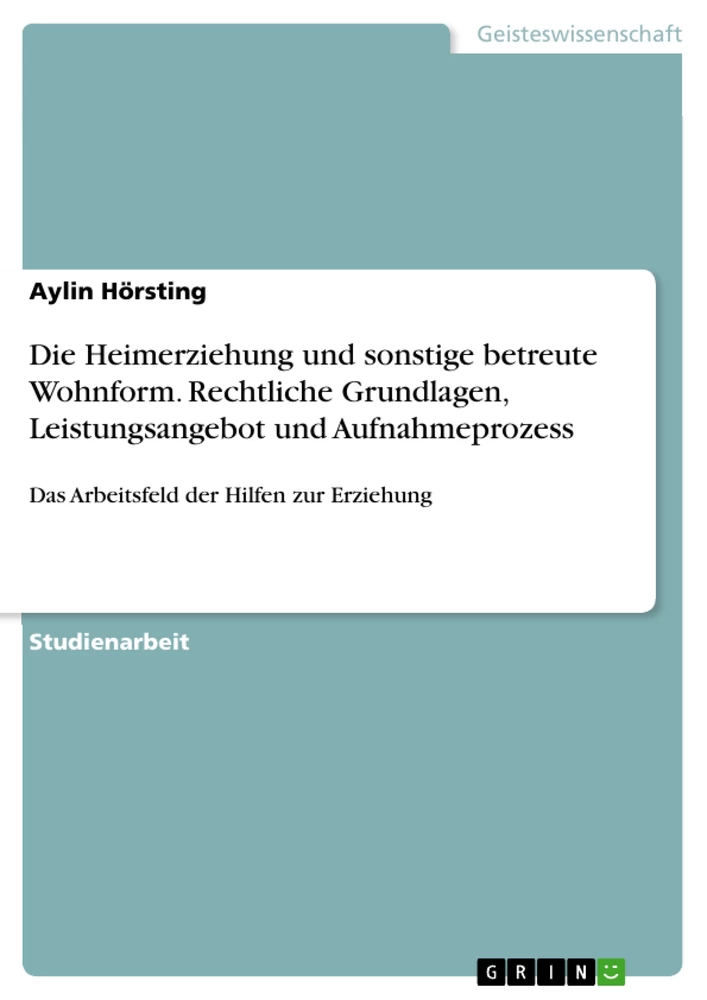Das Arbeitsfeld der Hilfen zur Erziehung ist mittlerweile breit gefächert, um Angebote für Kinder, Jugendliche und deren Familien je nach Problemlage anbieten zu können. Daher erfolgt die Ausrichtung dieser Hausarbeit darauf, sich mit der Heimerziehung laut § 34 (Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen) des Sozialgesetzbuches auseinanderzusetzen, um somit einen Schwerpunkt zu setzen.
Für den Einstieg wird die Geschichte der Heimerziehung erläutert, welche sich bis in das Mittelalter zurückführen lässt. Dadurch wird der starke Wandel hervorgehoben und deutlich gemacht, warum das Arbeitsfeld derart umstritten ist. Im darauffolgenden Abschnitt werden rechtliche Grundlagen der Erziehungshilfe mit Bezug auf das Kinder- und Jugendhilfegesetz dargestellt. Im Anschluss erfolgt eine Darstellung organisatorischer Aspekte, wozu eine Aufklärung über Träger und Finanzierung der Hilfen zählen. Nachfolgend befasst sich die Hausarbeit mit dem Angebot der Hilfen zur Erziehung und spezifisch mit den Leistungen der Heimerziehung nach § 34. In diesem Kapitel werden verschiedene Arten von Wohngruppen vorgestellt und – mit Blick auf die jeweiligen Problemlagen – erklärt, wie der Aufnahmeprozess abläuft und welche Adressat*innen es gibt. Darauf folgt eine Ausführung der Methoden in der Heimerziehung. Unter anderem wird der Hilfeplan, die Partizipation sowie die Eltern- und Familienarbeit beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte der Heimerziehung
- Rechtliche Grundlagen
- Organisation
- Leistungsangebot
- Aufnahmeprozess
- Adressat*innen
- Methoden der Heimerziehung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Heimerziehung laut § 34 (Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen) des Sozialgesetzbuches und beleuchtet die Geschichte, rechtlichen Grundlagen, Organisation, Leistungsangebote und Methoden der Heimerziehung.
- Historische Entwicklung der Heimerziehung vom Mittelalter bis zur Gegenwart
- Rechtliche Grundlagen der Erziehungshilfe im Kontext des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
- Organisation der Heimerziehung, einschließlich Träger und Finanzierung
- Leistungsangebote der Heimerziehung nach § 34 und die verschiedenen Arten von Wohngruppen
- Methoden der Heimerziehung, wie der Hilfeplan, Partizipation und Eltern- und Familienarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Hausarbeit befasst sich mit dem Arbeitsfeld der Hilfen zur Erziehung, insbesondere der Heimerziehung nach § 34, und erläutert die Relevanz dieses Schwerpunktes im Kontext der vielseitigen Angebote der Hilfen zur Erziehung.
- Geschichte der Heimerziehung: Der Abschnitt beleuchtet die Entwicklung der Heimerziehung vom Mittelalter bis zur Gegenwart und zeigt den Wandel der pädagogischen Ansätze und der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Heimerziehung auf. Er beleuchtet auch die Herausforderungen und Missstände in der Geschichte der Heimerziehung.
- Rechtliche Grundlagen: Dieser Abschnitt behandelt die rechtlichen Grundlagen der Erziehungshilfe im Kontext des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und beleuchtet die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Heimerziehung.
- Organisation: Dieser Abschnitt erläutert die organisatorischen Aspekte der Heimerziehung, einschließlich der verschiedenen Träger und ihrer Finanzierung.
- Leistungsangebot: Hier werden die verschiedenen Leistungen der Heimerziehung nach § 34 und die unterschiedlichen Arten von Wohngruppen vorgestellt.
- Aufnahmeprozess: Der Abschnitt beschreibt den Ablauf des Aufnahmeprozesses in der Heimerziehung, wobei die individuellen Problemlagen der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt werden.
- Adressat*innen: Dieser Abschnitt betrachtet die Zielgruppe der Heimerziehung und beschreibt die unterschiedlichen Bedürfnisse und Herausforderungen der Kinder und Jugendlichen, die in Heimen leben.
- Methoden der Heimerziehung: Der Abschnitt behandelt verschiedene Methoden der Heimerziehung, wie den Hilfeplan, die Partizipation der Kinder und Jugendlichen und die Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien.
Schlüsselwörter
Heimerziehung, § 34, Hilfen zur Erziehung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch, Wohngruppen, Aufnahmeprozess, Adressat*innen, Methoden, Hilfeplan, Partizipation, Eltern- und Familienarbeit, Geschichte, Entwicklung, Rechtliche Grundlagen, Organisation, Leistungsangebot, Finanzierung, Träger.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt § 34 SGB VIII im Bereich der Jugendhilfe?
Er bildet die rechtliche Grundlage für die Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen als Teil der Hilfen zur Erziehung.
Wie hat sich die Heimerziehung historisch entwickelt?
Die Geschichte reicht vom Mittelalter über die oft kritisierte Anstaltserziehung bis hin zu modernen, familienähnlichen Wohngruppen.
Wer trägt die Kosten für die Heimerziehung?
Die Hilfen werden in der Regel vom Jugendamt finanziert, wobei die Träger sowohl öffentliche als auch freie Organisationen sein können.
Was ist ein Hilfeplan?
Ein Hilfeplan ist ein Instrument zur Steuerung der Erziehungshilfe, in dem Ziele, Leistungen und die Dauer der Maßnahme gemeinsam festgelegt werden.
Welche Rolle spielt die Partizipation in Wohngruppen?
Partizipation bedeutet die aktive Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen an sie betreffenden Entscheidungen innerhalb des Heimalltags.
Warum ist die Elternarbeit trotz Heimerziehung wichtig?
Ziel ist oft die Rückkehr des Kindes in die Familie oder zumindest die Klärung der familiären Beziehungen, was eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern erfordert.
- Arbeit zitieren
- Aylin Hörsting (Autor:in), 2020, Die Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform. Rechtliche Grundlagen, Leistungsangebot und Aufnahmeprozess, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1140902