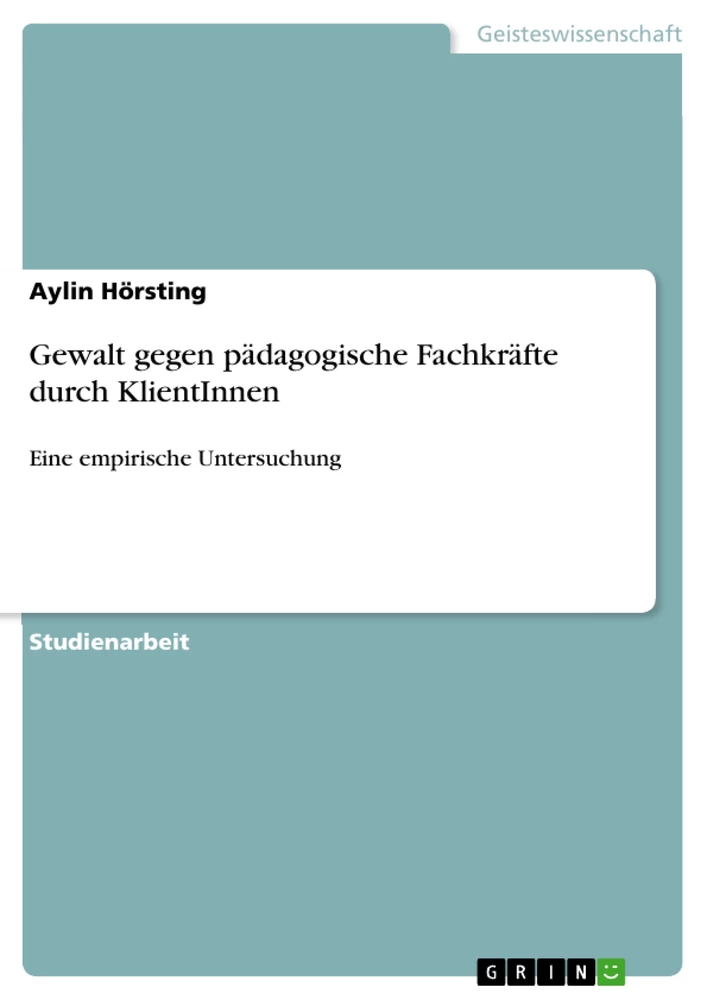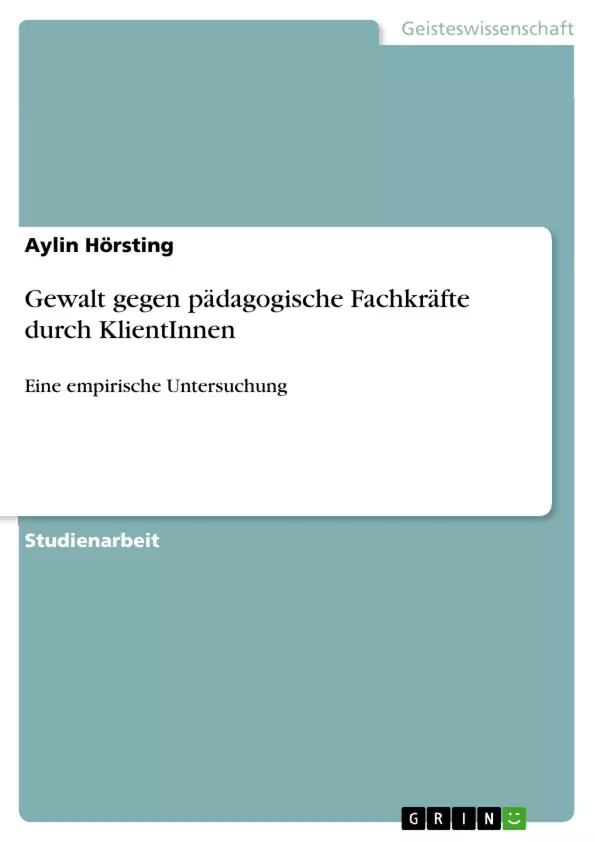In Deutschland ist bislang wenig zu dem Thema bekannt, ob und wie häufig Sozialarbeitende Opfer von Gewalt durch KlientInnen werden. Aufgrund dessen gilt mein Interesse der Frage, wie stark die Bedrohung tatsächlich durch KlientInnen im Arbeitsalltag von pädagogischen Fachkräften ist und wie in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit mit dem Aspekt Gewalt umgegangen wird.
In der Sozialen Arbeit gibt es viele Bereiche, in denen Gewalt und Aggressionen beinahe zur Tagesordnung gehören. Pädagogische Fachkräfte wie ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen beraten und unterstützen KlientInnen in schwierigen Lebenslagen. Oftmals haben diese schon Gewalterfahrungen im Kindes- oder Jugendalter machen müssen oder sind erst kürzlich Opfer von psychischer und/oder körperlicher Gewalt geworden. Aber auch andere Belastungen können zu dieser Situation führen. Diese Erlebnisse spiegeln sich schlussendlich oft in aggressiven oder gewalttätigen Verhalten wider. Ein bislang totgeschwiegenes Thema ist, dass auch jene pädagogischen Fachkräfte, die ihren KlientInnen zur Seite stehen, in ihrer Arbeit Opfer von Gewalt durch eben diese werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Definitionen
- 2.1.1 Aggression
- 2.1.2 Gewalt
- 2.2 Gewalttheorien
- 2.2.1 Psychologische Theorien
- 2.2.2 Biologische Theorien
- 2.2.3 Soziologische Theorien
- 3. Forschungsstand
- 3.1 Studien
- 3.2 Gewaltprävention
- 4. Hypothesenbildung
- 5. Die Empirische Untersuchung
- 5.1 Darstellung der empirischen Methode
- 5.2 Aufbau und Durchführung der Umfrage
- 5.3 Ergebnisdarstellung
- 5.3.1 Die Stichprobe
- 5.3.2 Häufigkeiten von Drohung und Gewalt
- 5.3.3 Häufigkeiten in den verschiedenen Arbeitsfeldern
- 5.3.4 Gewaltprävention
- 5.4 Interpretation der Auswertung
- 6. Fazit
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Bedrohung von pädagogischen Fachkräften durch Klienten im Arbeitsalltag. Sie analysiert die Häufigkeit von Gewalt und beleuchtet verschiedene Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit im Hinblick auf den Umgang mit diesem Aspekt.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Aggression“ und „Gewalt“
- Vorstellung verschiedener Theorien zur Erklärung von Gewalt aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen
- Darstellung des Forschungsstandes zu Gewalt gegen pädagogische Fachkräfte und bestehenden Präventionsmaßnahmen
- Durchführung einer empirischen Untersuchung mithilfe eines Online-Fragebogens
- Interpretation und Analyse der Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Häufigkeit von Gewalterfahrungen und Präventionsstrategien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und die Relevanz der Untersuchung einführt. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen behandelt, einschließlich Definitionen von Aggression und Gewalt sowie die Darstellung verschiedener Gewalttheorien aus Psychologie, Biologie und Soziologie.
Im dritten Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand zu Gewalt gegen pädagogische Fachkräfte beleuchtet, einschließlich relevanter Studien und Präventionsmaßnahmen. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Hypothesenbildung, die als Grundlage für die empirische Untersuchung dient.
Das fünfte Kapitel behandelt die empirische Untersuchung, einschließlich der Darstellung der Forschungsmethode, des Aufbaus der Umfrage und der Auswertung der Ergebnisse anhand von Grafiken, Tabellen und Diagrammen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind Gewalt, Aggression, Pädagogische Fachkräfte, Soziale Arbeit, Prävention, empirische Forschung, Online-Fragebogen, Häufigkeiten, Arbeitsfelder, Interpretation der Ergebnisse.
Häufig gestellte Fragen
Wie häufig erleben Sozialarbeiter Gewalt durch Klienten?
Die Arbeit zeigt auf, dass Gewalt und Drohungen in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit zum Alltag gehören, obwohl das Thema oft tabuisiert wird.
Was ist der Unterschied zwischen Aggression und Gewalt?
Aggression wird oft als Verhaltensbereitschaft verstanden, während Gewalt die tatsächliche Ausübung physischen oder psychischen Zwangs zur Schädigung anderer beschreibt.
Warum werden Klienten gegenüber Fachkräften gewalttätig?
Gründe liegen oft in eigenen Gewalterfahrungen in der Kindheit, psychischen Belastungen oder akuten Krisensituationen, in denen die Fachkraft als Stellvertreter für ein frustrierendes System wahrgenommen wird.
Welche Präventionsmaßnahmen gibt es in der Sozialen Arbeit?
Dazu zählen Deeskalationstrainings, Sicherheitskonzepte in Einrichtungen, Supervision und eine klare institutionelle Aufarbeitung von Vorfällen.
In welchen Arbeitsfeldern ist das Risiko besonders hoch?
Besonders betroffen sind oft die Kinder- und Jugendhilfe, die Arbeit mit psychisch Kranken sowie Bereiche, in denen sanktionierende Maßnahmen (z. B. Jobcenter) getroffen werden.
- Quote paper
- Aylin Hörsting (Author), 2021, Gewalt gegen pädagogische Fachkräfte durch KlientInnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1140904