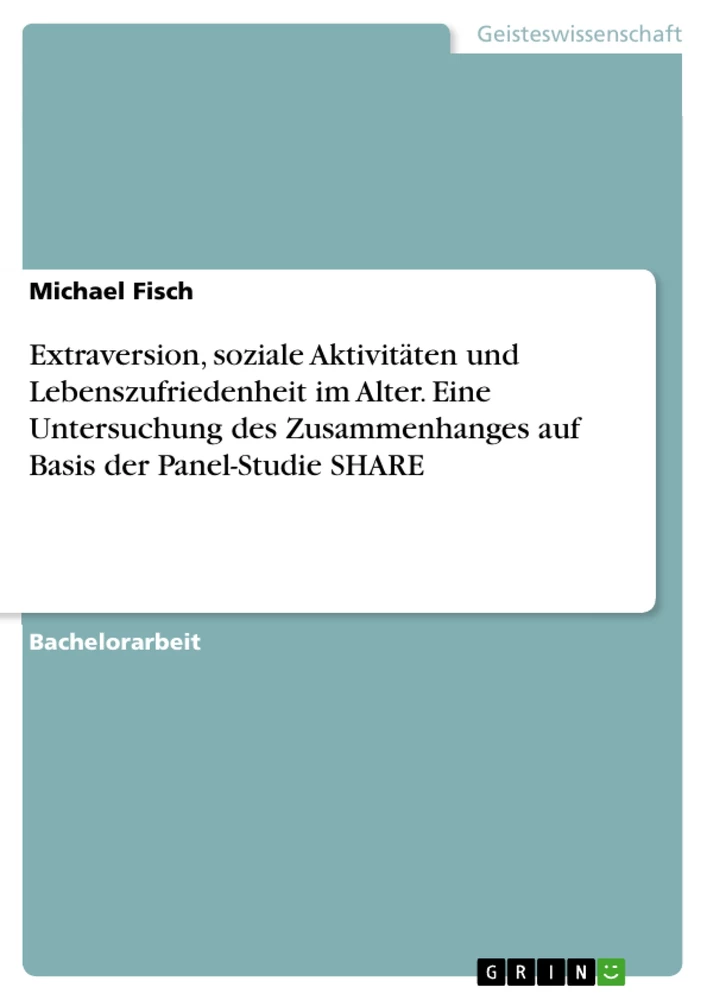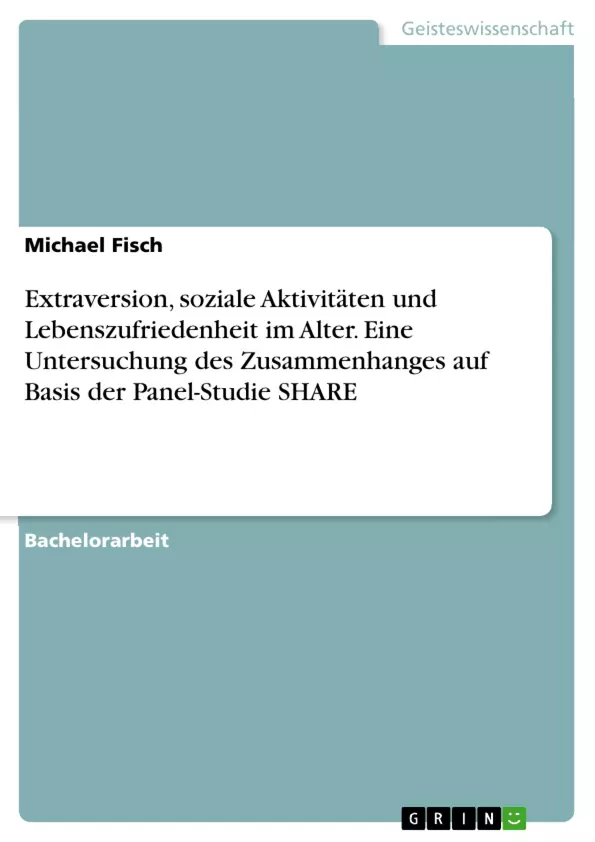In der vorliegenden Studie soll untersucht werden, inwieweit soziale Aktivitäten den Zusammenhang zwischen Extraversion und subjektivem Wohlbefinden (SWB) moderieren. Darüber hinaus werden die Haupteffekte von Extraversion und sozialen Aktivitäten auf SWB geprüft. Als Datengrundlage wird die Erhebung der multidisziplinären und länderübergreifenden Panel-Studie SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) genutzt.
Dieses Forschungsprojekt untersucht die Herausforderungen und Chancen einer alternden Gesellschaft. Die vorhandenen Daten ermöglichen im Rahmen einer großen Stichprobe die Auseinandersetzung mit der Thematik, inwieweit das Zusammenspiel von Persönlichkeitseigenschaft und sozialer Aktivität das Wohlbefinden im Alter positiv beeinflussen kann. Zunächst werden die für diese Arbeit relevanten Konstrukte unter der Berücksichtigung der empirischen Erkenntnislage erläutert. Dabei sollen zuerst das SWB und dessen kognitive Komponente, die Lebenszufriedenheit, dargestellt werden.
Im Anschluss wird auf Prädiktor (Extraversion), Moderator (soziale Aktivität) und Interaktion dieser beiden Variablen eingegangen. Im folgenden Kapitel werden die Erhebungsmethoden dieser Studie dargestellt. Dabei soll erst auf Studiendesign und Ablauf der Erhebung eingegangen werden. Zudem werden die für die vorliegende Arbeit relevanten Maße, die Stichprobe und das statistische Analyseverfahren dargestellt. Abschließend sollen die Ergebnisse vorgetragen und diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Abstract
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1. Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit
- 2.2. Einfluss von Extraversion auf Lebenszufriedenheit
- 2.3. Einfluss sozialen Aktivitäten auf Lebenszufriedenheit
- 2.4. Interaktion Extraversion und soziale Aktivitäten
- 2.5. Fragestellung & Hypothesen
- 3. Methoden
- 3.1. Studiendesign
- 3.2. Ablauf der Erhebung
- 3.3. Maße
- 3.3.1. Extraversion
- 3.3.2. Soziale Aktivitäten
- 3.3.3. Lebenszufriedenheit
- 3.4. Stichprobe
- 3.5. Statistisches Analyseverfahren
- 4. Ergebnisse
- 4.1. Hypothese 1: Haupteffekt Extraversion
- 4.2. Hypothese 2: Haupteffekt soziale Aktivitäten
- 4.3. Hypothese 3: Interaktionseffekt Extraversion und soziale Aktivitäten
- 5. Diskussion
- 5.1. Stärken und Limitationen
- 5.2. Implikationen für die Forschung
- 5.3. Praktische Implikationen
- 5.4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Extraversion, sozialen Aktivitäten und der Lebenszufriedenheit im Alter. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob Extraversion den Einfluss sozialer Aktivitäten auf die Lebenszufriedenheit moderiert. Ziel ist es, die Forschungsergebnisse zu diesem Thema aus der Perspektive der Persönlichkeits- und Sozialpsychologie zusammenzufassen und im Rahmen einer quantitativen Studie auf Basis des SHARE-Datensatzes zu untersuchen.
- Einfluss von Extraversion auf Lebenszufriedenheit
- Bedeutung sozialer Aktivitäten für die Lebenszufriedenheit im Alter
- Interaktion zwischen Extraversion und sozialen Aktivitäten im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit
- Methodische Aspekte der Untersuchung von Persönlichkeitsmerkmalen und Lebenszufriedenheit
- Implikationen der Forschungsergebnisse für die Praxis und zukünftige Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz der Forschung zum Zusammenhang zwischen Extraversion, sozialen Aktivitäten und Lebenszufriedenheit dar. Der theoretische Hintergrund beleuchtet die relevanten Konzepte und Theorien, insbesondere die biologisch orientierte Persönlichkeitstheorie von Eysenck, und die bisherigen Forschungsbefunde zum Thema. Die Methoden der Untersuchung werden im dritten Kapitel detailliert beschrieben, einschließlich des Studiendesigns, der Datenerhebung, der verwendeten Maße und der statistischen Analyseverfahren. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in Kapitel vier präsentiert, wobei die Haupteffekte von Extraversion und sozialen Aktivitäten sowie der mögliche Interaktionseffekt analysiert werden. Kapitel fünf diskutiert die Ergebnisse und deren Bedeutung im Kontext der Literatur, wobei Stärken und Limitationen der Studie, Implikationen für die Forschung und praktische Anwendungen beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die zentralen Themen Extraversion, soziale Aktivitäten und Lebenszufriedenheit im Alter. Weitere wichtige Konzepte sind die biologisch orientierte Persönlichkeitstheorie von Eysenck, die SHARE-Studie und die quantitative Forschungsmethodik. Die Untersuchung befasst sich insbesondere mit dem Einfluss sozialer Aktivitäten auf die Lebenszufriedenheit und der Frage, ob Extraversion diesen Einfluss moderiert.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Extraversion und Lebenszufriedenheit zusammen?
Extraversion gilt als einer der stärksten Prädiktoren für subjektives Wohlbefinden, da extravertierte Menschen tendenziell häufiger positive Emotionen erleben.
Welchen Einfluss haben soziale Aktivitäten auf das Wohlbefinden im Alter?
Soziale Aktivitäten fördern die Lebenszufriedenheit, indem sie Einsamkeit vorbeugen und das Gefühl von Zugehörigkeit und Sinnhaftigkeit stärken.
Was ist die SHARE-Studie?
SHARE steht für „Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe“. Es ist eine multidisziplinäre Panel-Studie, die Daten über Gesundheit und soziale Lage älterer Menschen in Europa erhebt.
Moderiert Extraversion den Effekt sozialer Aktivitäten?
Die Studie untersucht, ob soziale Aktivitäten für extravertierte Menschen einen anderen Nutzen für das Wohlbefinden haben als für introvertierte Menschen.
Was ist der Unterschied zwischen Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit?
Lebenszufriedenheit ist die kognitive Komponente des subjektiven Wohlbefindens (die Bewertung des Lebens), während Wohlbefinden auch affektive Komponenten (Emotionen) umfasst.
- Citation du texte
- Michael Fisch (Auteur), 2021, Extraversion, soziale Aktivitäten und Lebenszufriedenheit im Alter. Eine Untersuchung des Zusammenhanges auf Basis der Panel-Studie SHARE, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1141160