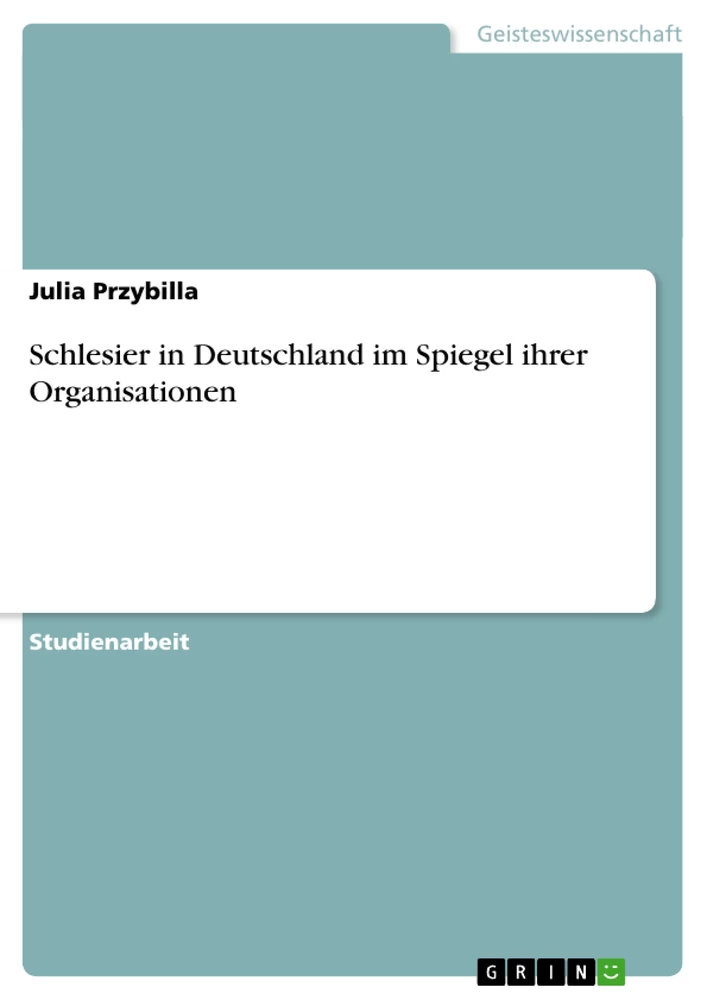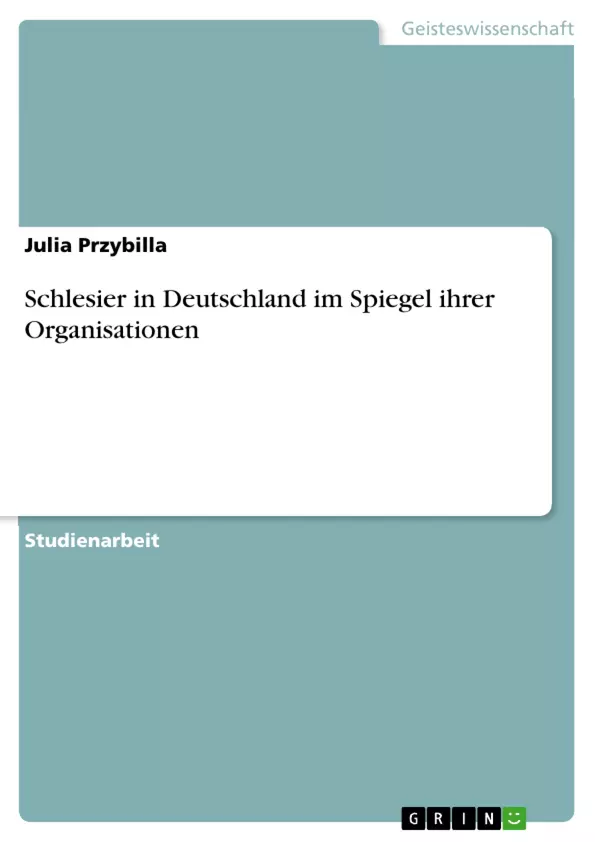Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen hunderttausende von Flüchtlingen und Vertriebenen nach Deutschland, unter anderem aus Schlesien. Als Fremde in einem vom Krieg zerstörten Land mussten sie unter erschwerten Bedingungen versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. Zur gegenseitigen Unterstützung organisierten sie sich und gründeten Ortsgruppen in zahlreichen Städten und auch Dörfern, zuerst mit dem Ziel, wieder nach Schlesien zurückkehren zu können. Auch in Augsburg finden sich Kreisgruppen der Landsmannschaft der Oberschlesier e.V. und der Landsmannschaft Schlesien (Nieder- und Oberschlesien) e.V.
Während die junge Bundesrepublik mit den schlesischen Vertriebenenorganisationen konform ging, dass man die Oder-Neiße-Grenze nicht akzeptieren könnte, hat sich der Tenor mittlerweile geändert. Die Grenze ist vertraglich gesichert und Vertriebene können nicht mit Ausgleichszahlungen rechnen. Die Landsmannschaften dagegen sind kaum von ihrer Linie abgewichen, weshalb die studentische Linke sie ab den 1970er Jahren als politisch rechts einordnete.
Unabhängig von den politischen Zielen des Vorstandes, erfüllen die Landsmannschaften auch soziale und kulturelle Bedürfnisse, die für die meisten Mitglieder im Vordergrund stehen.
In der vorliegenden Arbeit soll zuerst auf die Geschichte Schlesiens eingegangen werden, da sie es ist, auf die die schlesischen Landsmannschaften in ihrer politischen und kulturellen Arbeit vor allem Bezug nehmen. Anschließend werden die beiden Gruppen der Schlesier näher beschrieben, aus denen die Landsmannschaften ihre Mitglieder rekrutieren – nämlich die Flüchtlinge und die Vertriebenen, sowie die Spätaussiedler. Vor allem die zuerst genannten haben für die schlesischen Vertriebenenorganisationen eine große Bedeutung, wie noch gezeigt werden wird, weshalb ihr Schicksal genauer beschrieben wird. Schließlich werden die beiden in Augsburg vertretenen Landsmannschaften genauer vorgestellt, wobei die Ansichten und Absichten des Vorstandes anhand der Schlesischen Nachrichten, dem Organ der Landsmannschaft Schlesien, untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Geschichte Schlesiens
- III Schlesier in Deutschland
- III.I Flüchtlinge und Vertriebene
- III.I.I Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Vertriebenen
- III.I.II Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen
- III.II Spätaussiedler
- III.II.I Staatliche Maßnahmen
- III.II.II Integration der Spätaussiedler
- III.I Flüchtlinge und Vertriebene
- IV Schlesische Vertriebenenorganisationen
- IV.I Die Landsmannschaft Schlesien (Nieder- und Oberschlesien) e. V. in Augsburg
- IV.II Landsmannschaft der Oberschlesier e. V. in Augsburg
- V Die Zeitung Schlesische Nachrichten der Landsmannschaft Schlesien (Nieder- und Oberschlesien) e. V.
- V.I Erstellen einer Häufigkeitstabelle über das Vorkommen bestimmter Wörter
- V.II Auswertung und kontextbezogene Interpretation der Ergebnisse
- V.II.I Die Kategorien Schlesien, Deutschland und Polen
- V.II.II Die Kategorien Vertriebene und (Spät-)Aussiedler
- V.II.III Die Kategorien Heimat, Unrecht, Oder und Neiße
- V.III Zusammenfassung der Ergebnisse
- VI Schluss
- VII Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Schlesier in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, fokussiert auf ihre Organisation und Integration. Sie beleuchtet die Rolle der schlesischen Vertriebenenorganisationen in Augsburg und analysiert deren politische und soziale Aktivitäten anhand der Zeitung "Schlesische Nachrichten".
- Die Geschichte Schlesiens und die Vertreibung der Schlesier nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Unterbringung, Versorgung und Integration der schlesischen Flüchtlinge und Vertriebenen
- Die Rolle der schlesischen Vertriebenenorganisationen in Augsburg
- Die politische und soziale Bedeutung der Landsmannschaften
- Eine Diskursanalyse der "Schlesischen Nachrichten"
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit: die Ankunft von hunderttausenden Flüchtlingen und Vertriebenen aus Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und deren Organisation in Ortsgruppen zur gegenseitigen Unterstützung. Sie erwähnt die beiden in Augsburg aktiven Landsmannschaften und den Wandel der politischen Haltung gegenüber der Oder-Neiße-Grenze, wobei die Landsmannschaften an ihren Positionen festhielten. Die Arbeit fokussiert sich auf die Geschichte Schlesiens, die beiden Gruppen der Schlesier (Flüchtlinge/Vertriebene und Spätaussiedler) und die Augsburger Landsmannschaften, wobei die "Schlesischen Nachrichten" als Quelle dienen.
II Geschichte Schlesiens: Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte Schlesiens von seiner Unabhängigkeit im Jahre 1137 bis zum Zweiten Weltkrieg. Es beleuchtet die deutsche Besiedlung, das friedliche Zusammenleben von Deutscher und Polnischer Bevölkerung, die böhmische Lehenshoheit, die dritte polnische Teilung, den Einfluss des Nationalismus und die preußische Politik zur Unterdrückung der polnischen Bevölkerung. Das Kapitel dokumentiert die Folgen des Ersten Weltkriegs, die Volksabstimmungen in Oberschlesien und die Annexion von Gebieten durch Polen und Deutschland im Zweiten Weltkrieg, einschließlich der "Entpolonisierung" und der Deportationen. Der Fokus liegt auf dem wechselvollen Verhältnis zwischen Deutscher und Polnischer Bevölkerung und der Entwicklung der politischen Zugehörigkeit Schlesiens.
III Schlesier in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die Situation der schlesischen Flüchtlinge und Vertriebenen sowie der Spätaussiedler in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Es thematisiert die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge und Vertriebenen, sowie die Herausforderungen ihrer Integration in die deutsche Gesellschaft. Zusätzlich wird die Integration der Spätaussiedler und die staatlichen Maßnahmen dazu beleuchtet. Der Fokus liegt auf den Erfahrungen und Schwierigkeiten der Integration zweier Gruppen von Schlesiern in die Nachkriegsgesellschaft Deutschlands.
IV Schlesische Vertriebenenorganisationen: Dieses Kapitel stellt die beiden in Augsburg aktiven schlesischen Vertriebenenorganisationen vor: die Landsmannschaft Schlesien (Nieder- und Oberschlesien) e.V. und die Landsmannschaft der Oberschlesier e.V. Es analysiert deren Ziele, Aktivitäten und die soziale und kulturelle Bedeutung für ihre Mitglieder. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Organisation und ihrer Rolle in der Augsburger Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Schlesien, Vertreibung, Flüchtlinge, Spätaussiedler, Integration, Landsmannschaften, Oder-Neiße-Grenze, Deutschland, Polen, politische Partizipation, soziale Integration, kulturelle Identität, "Schlesische Nachrichten".
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Schlesier in Deutschland nach 1945
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Schlesier in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Fokus auf deren Organisation und Integration. Sie beleuchtet die Rolle der schlesischen Vertriebenenorganisationen in Augsburg und analysiert deren politische und soziale Aktivitäten anhand der Zeitung "Schlesische Nachrichten". Die Arbeit behandelt sowohl Flüchtlinge und Vertriebene als auch Spätaussiedler.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Geschichte Schlesiens, die Vertreibung der Schlesier nach dem Zweiten Weltkrieg, die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen, die Rolle der schlesischen Vertriebenenorganisationen in Augsburg (insbesondere die Landsmannschaft Schlesien und die Landsmannschaft der Oberschlesier), die politische und soziale Bedeutung der Landsmannschaften, sowie eine Diskursanalyse der Zeitung "Schlesische Nachrichten".
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquelle dieser Arbeit ist die Zeitung "Schlesische Nachrichten" der Landsmannschaft Schlesien (Nieder- und Oberschlesien) e.V. Zusätzlich wird die Geschichte Schlesiens aus verschiedenen Quellen rekonstruiert, um den Kontext der Vertreibung und der darauffolgenden Integration zu beleuchten. Weitere Quellen sind vermutlich im Quellenverzeichnis aufgeführt.
Welche Organisationen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die beiden in Augsburg aktiven schlesischen Vertriebenenorganisationen: die Landsmannschaft Schlesien (Nieder- und Oberschlesien) e.V. und die Landsmannschaft der Oberschlesier e.V. Ihre Ziele, Aktivitäten und ihre soziale und kulturelle Bedeutung für ihre Mitglieder werden analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Geschichte Schlesiens, Schlesier in Deutschland (mit Unterkapiteln zu Flüchtlingen/Vertriebenen und Spätaussiedlern), Schlesische Vertriebenenorganisationen in Augsburg, Analyse der "Schlesischen Nachrichten" (einschließlich Häufigkeitsanalyse und Interpretation), Schlussfolgerung und Quellenverzeichnis. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den Zeitraum vom Zweiten Weltkrieg bis in die Zeit nach der Vertreibung der Schlesier. Die Geschichte Schlesiens wird jedoch auch in einem größeren historischen Kontext dargestellt, beginnend mit der Unabhängigkeit Schlesiens im Jahre 1137.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Schlesien, Vertreibung, Flüchtlinge, Spätaussiedler, Integration, Landsmannschaften, Oder-Neiße-Grenze, Deutschland, Polen, politische Partizipation, soziale Integration, kulturelle Identität, "Schlesische Nachrichten".
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit?
Die zentralen Ergebnisse der Arbeit werden in der Zusammenfassung der Kapitel und der Schlussfolgerung präsentiert. Es wird erwartet, dass die Arbeit Aufschluss über die Integrationserfahrungen der Schlesier in Deutschland, die Rolle der Vertriebenenorganisationen und die Diskursmuster in der Zeitung "Schlesische Nachrichten" liefert.
- Citar trabajo
- Julia Przybilla (Autor), 2006, Schlesier in Deutschland im Spiegel ihrer Organisationen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114155