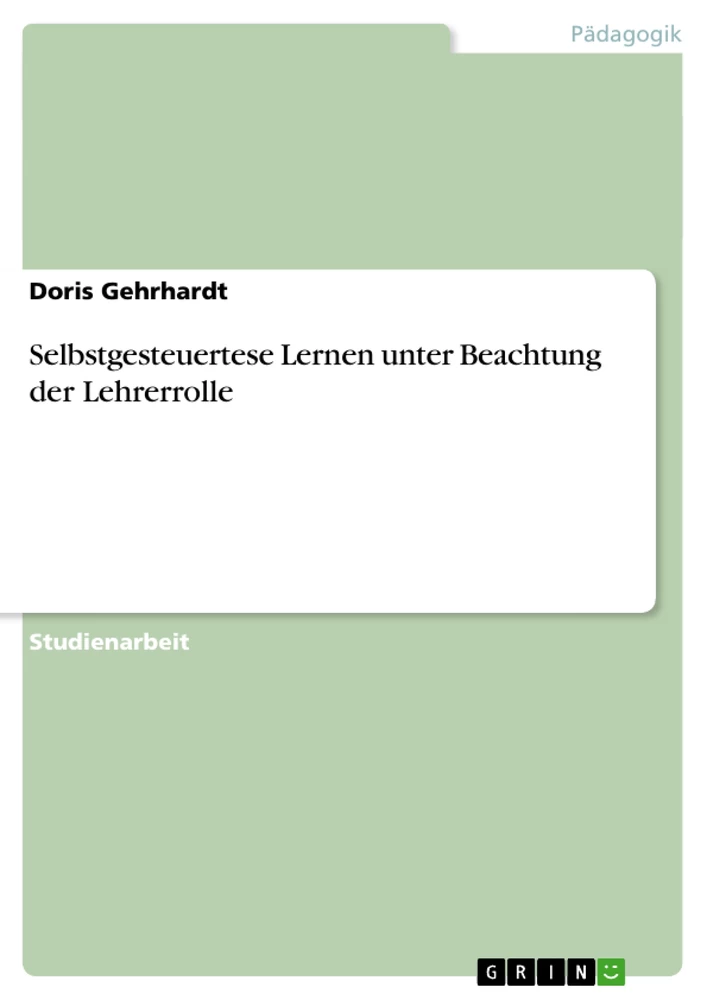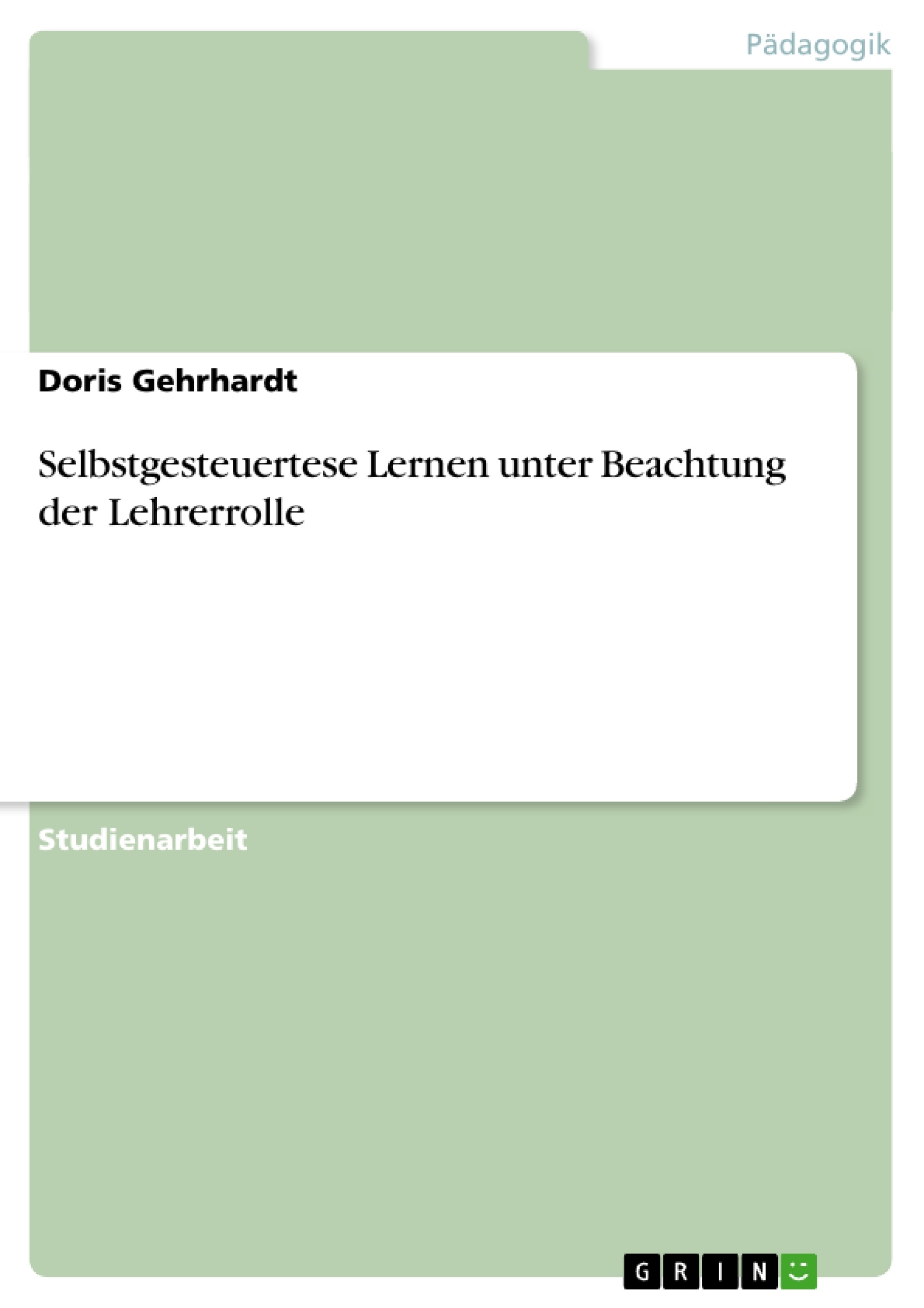Im Zuge der Diskussion über die notwendige Veränderung von Schule und Unterricht in unserer heutigen Zeit, ist das Thema des selbstständigen Lernens wieder aktuell geworden. „Dass Lernende ihre eigenen Lehrer sein sollten, ist eine alte pädagogische Forderung und ein aktueller Trend in der pädagogischen-psychologischen Diskussion“ (Konrad/Traub 1999, S.8). Die Bildungsinstitution Schule hat die Aufgabe jungen Menschen zu einem mündigen und selbstständigen Leben zu verhelfen. Daher ist in der Literatur auch oft die Rede von der Notwendigkeit, die Fähigkeit des lebenslangen Lernens zu entwickeln.
Wir leben in einer schnelllebigen Gesellschaft. Wissen veraltet durch die ständigen neuen Erkenntnisse der Wissenschaft sehr schnell, ständige Neuerungen fordern eine gewisse Flexibilität. Daher ist es für einen mündigen Menschen von Bedeutung die Befähigung zu besitzen, sich Wissen und Informationen möglichst selbstständig anzueignen. Dieses Können gibt dem Individuum die Möglichkeit mit den Anforderungen und schnellen Veränderungen in Beruf, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft Schritt zuhalten.
Diese äußeren Umstände veranlassen die allgemeine Didaktik zu einem Paradigmenwechsel von der konventionellen Vermittlungsdidaktik über eine handlungsorientierte Didaktik zu einer Autodidaktik (vgl. Bönsch, 2002, S. 143ff). Dem allgemeinen humanen und demokratischen Ziel der gesellschaftlichen Erziehung, sich in möglichst hohem Grad selbst zu bestimmen, folgt unweigerlich das pädagogische Prinzip der Selbststeuerung (Klafki 2003, S.19). Somit verändern sich auch die Anforderungen an Lernende und Lehrende. Die bisherige Rollenverteilung des Schülers und des Lehrers muss aufgebrochen werden. In dieser Arbeit soll vor allem auf die Rolle des Lehrers eingegangen werden. Was muss ein Lehrer beim schülerzentrierten Unterricht beachten? Wie kann er selbstgesteuerte Lernprozesse unterstützen und wie verändert sich die Rolle des Lehrers im Vergleich zum lehrerzentrierten Unterricht?
Um einen genaueren Rahmen für selbstgesteuertes Lernen abzustecken, wird in der Arbeit zunächst auf die Begriffsbestimmung eingegangen. Danach werden kurz die wichtigsten strategischen Kompetenzen eines selbstgesteuerten Lerners erläutert und ein Modell zur Unterscheidung von Lernphasen nach Schiefel/Pekrun (1997) vorgestellt. Anhand des Trainingsprogramms des „reziproken Lehrens“ sollen die Funktionen des Lehrers konkret dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist selbstgesteuertes Lernen?
- Begriffsbestimmung
- Selbst- vs. Fremdsteuerung
- Definitionen selbstgesteuerten Lernens
- Strategische Kompetenzen
- Rahmenmodell nach Schiefele & Pekrun
- Die Rolle des Lehrers
- Das Trainingsprogramm „reziprokes Lehren“
- Funktionen des Lehrers beim reziproken Training
- Vorbereitungsfunktion
- Modellfunktion
- Beobachtungs- und Beratungsfunktion
- Die veränderte Rolle des Lehrers
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konzept des selbstgesteuerten Lernens und untersucht die Rolle des Lehrers in diesem Kontext. Sie analysiert die Bedeutung von selbstgesteuertem Lernen in der heutigen Bildungslandschaft und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich für Lehrende und Lernende ergeben.
- Begriffsbestimmung und Definitionen von selbstgesteuertem Lernen
- Strategische Kompetenzen selbstgesteuerter Lernender
- Die Rolle des Lehrers beim selbstgesteuerten Lernen
- Das Trainingsprogramm „reziprokes Lehren“ als Beispiel für die Förderung selbstgesteuerten Lernens
- Die veränderte Rolle des Lehrers im Kontext des selbstgesteuerten Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema selbstgesteuertes Lernen ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der heutigen Bildungslandschaft. Sie stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Begriffsbestimmung von selbstgesteuertem Lernen. Es werden verschiedene Definitionen und Modelle des selbstgesteuerten Lernens vorgestellt und die wichtigsten strategischen Kompetenzen selbstgesteuerter Lernender erläutert.
Das dritte Kapitel widmet sich der Rolle des Lehrers beim selbstgesteuerten Lernen. Es werden verschiedene Funktionen des Lehrers im Kontext des selbstgesteuerten Lernens dargestellt und das Trainingsprogramm „reziprokes Lehren“ als Beispiel für die Förderung selbstgesteuerten Lernens vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen selbstgesteuertes Lernen, Lehrerrolle, reziprokes Lehren, strategische Kompetenzen, Lernphasen, Selbststeuerung, Fremdsteuerung, Bildung, Didaktik, Pädagogik, und Bildungslandschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist selbstgesteuertes Lernen?
Eine Lernform, bei der die Lernenden die wesentlichen Schritte ihrer Lernprozesse (Ziele, Methoden, Erfolgskontrolle) selbst bestimmen.
Wie verändert sich die Rolle des Lehrers dabei?
Der Lehrer wandelt sich vom reinen Wissensvermittler zum Lernbegleiter, Berater und Modell für Lernstrategien.
Was versteht man unter „reziproquem Lehren“?
Ein Trainingsprogramm, bei dem Schüler abwechselnd die Lehrerrolle übernehmen, um Textverständnis und strategische Kompetenzen zu fördern.
Welche Kompetenzen benötigt ein selbstgesteuerter Lerner?
Dazu gehören kognitive Strategien, metakognitive Planung sowie motivationale und volitionale (willensgesteuerte) Fähigkeiten.
Warum ist lebenslanges Lernen heute so wichtig?
Wegen der Schnelllebigkeit von Wissen in Beruf und Wissenschaft müssen Individuen befähigt werden, sich Informationen eigenständig anzueignen.
- Citation du texte
- Doris Gehrhardt (Auteur), 2008, Selbstgesteuertese Lernen unter Beachtung der Lehrerrolle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114159