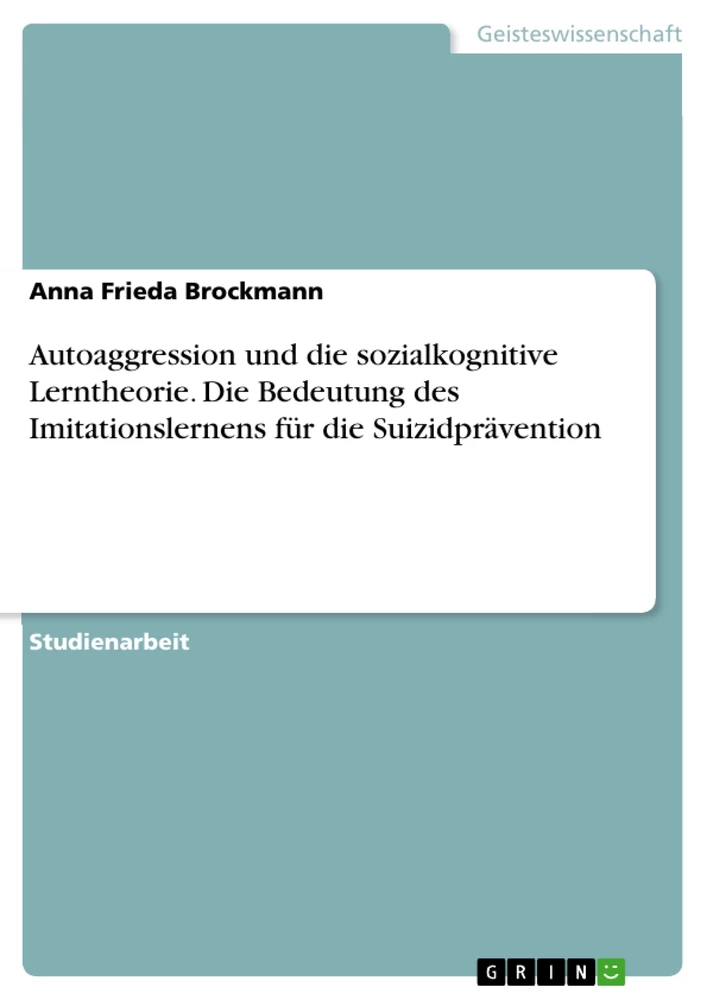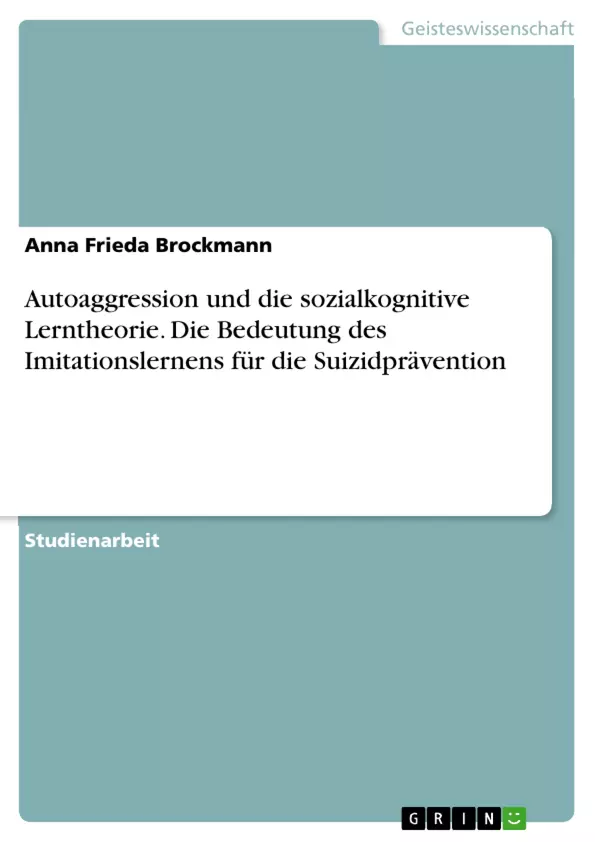Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Fragestellung, inwiefern der beobachtete Zusammenhang zwischen Suiziden und Imitationslernen auch zur Suizidprävention genutzt werden kann: Ist eine Form der Effektumkehr möglich? Können die Kenntnisse über die sozialkognitive Lerntheorie in Verbindung mit medialer Berichterstattung auch zur Suizidprophylaxe genutzt werden? Hierbei sollen aphoristisch das Modelllernen sowie im weiteren Verlauf der sogenannte Papageno-Effekt näher beleuchtet werden. Aufgrund des besonderen Schwerpunkts der Ausarbeitung, der nicht die umfassende Beantwortung der Forschungsfrage, sondern eine übersichtliche Darstellung der relevanten Quelleninhalte vorsieht, werden im Folgenden die für die Forschungsfrage essenziellen Begrifflichkeiten definiert und erklärt sowie Herausforderungen und Defizite aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Relevanz
- 2.1 Der Werther-Effekt
- 2.2 Die sozialkognitive Lerntheorie und die Rolle der Medien
- 2.3 Der Papageno-Effekt
- 2.4 Ausblick
- 3 Methodisches Vorgehen
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht den Zusammenhang zwischen Suiziden und Imitationslernen, insbesondere im Kontext medialer Berichterstattung. Die Hauptfragestellung ist, ob das Wissen über die sozialkognitive Lerntheorie zur Suizidprävention genutzt werden kann – ob also eine Art Effektumkehr möglich ist. Die Arbeit beleuchtet dabei das Modelllernen und den Papageno-Effekt.
- Der Werther-Effekt und seine Auswirkungen
- Die Rolle der sozialkognitiven Lerntheorie beim Imitationslernen
- Die Bedeutung medialer Berichterstattung für Suizidraten
- Potenzial der Suizidprävention durch die Umkehrung des Werther-Effekts
- Der Papageno-Effekt als Gegenmodell zum Werther-Effekt
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat aus Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“, das als Triggerwarnung interpretiert werden kann. Sie führt den Werther-Effekt ein – das Phänomen steigender Suizidraten nach öffentlicher Berichterstattung über Suizide – und thematisiert die Serie „13 Reasons Why“ als aktuelles Beispiel. Die zentrale Forschungsfrage ist, ob der Zusammenhang zwischen Suiziden und Imitationslernen zur Suizidprävention genutzt werden kann. Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition relevanter Begriffe und die Darstellung der Quelleninhalte.
2 Relevanz: Dieses Kapitel präsentiert die jährliche Anzahl von Suiziden in Deutschland und betont den Beitrag psychologischer Forschung zur Reduktion dieser Zahlen durch Primärpräventionsmaßnahmen. Es wird die Relevanz von Imitationshandlungen nach medialer Berichterstattung über Suizide hervorgehoben, wobei die sozialkognitive Lerntheorie als zentrale Grundlage für die Erklärung dieser Phänomene dient. Die Bedeutung der Thematik für die Allgemeine Psychologie wird ebenfalls unterstrichen.
2.1 Der Werther-Effekt: Dieser Abschnitt definiert den Werther-Effekt nach David Phillips und veranschaulicht seine anhaltende Relevanz anhand von Beispielen wie dem Tod von Robin Williams und der Serie „13 Reasons Why“. Es werden Studien zitiert, die den Anstieg der Suizidraten nach suizidthematisierenden Medienberichten belegen und die damit verbundenen Herausforderungen für die Prävention unterstreichen.
3 Methodisches Vorgehen: (Anmerkung: Da der Text nur einen kurzen Hinweis auf das methodische Vorgehen liefert, kann an dieser Stelle nur eine allgemeine Aussage getroffen werden.) Dieses Kapitel beschreibt vermutlich die Methoden, die zur Untersuchung des Themas angewendet wurden, inklusive Datenerhebung und -auswertung, falls vorhanden. Dies könnte z.B. eine Literaturrecherche und eine Analyse relevanter Studien umfassen.
Schlüsselwörter
Werther-Effekt, Papageno-Effekt, Suizidprävention, Imitationslernen, sozial-kognitive Lerntheorie, Medienberichterstattung, Suizid, Modelllernen, Suizidrate, Primärprävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Zusammenhangs zwischen Suiziden und Imitationslernen
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Suiziden und Imitationslernen, insbesondere im Kontext medialer Berichterstattung. Der Fokus liegt auf der Frage, ob das Wissen über die sozialkognitive Lerntheorie zur Suizidprävention genutzt werden kann – ob also eine Art Effektumkehr möglich ist. Dabei werden der Werther-Effekt und der Papageno-Effekt als zentrale Konzepte betrachtet.
Was sind die wichtigsten Themenschwerpunkte?
Die Arbeit behandelt den Werther-Effekt und seine Auswirkungen, die Rolle der sozialkognitiven Lerntheorie beim Imitationslernen, die Bedeutung medialer Berichterstattung für Suizidraten, das Potenzial der Suizidprävention durch die Umkehrung des Werther-Effekts und den Papageno-Effekt als Gegenmodell zum Werther-Effekt.
Was ist der Werther-Effekt?
Der Werther-Effekt beschreibt den Anstieg von Suizidraten nach öffentlicher Berichterstattung über Suizide. Die Arbeit beleuchtet diesen Effekt anhand von Beispielen wie dem Tod von Robin Williams und der Serie „13 Reasons Why“ und veranschaulicht seine anhaltende Relevanz mit entsprechenden Studien.
Was ist der Papageno-Effekt?
Die Arbeit erwähnt den Papageno-Effekt als Gegenmodell zum Werther-Effekt. Nähere Einzelheiten zum Papageno-Effekt und seiner konkreten Bedeutung im Kontext der Arbeit sind aus dem gegebenen Textfragment nicht vollständig ersichtlich.
Welche Rolle spielt die sozial-kognitive Lerntheorie?
Die sozial-kognitive Lerntheorie dient als zentrale Grundlage für die Erklärung des Imitationslernens im Kontext von Suiziden und medialer Berichterstattung. Die Arbeit untersucht, ob diese Theorie zur Entwicklung von Suizidpräventionsmaßnahmen genutzt werden kann.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Relevanz des Themas (inkl. Unterkapitel zum Werther-Effekt), ein Kapitel zum methodischen Vorgehen und ein Fazit. Die Einleitung enthält eine Triggerwarnung und führt in die Thematik ein. Das Kapitel zur Relevanz beleuchtet die jährliche Suizidrate in Deutschland und den Beitrag psychologischer Forschung zur Suizidprävention.
Welche Methoden wurden angewendet?
Der gegebene Text enthält nur einen kurzen Hinweis auf das methodische Vorgehen. Es wird vermutet, dass eine Literaturrecherche und die Analyse relevanter Studien durchgeführt wurden, nähere Details sind jedoch nicht verfügbar.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Werther-Effekt, Papageno-Effekt, Suizidprävention, Imitationslernen, sozial-kognitive Lerntheorie, Medienberichterstattung, Suizid, Modelllernen, Suizidrate, Primärprävention.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit (vorläufig)?
Eine konkrete Schlussfolgerung lässt sich aus dem vorliegenden Textfragment nicht ableiten. Die Arbeit untersucht die Möglichkeit der Suizidprävention durch die Anwendung der Erkenntnisse der sozial-kognitiven Lerntheorie und die Umkehrung des Werther-Effekts. Das Fazit der Arbeit wird im Text nicht explizit dargestellt.
- Arbeit zitieren
- Anna Frieda Brockmann (Autor:in), 2020, Autoaggression und die sozialkognitive Lerntheorie. Die Bedeutung des Imitationslernens für die Suizidprävention, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1141826