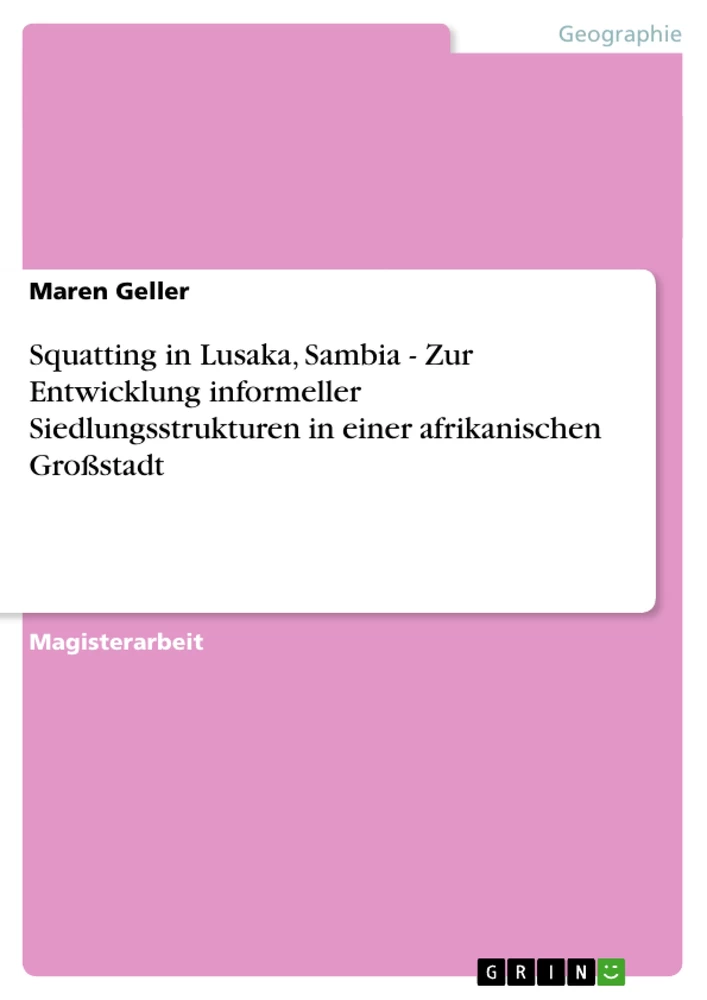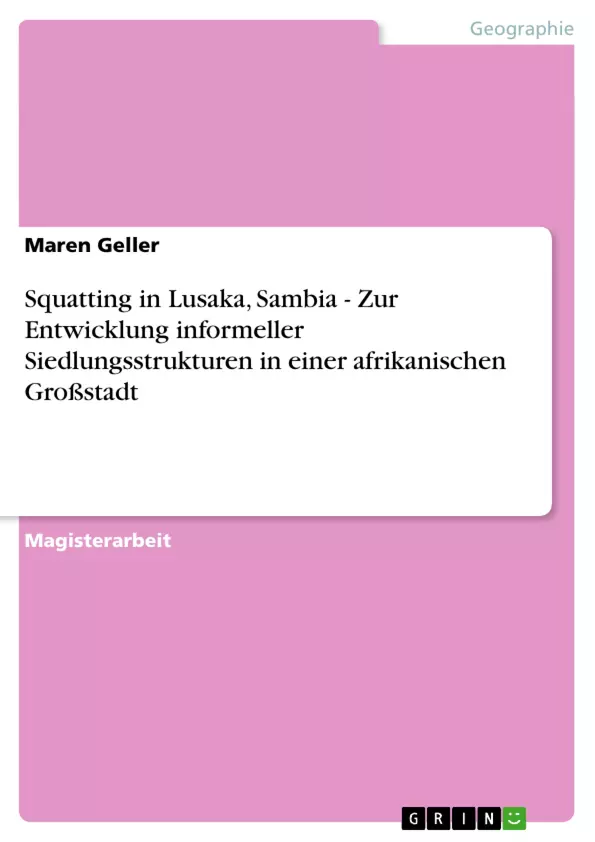Das weltweit bekannte Phänomen der informellen Siedlungen, d. h. solche, die ohne behördliche Genehmigung bzw. Planung entstanden sind, war bereits in den letzten 50 Jahren in entwicklungspolitischen Diskussionen zu finden. Durch die rasante Verstädterung und fehlende Steuerungsprozesse entwickelte sich bereits in den 1950er Jahren in vielen Großstädten in Ländern der Dritten Welt die Wohnraumversorgung einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen zum Problem. Die starke Land-Stadt-Migration und das hohe natürliche Bevölkerungswachstum in den 1960er Jahren sowie die ansteigende Verarmung der Mittelschichten und der Arbeiterschaft führte zunehmend zur Marginalisierung dieser Bevölkerungsgruppen, da der formelle Wohnungssektor der Nachfrage nach Wohnraum nicht nachkommen konnte und dieser ebenso für die Bevölkerungsmehrheit unerschwinglich und teilweise unangemessen war. Die einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen wurden zur Suche nach Wohnmöglichkeiten auf der informellen Seite gezwungen, die zumeist nur Behausungsprovisorien darstellten. Die Zunahme der Bevölkerung in den informellen Siedlungen, die damals bereits die Ränder der Metropolen und vieler Großstädte der Entwicklungsländer prägten und die Mehrheit der Bevölkerung dort beherbergten, hielt auch in den 1970er und 1980er Jahren an und stellte die offizielle Seite vor große Probleme. Informellen Siedlungen wurde vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt und Anfang der 1960er Jahre wurden sie zum ersten Mal von der UNO untersucht. Bis Mitte/Ende der 1960er Jahren wurde von den städtischen Behörden versucht, den informellen Siedlungen durch den am europäischen Vorbild orientierten sozialen Wohnungsbau (low cost housing) entgegenzuwirken. Die Unangemessenheit des konventionellen Wohnungsbaus zur Lösung des Wohnungsproblems in Städten der Dritten Welt wurde allerdings schnell erkannt und der Abriss der informellen Siedlungen, den viele Regierungen ebenso als konventionelle Maßnahme durchführten, wurde ebenso oftmals zu Gunsten von Sanierungs- und Konsolidierungsprogrammen aufgegeben. Als neuer Lösungsansatz wurde Anfang der 1970er Jahre die unterstützte Selbsthilfe im Wohnungssektor eingeführt, die eine wichtige Komponente der non conventional housing policies darstellte.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 1.1 Hinführung zum Thema
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2.0 Klärung der Begriffe informelle Siedlung und squatting
- 3.0 Entwicklung von Lusaka und Entstehung der squatter unter Einbezug der wohnungspolitischen Maßnahmen
- 4.0 Das Lusaka Squatter Upgrading and Sites and Services Project der Weltbank
- 4.1 Voraussetzungen für das Weltbankengagement in Lusaka
- 4.2 Ziele des Projektes
- 4.3 Partizipation der squatter
- 5.0 Die Entwicklung der informellen Siedlungsstrukturen in George
- 5.1 Entstehung und Demographie von George
- 5.2 Strukturen in George vor der Modernisierung
- 5.2.1 Bauformen und Baumaterial
- 5.2.2 Besitzverhältnisse
- 5.2.3 Bebauungsmuster und Dichte
- 5.2.4 Technische Infrastruktur
- 5.2.5 Soziale Infrastruktur
- 5.2.6 Organisation im squatter
- 5.3 Erwartungen der Bewohner hinsichtlich der Modernisierung
- 5.4 Upgrading in George
- 5.4.1 Auswirkungen auf die Behausungen und die Siedlungsstrukturen
- 5.4.2 Auswirkungen auf die Besitzverhältnisse
- 5.4.3 Einrichtung technischer und sozialer Infrastruktur
- 5.4.4 Bereitstellungsgebühr und Kostendeckung
- 5.4.5 Errichtung von George overspill und die Folgen
- 6.0 Auswertung des Projektes
- 6.1 Hausbau in Selbsthilfe und Besitzverhältnisse
- 6.2 Geschäfte zur Materialversorgung und Materialdarlehen
- 6.3 Infrastrukturelle Maßnahmen
- 6.4 Auswirkungen auf die Beschäftigung und gewerbliche Nutzung
- 6.5 Erschwinglichkeit für die Bewohner und Kostendeckung
- 6.6 Partizipation der Bevölkerung bei der Planung und Durchführung
- 6.7 Verwaltung des Projektes
- 6.8 Einfluss des Projektes auf die Wohnungspolitik
- 7.0 Schlussbetrachtung und Ausblick
- 8.0 Abkürzungsverzeichnis
- 9.0 Anhang
- 9.1 Abbildungen
- 9.2 Tabellen
- 10.0 Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Entwicklung informeller Siedlungsstrukturen in Lusaka, Sambia, im Kontext der rasanten Urbanisierung und der damit verbundenen Herausforderungen der Wohnraumversorgung. Die Arbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung von Squatter-Siedlungen, die Rolle der Weltbank im Rahmen des Lusaka Squatter Upgrading and Sites and Services Project sowie die Auswirkungen des Projektes auf die Lebensbedingungen der Bewohner.
- Die Entstehung und Entwicklung informeller Siedlungsstrukturen in Lusaka
- Die Rolle der Weltbank bei der Verbesserung der Lebensbedingungen in Squatter-Siedlungen
- Die Auswirkungen des Upgrading-Projektes auf die Bewohner, insbesondere auf die Besitzverhältnisse, die Infrastruktur und die soziale Organisation
- Die Herausforderungen der Wohnungspolitik in Sambia im Kontext der Urbanisierung
- Die Bedeutung von Selbsthilfe und Partizipation bei der Entwicklung von informellen Siedlungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der informellen Siedlungen und deren Bedeutung in der Entwicklung von Städten in Ländern der Dritten Welt ein. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Themas und die verschiedenen Ansätze zur Bewältigung des Wohnungsproblems in diesen Städten.
Kapitel 2 klärt die Begriffe informelle Siedlung und squatting und definiert die wichtigsten Merkmale dieser Siedlungsformen.
Kapitel 3 beschreibt die Entwicklung von Lusaka und die Entstehung der Squatter-Siedlungen im Kontext der wohnungspolitischen Maßnahmen der sambischen Regierung.
Kapitel 4 analysiert das Lusaka Squatter Upgrading and Sites and Services Project der Weltbank, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensbedingungen in Squatter-Siedlungen zu verbessern. Es werden die Voraussetzungen für das Weltbankengagement in Lusaka, die Ziele des Projektes und die Partizipation der Squatter-Bewohner beleuchtet.
Kapitel 5 untersucht die Entwicklung der informellen Siedlungsstrukturen in George, einer Squatter-Siedlung in Lusaka, die im Rahmen des Weltbankprojektes modernisiert wurde. Es werden die Entstehung und Demographie von George, die Strukturen vor der Modernisierung sowie die Auswirkungen des Upgrading-Projektes auf die Behausungen, die Besitzverhältnisse, die Infrastruktur und die soziale Organisation der Bewohner analysiert.
Kapitel 6 bewertet das Lusaka Squatter Upgrading and Sites and Services Project anhand verschiedener Kriterien, wie z. B. der Auswirkungen auf den Hausbau, die Materialversorgung, die Infrastruktur, die Beschäftigung und die Erschwinglichkeit für die Bewohner.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen informelle Siedlungen, Squatting, Urbanisierung, Lusaka, Sambia, Weltbank, Upgrading-Projekte, Wohnungspolitik, Selbsthilfe, Partizipation, Infrastruktur, Besitzverhältnisse, soziale Organisation, Lebensbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind informelle Siedlungen oder "Squatter"-Siedlungen?
Es handelt sich um Siedlungen, die ohne behördliche Genehmigung oder Planung entstanden sind, meist durch einkommensschwache Bevölkerungsgruppen infolge rasanter Urbanisierung.
Was war das Ziel des Weltbank-Projekts in Lusaka?
Das "Lusaka Squatter Upgrading and Sites and Services Project" zielte darauf ab, die Lebensbedingungen durch Infrastrukturmaßnahmen, technische Hilfe und die Förderung von Selbsthilfe zu verbessern, anstatt Siedlungen abzureißen.
Wie funktionierte das "Upgrading" in der Siedlung George?
Bestehende Behausungen wurden modernisiert, technische Infrastruktur (Wasser, Wege) wurde bereitgestellt und die Bewohner wurden aktiv in den Planungsprozess und den Hausbau in Selbsthilfe einbezogen.
Welche Rolle spielt die Selbsthilfe bei informellen Siedlungen?
Selbsthilfe ist eine zentrale Komponente nicht-konventioneller Wohnungspolitik. Sie ermöglicht es Bewohnern, mit begrenzten Mitteln und Materialdarlehen ihren eigenen Wohnraum schrittweise zu verbessern.
Was sind die größten Herausforderungen der Urbanisierung in Sambia?
Die starke Land-Stadt-Migration führt zu einem Mangel an formellem Wohnraum, einer Überlastung der Infrastruktur und einer zunehmenden Marginalisierung armer Bevölkerungsschichten.
- Citar trabajo
- Magistra Artium Maren Geller (Autor), 2008, Squatting in Lusaka, Sambia - Zur Entwicklung informeller Siedlungsstrukturen in einer afrikanischen Großstadt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114206