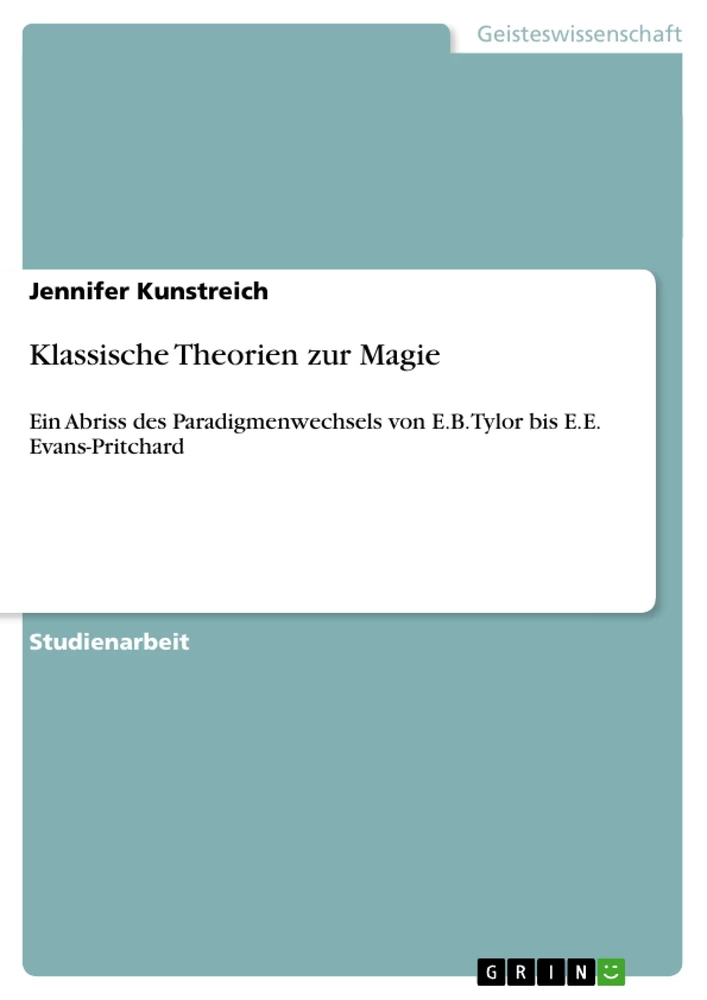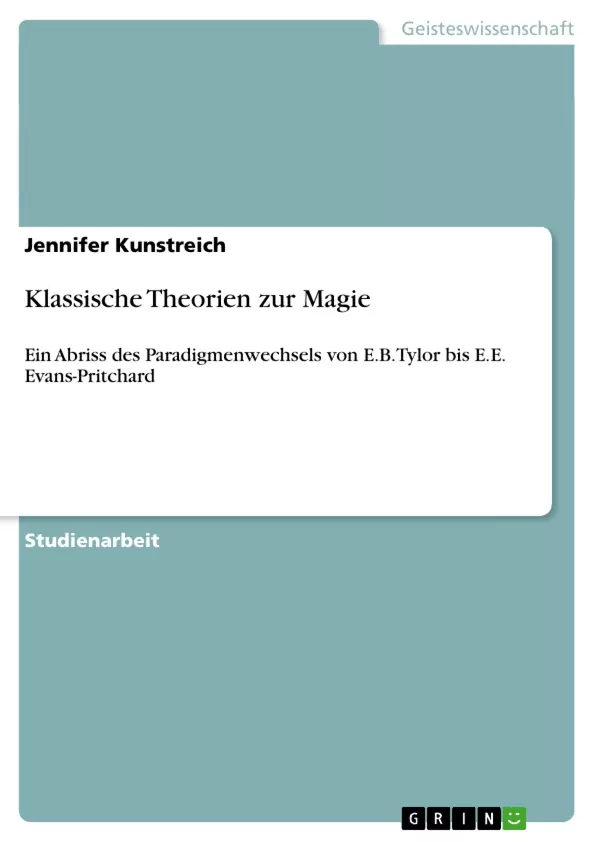Der Begriff Magie ist durch die wissenschaftliche Literatur ebenso wenig abschließend zu definieren, wie der Begriff Religion. Nach einer Beurteilung von Kippenberg wird Magie auch immer nur „eine Restkategorie bleiben, vom wissenschaftlichen Beobachter geschaffen, um Handeln, das ihm unverständlich (irrational) erscheint, zusammenzufassen.“ Vielleicht lässt sich durch eine solche Art der Begriffsbestimmung erklären, warum der Versuch Magie zu definieren bei dem überwiegenden Anteil der Theorien an eine Abgrenzung zu anderen kulturellen Kernkategorien, zumeist Religion und Wissenschaft, gekoppelt war und zum Teil wieder ist.
Heinz Mürmel sah in dieser Dreierbeziehung, Magie – Wissenschaft – Religion, gar die Grundstruktur aller gängigen Magietheorien. Gesetzt wurde diese Struktur von James Frazer, der als erster eine klar formulierte Magietheorie auf diesen drei Kategorien aufbaute. Auch wenn es unwahrscheinlich scheint, dass diese lange überholten Theorie, die in den Jahren zwischen 1890 und 1911 Gestalt annahm, auch heute noch Einfluss haben soll, so bleibt es doch auffällig, dass sämtliche der in dem folgenden Abriss zu den klassischen Magietheorie berücksichtigten Wissenschaftler, zunächst einmal mit Frazer abrechneten ehe sie ihre eigenen Gedanken entfalteten. Selbst neuere Schriften, wie die 1992 erschienene Dissertation zur religionswissenschaftlichen Konstruktion der Begriffe Mythos, Mutterrecht und Magie von Susanne Landwerd, baut die Begriffsbestimmung der Magie, wenn auch unter Berücksichtigung aktuellerer Strömungen, auf den Gedanken Frazers auf.
Meine Auswahl der hier aufgeführten Positionen zur Magie wurde zum einen beeinflusst, durch die Einleitung des Buches von Hans Kippenberg und Brigitte Luchesi , welche einen Überblick über die Magietheorien einiger Forscher von Tylor bis Evans-Pritchard liefert. Zum anderen durch die Darstellung der „führenden Betrachtungsweisen“ zur Magie in dem Aufsatz von Murray und Rosalie Wax. Beide Schriften stellen die Differenzen der wichtigsten Vertreter unterschiedlicher Paradigmen pointiert gegenüber. Die vorliegende Arbeit soll - auf einer zweiten Ebene - zudem den Magiebegriff als Indikator für die wechselnden Paradigmen in der Religionswissenschaft beleuchten. Denn: „Zu den Komplexen, an denen sich religionswissenschaftliche Grundpositionen gewissermaßen gebündelt ablesen lassen, gehört das Phänomen der Magie.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Evolutionismus
- Kontext
- Edward Burnett Tylor
- James Georg Frazer
- Unterteilung der Magie bei Frazer
- Magie als irreführende Wissenschaft
- Entwicklungslinie: Magie – Religion – Wissenschaft
- Robert Ranulph Marett - ein Grenzgänger zwischen den Paradigmen
- Das ungeteilte Ur-Gefühl
- Religion sozial/ Magie - antisozial
- Der soziologische Ansatz
- Magie als soziale Tatsache
- Magie als Konsens einer Sozietät
- Die funktionalistische Deutung von Magie
- Die Anfänge empirischer Forschung
- Die kompensatorische Funktion von Magie
- Magie ist die Macht des Menschen
- Magie, Religion und Wissenschaft als sich ergänzende Komponenten
- Der Empirismus Evans-Pritchards
- Magie als kohärentes System
- Schluss
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit bietet einen Abriss des Paradigmenwechsels in der wissenschaftlichen Betrachtung von Magie, beginnend mit den evolutionistischen Ansätzen von E.B. Tylor und J.G. Frazer bis hin zum empirischen Ansatz von E.E. Evans-Pritchard. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Magiebegriffs und die unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Phänomen, die sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert haben.
- Die Entwicklung des Magiebegriffs im Kontext der wissenschaftlichen Paradigmen des 19. und 20. Jahrhunderts
- Die Abgrenzung von Magie zu Religion und Wissenschaft
- Die verschiedenen Ansätze zur Erklärung von Magie, darunter Evolutionismus, Soziologie und Funktionalismus
- Die Bedeutung von empirischen Studien für das Verständnis von Magie
- Der Wandel des Magiebegriffs als Indikator für die Entwicklung der Religionswissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Schwierigkeit, den Begriff Magie eindeutig zu definieren. Sie stellt die Bedeutung der Abgrenzung von Magie zu anderen kulturellen Kernkategorien, insbesondere Religion und Wissenschaft, heraus und zeigt die Relevanz des Paradigmenwechsels in der Religionswissenschaft für das Verständnis des Magiebegriffs.
Das Kapitel „Evolutionismus“ behandelt die Ansätze von E.B. Tylor und J.G. Frazer, die Magie als ein Stadium der menschlichen Entwicklung betrachteten, das von Religion und Wissenschaft abgelöst wird. Es werden die historischen und wissenschaftlichen Kontexte, die die Arbeiten von Tylor und Frazer prägten, beleuchtet, sowie die Kritik an ihren evolutionistischen Ansätzen.
Das Kapitel „Robert Ranulph Marett - ein Grenzgänger zwischen den Paradigmen“ stellt die Position von Marett dar, der die Unterscheidung zwischen Magie und Religion in Frage stellte und ein „ungeteiltes Ur-Gefühl“ als Grundlage beider Phänomene postulierte. Es werden die Unterschiede in der sozialen Funktion von Magie und Religion herausgearbeitet.
Das Kapitel „Der soziologische Ansatz“ behandelt die soziologische Perspektive auf Magie, die sie als soziale Tatsache und als Ausdruck des Konsenses einer Sozietät betrachtet. Es werden die Ansätze von Émile Durkheim und Marcel Mauss vorgestellt, die Magie als ein soziales Phänomen mit spezifischen Funktionen innerhalb einer Gesellschaft analysierten.
Das Kapitel „Die funktionalistische Deutung von Magie“ beleuchtet die funktionalistische Perspektive auf Magie, die sie als ein Mittel zur Bewältigung von Problemen und zur Stärkung der sozialen Ordnung betrachtet. Es werden die Ansätze von Bronislaw Malinowski und A.R. Radcliffe-Brown vorgestellt, die die Funktionen von Magie in verschiedenen Gesellschaften untersuchten.
Das Kapitel „Der Empirismus Evans-Pritchards“ behandelt den empirischen Ansatz von E.E. Evans-Pritchard, der Magie als ein kohärentes System innerhalb einer Kultur betrachtete. Es werden seine Studien zur Magie bei den Azande in Afrika vorgestellt, die die Bedeutung von empirischen Feldforschungen für das Verständnis von Magie unterstreichen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Begriff Magie, die Abgrenzung von Magie zu Religion und Wissenschaft, den Paradigmenwechsel in der Religionswissenschaft, Evolutionismus, Soziologie, Funktionalismus, Empirismus, sowie die Ansätze von E.B. Tylor, J.G. Frazer, R.R. Marett, E. Durkheim, M. Mauss, B. Malinowski, A.R. Radcliffe-Brown und E.E. Evans-Pritchard.
- Quote paper
- Jennifer Kunstreich (Author), 2003, Klassische Theorien zur Magie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114211