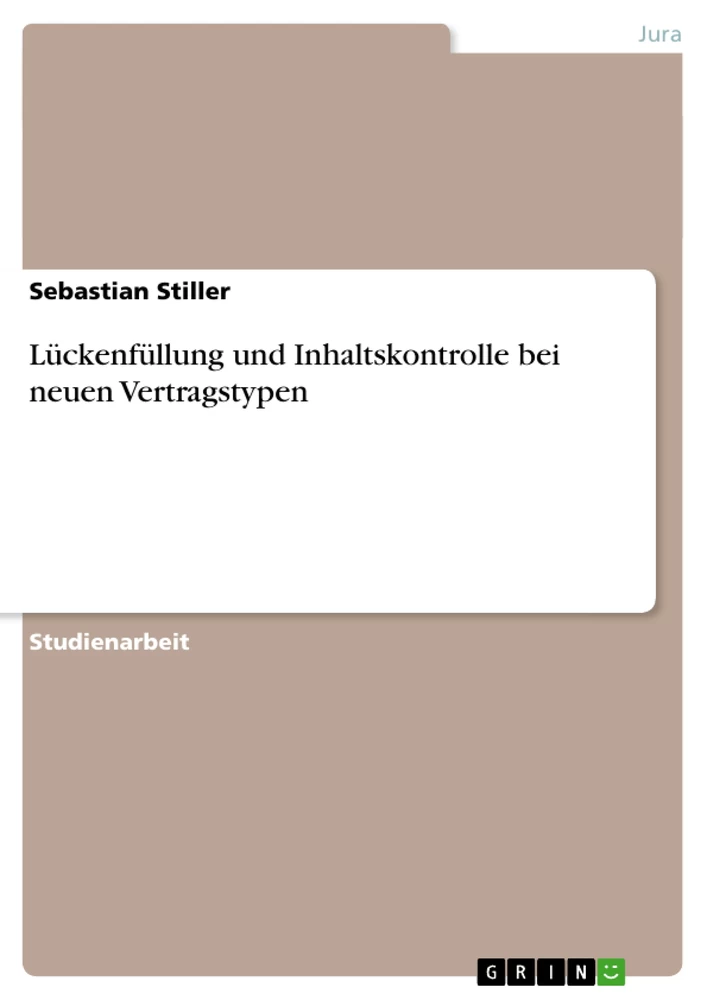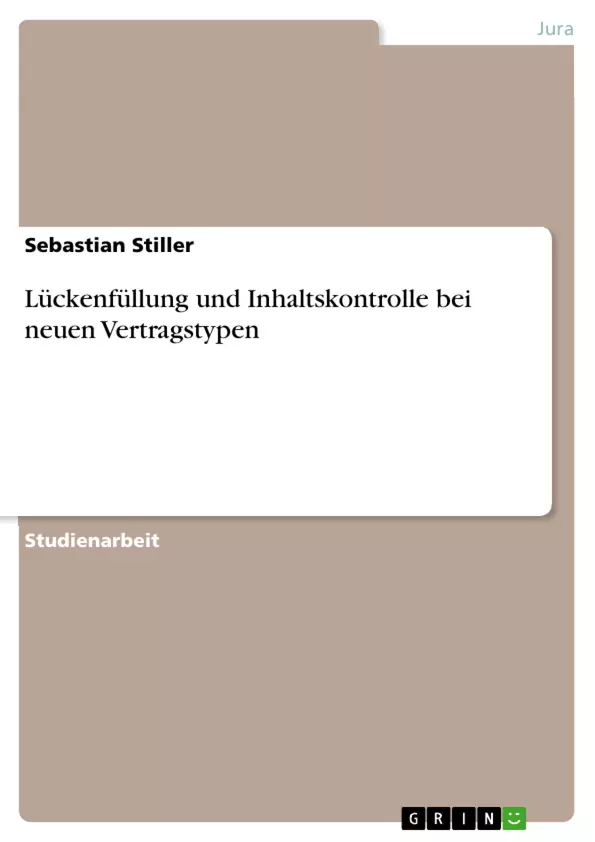In den letzten Jahrzehnten entwickelten sich immer mehr verkehrstypische Verträge, die nicht oder kaum mehr in die bestehende Vertragsstruktur passten und deshalb von der Lehre als neue Vertragstypen anerkannt wurden. Neue Vertragstypen sind die in der heutigen Rechtswirklichkeit häufig vorgefundenen neuartigen Formen von Verträgen, geprägt durch eine oft wiederkehrende Interessenkonstellation und Regelungsprogrammatik der Parteien von früher unbekannter Eigenart. Man kann schätzen, dass (mit Ausnahme der Handgeschäfte des täglichen Lebens) weit mehr als die Hälfte des wirtschaftlichen Transfers durch Verträge abgebildet wird, die im BGB nicht oder nur unzureichend enthalten sind. Es lässt sich feststellen, dass neue Vertragstypen, wie z. B. Leasing, Factoring- und Franchiseverträge in unserer heutigen Wirtschaftsordnung eine herausragende Bedeutung erlangt haben. Ihre rechtliche Einordnung und dogmatisch-konstruktive Erfassung hat sich in der deutschen Rechtsordnung jedoch als überaus schwierig erwiesen. Es fehlt an normativ begründeten Deutungs-, Ergänzungs- und Kontrollmaßstäben. Auswirkungen ergeben sich insoweit u. a. auf die Ausfüllung von Regelungslücken von Parteivereinbarungen. An die Stelle fehlender gesetzlicher Regelungen treten in der Praxis auf breiter Front Allgemeine Geschäftsbedingungen. Dem gilt es bei der Inhaltskontrolle neuer Vertragstypen entsprechend Rechnung zu tragen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Teil: Einleitung
- Teil: Lückenfüllung und Inhaltskontrolle bei neuen Vertragstypen
- A. Neue Vertragstypen
- I. Begrifflichkeiten
- II. Gemeinsamkeiten
- III. Probleme
- IV. Typologie
- 1. Bedeutung
- 2. Typengemischte und typenfremde Verträge
- 3. Kritik
- V. Rechtsnatur- und Rechtsfolgenbestimmung
- 1. Bedeutung
- 2. Verträge sui generis
- 3. Typengemischte Verträge
- a.) Theorienstreit um die Behandlung gemischter Verträge
- b.) Absorptionstheorie
- c.) Kombinationstheorie
- d.) Theorie der analogen Rechtsanwendung
- B. Lückenfüllung
- I. Bedeutung
- II. Ergänzende Vertragsauslegung
- 1.) Grundkonzeption
- 2.) Verhältnis von ergänzender Vertragsauslegung und dispositivem Recht
- 3.) Methodik
- a.) Feststellung einer Regelungslücke
- b.) Lückenschließung aus eigenem Zweckzusammenhang
- c.) Berücksichtigung normativer Wertungen
- aa.) Berücksichtigung gesetzlicher Regelungen
- bb.) Wertende Zuordnung auf der Stufe gesetzlicher Einzelanordnungen
- cc.) Annäherung an gesetzliches Vertragstypenrecht bei gemischten Verträgen
- d.) Einfluss einer gängigen Vertragspraxis
- III. Die Lehre vom Fehlen der Geschäftsgrundlage
- C. Inhaltskontrolle
- I. Bedeutung
- II. § 307 BGB - Die Generalklausel
- 1. Bedeutung und Funktion des § 307 Abs. 1 und 2 BGB
- 2. Die Rolle von Leitbildern im Rahmen der Inhaltskontrolle
- 3. Grenzen der Leitbildtheorie
- 4. Die „gesetzliche Regelung“ als Vergleichsmaßstab
- a.) Grundkonzeption
- b.) Vergleichende Betrachtung
- 5. Fehlentwicklungen im Rahmen der Typentheorie
- 6. Die konkrete Vertragsordnung als Gerechtigkeitsmaßstab
- a.) Grundkonzeption
- b.) Das Prüfungsprogramm
- aa.) Natur des Vertrags
- bb.) „Wesentlichkeit“ der Rechte oder Pflichten
- cc.) „Einschränkung“ wesentlicher Rechte oder Pflichten
- dd.) „Vertragszweckgefährdung“
- 7. Auswirkungen unwirksamer Klauseln
- A. Neue Vertragstypen
- Teil: Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Lückenfüllung und Inhaltskontrolle bei neuen Vertragstypen. Ziel ist es, die Herausforderungen der Rechtsanwendung im Kontext neuartiger Geschäftsmodelle zu beleuchten und Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Rechtsnatur neuer Vertragstypen
- Methoden der Lückenfüllung bei atypischen Verträgen
- Anwendung der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB auf neue Vertragstypen
- Theorienstreit um die Behandlung gemischter Verträge
- Bedeutung der Vertragsauslegung und -gestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Teil: Einleitung: Dieser Teil dient als Einführung in die Thematik der Lückenfüllung und Inhaltskontrolle bei neuen Vertragstypen. Er skizziert die Problemstellung und die Vorgehensweise der Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext der dynamischen Entwicklung von Geschäftsmodellen hervorgehoben und die Forschungsfrage der Arbeit formuliert.
Teil: Lückenfüllung und Inhaltskontrolle bei neuen Vertragstypen: Dieser zentrale Teil der Arbeit befasst sich eingehend mit den Herausforderungen der Lückenfüllung und Inhaltskontrolle im Umgang mit neuartigen Vertragstypen. Er analysiert zunächst die Besonderheiten dieser Vertragstypen, beleuchtet die damit verbundenen Probleme und bietet eine Typologie zur besseren Einordnung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Rechtsnaturbestimmung und den daraus resultierenden Rechtsfolgen. Im Detail werden verschiedene Theorien zur Behandlung typengemischter Verträge diskutiert, darunter die Absorptionstheorie und die Kombinationstheorie. Der Abschnitt über die Lückenfüllung widmet sich der ergänzenden Vertragsauslegung, ihrer Methodik und den verschiedenen Faktoren, die bei der Lückenschließung berücksichtigt werden müssen (z.B. gesetzliche Regelungen, Vertragspraxis). Die Inhaltskontrolle wird im Kontext von § 307 BGB untersucht, wobei die Rolle von Leitbildern und die Grenzen der Leitbildtheorie analysiert werden. Die Arbeit diskutiert ebenfalls die konkrete Vertragsordnung als Gerechtigkeitsmaßstab und beleuchtet die Auswirkungen unwirksamer Klauseln.
Schlüsselwörter
Lückenfüllung, Inhaltskontrolle, neue Vertragstypen, § 307 BGB, gemischte Verträge, Vertragsauslegung, Rechtsnatur, Geschäftsgrundlage, Typentheorie, Leitbildtheorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Lückenfüllung und Inhaltskontrolle bei neuen Vertragstypen
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Herausforderungen der Rechtsanwendung im Kontext neuartiger Geschäftsmodelle, indem sie sich eingehend mit der Lückenfüllung und Inhaltskontrolle bei neuen Vertragstypen beschäftigt. Sie beleuchtet die Probleme und bietet Lösungsansätze.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: die Rechtsnatur neuer Vertragstypen, Methoden der Lückenfüllung bei atypischen Verträgen, die Anwendung der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB auf neue Vertragstypen, den Theorienstreit um die Behandlung gemischter Verträge und die Bedeutung der Vertragsauslegung und -gestaltung. Im Detail werden verschiedene Theorien zur Behandlung typengemischter Verträge (Absorptionstheorie, Kombinationstheorie etc.), die ergänzende Vertragsauslegung und ihre Methodik, sowie die Rolle von Leitbildern und die Grenzen der Leitbildtheorie im Kontext von § 307 BGB analysiert.
Welche Struktur hat die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil ("Lückenfüllung und Inhaltskontrolle bei neuen Vertragstypen") und eine Schlussbetrachtung. Der Hauptteil analysiert die Besonderheiten neuer Vertragstypen, ihre Typologie, die Rechtsnaturbestimmung und die daraus resultierenden Rechtsfolgen. Er widmet sich ausführlich der Lückenfüllung (einschließlich ergänzender Vertragsauslegung und der Lehre vom Fehlen der Geschäftsgrundlage) und der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB, inkl. der Diskussion um die "gesetzliche Regelung" und die "konkrete Vertragsordnung" als Gerechtigkeitsmaßstab.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine analytische Methode, die verschiedene juristische Theorien und Ansätze vergleicht und kritisch bewertet. Sie stützt sich auf die Auslegung von Rechtsnormen (insbesondere § 307 BGB), die Analyse von Rechtsprechung und Literatur sowie die systematische Darstellung der Thematik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lückenfüllung, Inhaltskontrolle, neue Vertragstypen, § 307 BGB, gemischte Verträge, Vertragsauslegung, Rechtsnatur, Geschäftsgrundlage, Typentheorie, Leitbildtheorie.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Ziel ist es, die Herausforderungen der Rechtsanwendung im Kontext neuartiger Geschäftsmodelle zu beleuchten und Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Arbeit soll ein besseres Verständnis der Lückenfüllung und Inhaltskontrolle bei neuen Vertragstypen ermöglichen.
Wie ist der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst ein Abkürzungsverzeichnis, eine Einleitung, einen Hauptteil mit Unterkapiteln zu neuen Vertragstypen (Begrifflichkeiten, Gemeinsamkeiten, Probleme, Typologie, Rechtsnatur und Rechtsfolgenbestimmung), Lückenfüllung (Bedeutung, ergänzende Vertragsauslegung, Lehre vom Fehlen der Geschäftsgrundlage) und Inhaltskontrolle (§ 307 BGB, Generalklausel, Leitbilder, konkrete Vertragsordnung als Gerechtigkeitsmaßstab), sowie eine Schlussbetrachtung und ein Literaturverzeichnis.
Welche Theorien werden im Zusammenhang mit gemischten Verträgen diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Theorien zur Behandlung gemischter Verträge, unter anderem die Absorptionstheorie, die Kombinationstheorie und die Theorie der analogen Rechtsanwendung.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Finanzwirt (FH) Sebastian Stiller (Autor:in), 2008, Lückenfüllung und Inhaltskontrolle bei neuen Vertragstypen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114240