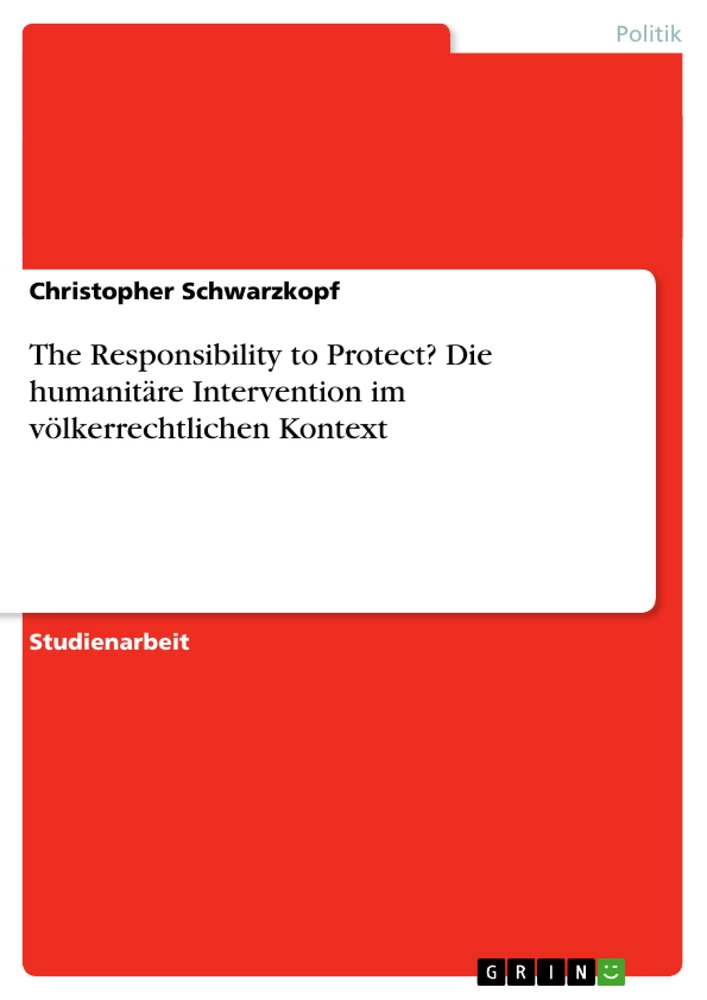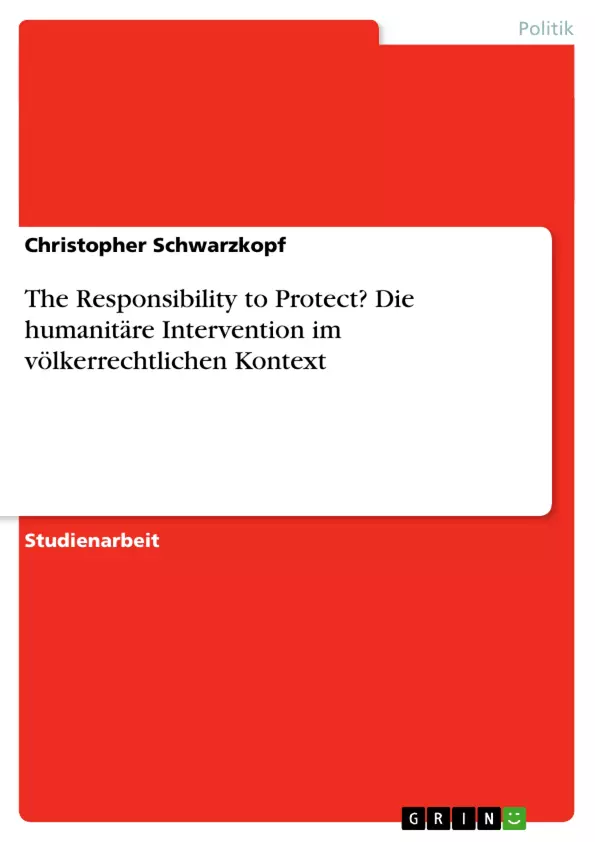Vor allem seit Ende des Kalten Krieges ist ein rapider Anstieg innerstaatlicher Konflikte zu verzeichnen1, die oft durch massive Menschenrechtsverletzungen wie Völkermord oder systematische Vertreibungen gekennzeichnet sind. Damit verbunden ist eine steigende Bereitschaft der Weltgemeinschaft, diesem Treiben nicht tatenlos zuzuschauen, sondern notfalls mit militärischer Gewalt in derartige Konflikte einzugreifen um weiteres Leid zu verhindern. Die Vereinten Nationen haben daher, obwohl dafür keine eindeutige Rechtsgrundlage existiert, im Laufe der neunziger Jahre mehrere derartige Interventionen, für die sich der Begriff der „Humanitären Intervention“ etabliert hat, durchgeführt. […] Die Intention dieser Arbeit ist es daher, zu klären, ob ein militärischer Eingriff zum Schutz der grundlegenden Menschenrechte vor dem Hintergrund der derzeitigen Völkerrechtslage als legal angesehen werden kann oder eben nicht. Dabei soll vor allem untersucht werden, ob und unter welchen Umständen auch vom Sicherheitsrat nicht autorisierte Interventionen wie im Fall Kosovo völkerrechtlich zulässig sein können. Für die Klärung dieser Frage ist es unumgänglich, zunächst eine allgemeingültige Begriffsdefinition vorzunehmen. Schließlich wird der Terminus der Humanitären Intervention häufig in verschiedensten Kontexten verwendet und es ist äußerst unklar, was genau damit gemeint ist. Im Anschluss sollen diejenigen völkerrechtlichen Grundlagen untersucht werden, die im Zusammenhang mit dem Konzept der Humanitären Intervention von zentraler Bedeutung sind, und die in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Dabei handelt es auf der einen Seite um die beiden Grundsätze des Gewalt- und des Interventionsverbotes und auf der anderen Seite um den völkerrechtlichen Status der Menschenrechte und ihres Schutzes. Den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet die Untersuchung der derzeitigen Völkerrechtslage in Bezug auf die Humanitäre Intervention. Hier sollen beide Arten der Intervention, mit und ohne Mandat, hinsichtlich ihrer völkerrechtlichen Zulässigkeit erforscht werden. Im letzten Teil sollen schließlich Kriterien aufgestellt werden, nach denen Humanitäre Interventionen, unabhängig davon, ob sie völkerrechtlich legal sein mögen oder nicht, zukünftig ablaufen müssen, um zumindest eine gewisse Legitimität zu erhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung „Humanitäre Intervention"
- Völkerrechtliche Grundlagen
- Das Gewalt- und Interventionsverbot
- Der Schutz der Menschenrechte im Völkerrecht
- Die Humanitäre Intervention im Völkerrecht
- Mit Mandat des UN-Sicherheitsrates
- Ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates
- Kriterien Humanitärer Interventionen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der völkerrechtlichen Zulässigkeit von militärischen Interventionen zum Schutz der Menschenrechte, insbesondere im Kontext der sogenannten „Humanitären Intervention". Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen und die aktuelle Debatte um die Rechtmäßigkeit solcher Interventionen zu analysieren, wobei ein besonderer Fokus auf Interventionen ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates liegt.
- Die Definition des Begriffs „Humanitäre Intervention" und seine Abgrenzung zu anderen Formen der Intervention
- Die völkerrechtlichen Grundlagen, insbesondere das Gewalt- und Interventionsverbot sowie der Schutz der Menschenrechte
- Die Rechtmäßigkeit von Interventionen mit und ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates
- Die Kriterien für die Legitimität von Humanitären Interventionen
- Die aktuelle Debatte um die Rechtmäßigkeit von Humanitären Interventionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Humanitären Intervention ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der zunehmenden innerstaatlichen Konflikte und Menschenrechtsverletzungen dar. Sie erläutert die Intention der Arbeit und skizziert den Aufbau der Untersuchung.
Das zweite Kapitel widmet sich der Begriffsbestimmung „Humanitäre Intervention". Es analysiert den Interventionsbegriff und dessen Entwicklung, insbesondere die Unterscheidung zwischen klassischer und erweiterter Intervention. Der Fokus liegt dabei auf der Definition der Intervention als militärischer Eingriff in das Hoheitsgebiet eines Staates ohne dessen Zustimmung.
Das dritte Kapitel behandelt die völkerrechtlichen Grundlagen der Humanitären Intervention. Es untersucht das Gewalt- und Interventionsverbot, das im Völkerrecht verankert ist, sowie den Schutz der Menschenrechte und dessen Bedeutung im Kontext der Intervention.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Humanitären Intervention im Völkerrecht. Es analysiert die Rechtmäßigkeit von Interventionen mit und ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates. Dabei werden die unterschiedlichen rechtlichen Argumente und die aktuelle Debatte um die Zulässigkeit von Interventionen ohne Mandat beleuchtet.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Frage, welche Kriterien für die Legitimität von Humanitären Interventionen gelten sollten. Es werden verschiedene Kriterien diskutiert, die eine gewisse Rechtfertigung für Interventionen gewährleisten sollen, auch wenn diese völkerrechtlich nicht eindeutig legal sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Humanitäre Intervention, das Völkerrecht, das Gewalt- und Interventionsverbot, der Schutz der Menschenrechte, das Mandat des UN-Sicherheitsrates, die Rechtmäßigkeit von Interventionen, die Legitimität von Interventionen, die Kriterien für Interventionen, die aktuelle Debatte um die Humanitäre Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer "Humanitären Intervention"?
Es handelt sich um einen militärischen Eingriff in das Hoheitsgebiet eines Staates ohne dessen Zustimmung, um massive Menschenrechtsverletzungen wie Völkermord zu stoppen.
Ist eine militärische Intervention ohne UN-Mandat völkerrechtlich legal?
Dies ist hochumstritten. Während das Gewaltverbot der UN-Charta dagegen spricht, argumentieren Befürworter mit dem vorrangigen Schutz der Menschenrechte.
Was bedeutet das Spannungsverhältnis zwischen Gewaltverbot und Menschenrechtsschutz?
Das Völkerrecht verbietet einerseits die Anwendung von Gewalt gegen Staaten, verpflichtet die Weltgemeinschaft andererseits aber zum Schutz grundlegender Menschenrechte.
Welche Rolle spielt der Fall Kosovo in dieser Debatte?
Die Kosovo-Intervention der NATO 1999 gilt als Präzedenzfall für eine Intervention ohne explizites Mandat des UN-Sicherheitsrates, die als "illegal, aber legitim" diskutiert wurde.
Was ist die "Responsibility to Protect" (R2P)?
Es ist ein Konzept, das besagt, dass die Weltgemeinschaft die Verantwortung hat einzugreifen, wenn ein Staat seine eigene Bevölkerung nicht vor schwersten Verbrechen schützen kann oder will.
- Citar trabajo
- Christopher Schwarzkopf (Autor), 2008, The Responsibility to Protect? Die humanitäre Intervention im völkerrechtlichen Kontext, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114275