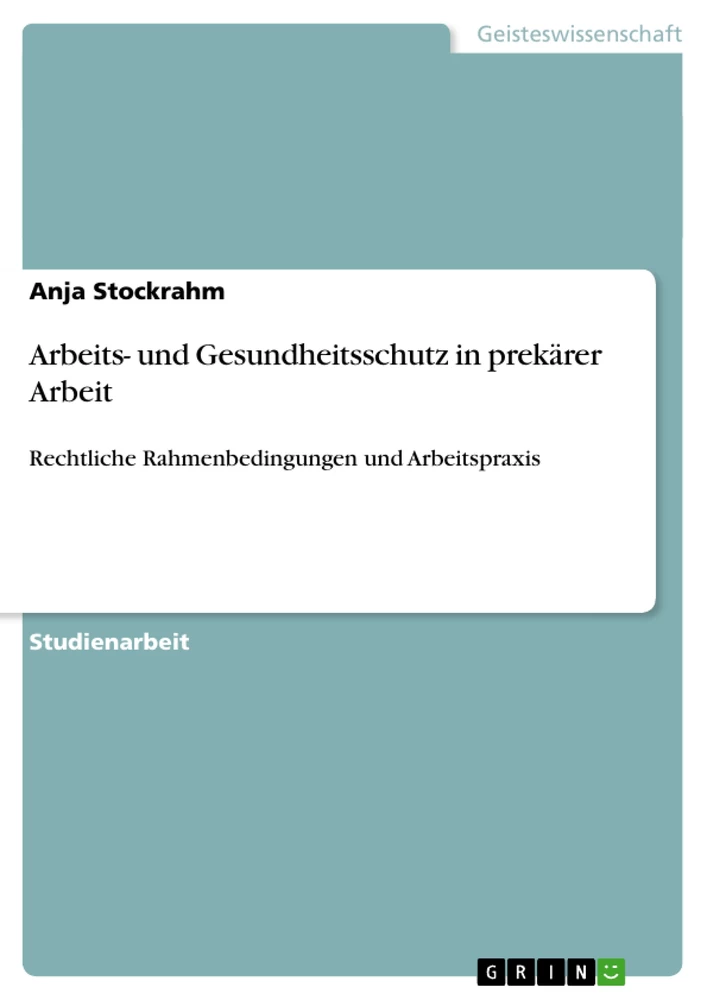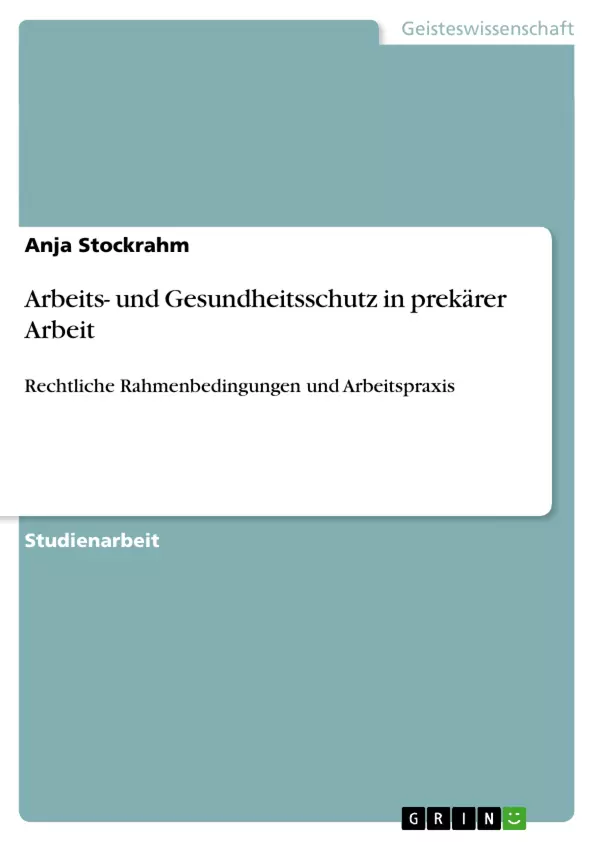Ein erster Ansatz, um sich definitorisch prekärer Arbeit bzw. prekären Beschäftigungsverhältnissen anzunähern, kann rein formal in einer negativen Abgrenzung zum klassischen Normalarbeitsverhältnis (NAV) vorgenommen werden. Die Referenzkategorie NAV ist sozialversicherungspflichtig, unbefristet und gewährleistet durch Arbeit in Vollzeit ein existenzsicherndes Einkommen.
Im Umkehrschluss ist demnach prekäre Arbeit in aller Regel dann anzunehmen,
wenn das Entgelt deutlich unter dem Durchschnittseinkommen liegt und nicht mehr
allein den Lebensunterhalt des Arbeitnehmers sichert, eine geringe Arbeitsplatzsicherheit besteht und somit keine zuverlässige Zukunftsplanung mehr für den Einzelnen möglich ist, Arbeitnehmerschutzrechte reduziert sind und reduzierte oder nicht vorhandene Sozialversicherungspflicht gegeben ist.
Ausgehend von dieser Negativ-Definition lassen sich nun Kernformen prekärer Arbeit, wie befristete, Teilzeit- und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sowie Leiharbeitsverhältnisse, identifizierten. Diese Formen prekärer Arbeit weisen die soeben aufgeführten Kriterien in einem sehr unterschiedlichen Ausmaß auf.
Der gerade gewählte Definitionsansatz ist jedoch nicht ganz so stringent einzuhalten, denn nicht jede vom NAV abweichende Arbeit ist auch prekär bzw. nicht jeder Arbeitnehmer in den soeben genannten Beschäftigungsformen befindet sich in eine prekären Lebenssituation.
Der Prekaritätsgrad eines Beschäftigungsverhältnisses korreliert sehr stark mit der Ausübungsdauer der Tätigkeit. Wird beispielsweise ein nur kurzzeitig ausgeübtes befristetes Beschäftigungsverhältnis entfristet oder dient Leiharbeit als Brücke aus der Arbeitslosigkeit in ein Normalarbeitsverhältnis, bleibt der Prekaritätsgrad marginal.
Auch spielt die Freiwilligkeit der Wahl einer bestimmten Beschäftigungsform eine
Rolle. Möglich ist, dass Beschäftigte aus familiären Gründen phasenweise eine Teilzeitbeschäftigung ausüben oder zur beruflichen Orientierung eine befristete Tätigkeit ausgeübt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Arten prekärer Arbeit bzw. Beschäftigungsformen
- Entwicklung prekärer Arbeit bzw. Beschäftigungsformen
- Geschlechtsspezifische Verteilung prekärer Arbeit
- Berufs-/Branchenspezifische Verteilung prekärer Arbeit
- Arbeits- und Umgebungsbelastung prekärer Beschäftigungsformen und deren Auswirkungen auf die gesundheitliche Konstitution
- Physische Arbeits- und Umgebungsbelastungen
- Psychische Arbeits-, Umgebungsbelastungen und Anforderungen
- Auswirkungen auf die gesundheitlichen Ressourcen prekär Beschäftigter
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- EU-Arbeitsschutzrichtlinien
- Arbeitschutzgesetz und duales Arbeitsschutzsystem in der BRD
- Weitere Gesetze zur Umsetzung in diesem Zusammenhang (z.B. Arbeitnehmer-überlassungsgesetz / AÜG)
- Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Praxis
- Umsetzung in der betrieblichen Praxis bei befristet Beschäftigten
- Umsetzung in der betrieblichen Praxis bei Teilzeit- u. geringfügig Beschäftigten
- Umsetzung in der betrieblichen Praxis bei Leiharbeitnehmern
- Lösungsansätze/-möglichkeiten zu einer besseren Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)
- Kampagnen und Initiativen im Bereich der Leiharbeit / Arbeitnehmerüberlassung
- Kampagnen der IG-Metall
- Initiativen der Arbeitsgeberverbände im Personaldienstleistungsbereich zur Erhöhung des fachlichen Standards des internen Personals
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz in prekärer Arbeit. Ziel ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Arbeitspraxis in diesem Bereich zu analysieren. Die Arbeit untersucht verschiedene Formen prekärer Beschäftigung, wie befristete, Teilzeit- und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sowie Leiharbeit, und beleuchtet deren Auswirkungen auf die gesundheitliche Konstitution der Beschäftigten. Darüber hinaus werden Lösungsansätze für eine bessere Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der Praxis diskutiert.
- Definition und Entwicklung prekärer Beschäftigungsformen
- Arbeits- und Umgebungsbelastungen in prekärer Arbeit
- Gesundheitliche Auswirkungen prekärer Beschäftigung
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung definiert den Begriff der prekären Arbeit und stellt verschiedene Formen dieser Beschäftigung vor. Sie beleuchtet die Entwicklung prekärer Arbeit und deren Verbreitung in Deutschland. Die Kapitel 2 und 3 befassen sich mit den Arbeits- und Umgebungsbelastungen prekärer Beschäftigungsformen und deren Auswirkungen auf die gesundheitliche Konstitution der Beschäftigten. Dabei werden sowohl physische als auch psychische Belastungen betrachtet. Kapitel 3 analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, insbesondere die EU-Arbeitsschutzrichtlinien und das deutsche Arbeitsschutzgesetz. Kapitel 4 untersucht die Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der betrieblichen Praxis, wobei die verschiedenen Formen prekärer Beschäftigung im Fokus stehen. Abschließend werden in Kapitel 5 Lösungsansätze für eine bessere Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der Praxis diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen prekäre Arbeit, Beschäftigungsformen, Arbeits- und Gesundheitsschutz, rechtliche Rahmenbedingungen, Arbeitspraxis, physische und psychische Belastungen, gesundheitliche Auswirkungen, EU-Arbeitsschutzrichtlinien, Arbeitsschutzgesetz, Leiharbeit, befristete Beschäftigung, Teilzeit- und geringfügige Beschäftigung, Lösungsansätze, gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert prekäre Arbeit?
Prekäre Arbeit liegt vor, wenn das Einkommen nicht existenzsichernd ist, geringe Arbeitsplatzsicherheit besteht, Sozialrechte reduziert sind oder keine verlässliche Zukunftsplanung möglich ist.
Welche Beschäftigungsformen gelten oft als prekär?
Dazu zählen insbesondere Befristungen, Leiharbeit (Arbeitnehmerüberlassung), Teilzeit- und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse.
Wie wirkt sich prekäre Arbeit auf die Gesundheit aus?
Sie führt oft zu erhöhten psychischen Belastungen durch Unsicherheit sowie physischen Belastungen durch ungünstige Arbeitsumgebungen, was die gesundheitlichen Ressourcen schwächt.
Welche Gesetze regeln den Arbeitsschutz in Deutschland?
Zentral sind das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die EU-Arbeitsschutzrichtlinien sowie spezifische Gesetze wie das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG).
Was ist die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)?
Die GDA ist eine Initiative von Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern zur Modernisierung des Arbeitsschutzes und zur Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz.
- Citar trabajo
- Dipl. Kauffrau Anja Stockrahm (Autor), 2008, Arbeits- und Gesundheitsschutz in prekärer Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114328