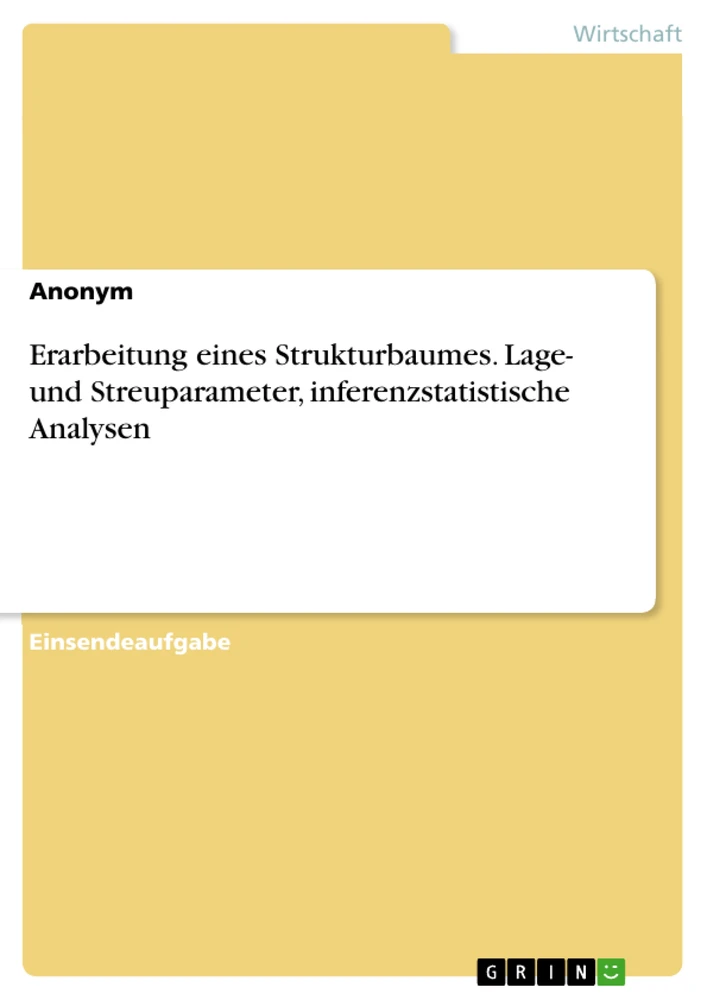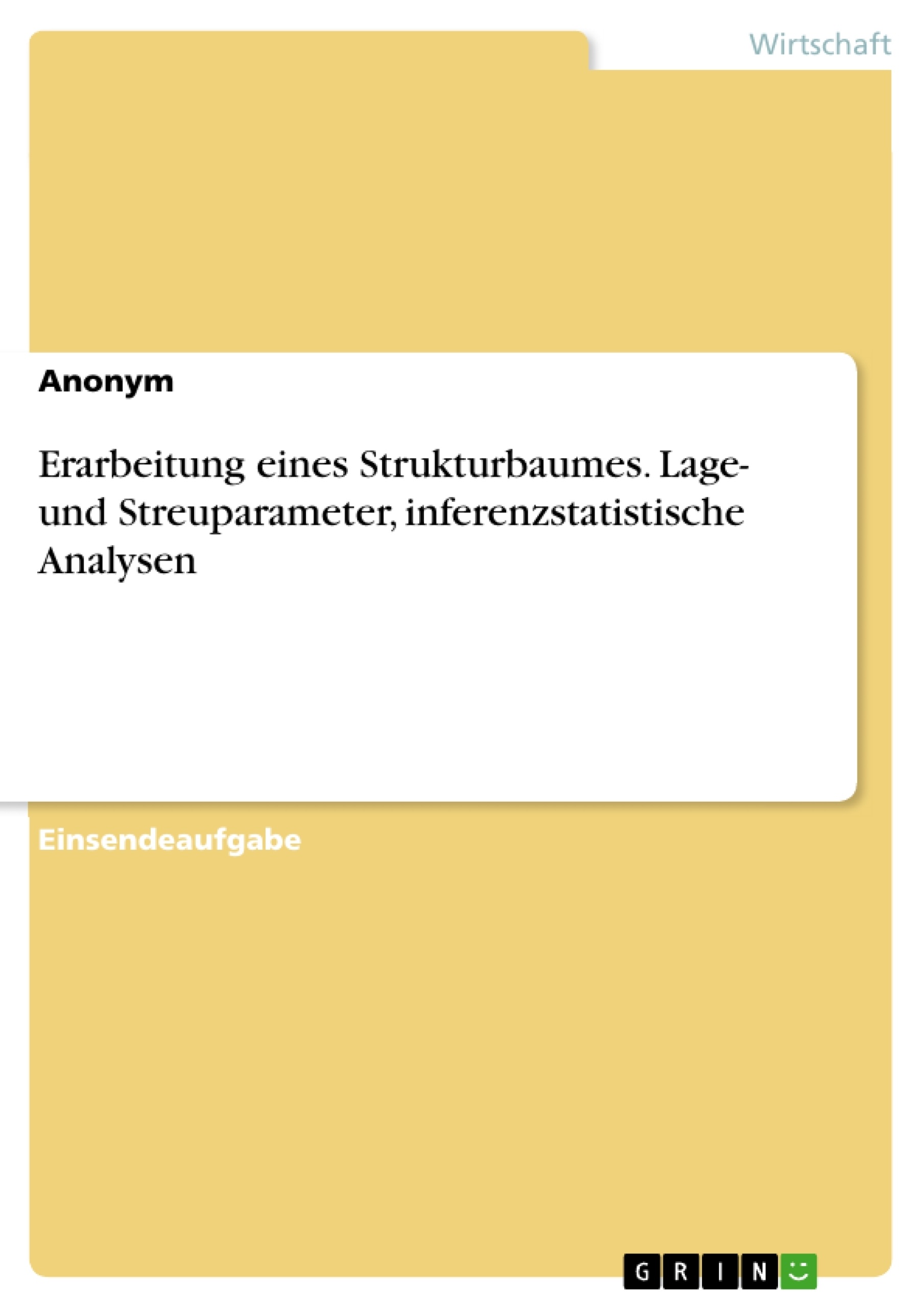Das erste Kapitel dieser Arbeit hat theoriebasiert die Erstellung eines Strukturbaumes zum Konstrukt „Stressbewältigung“ zum Ziel. Hierfür werden gängige Stressbewältigungsmodelle vorgestellt. Das Konstrukt soll im Rahmen eines Projektes zum Thema „Stress im Beamtenberuf“ beleuchtet werden. Der genaue Erhebungskontext wird im Kapitel 1.2 näher erläutert. Aufbauend auf dem Strukturbaum soll ein Fragebogen erstellt werden, deren Bestandteile das Kapitel 1.4 fasst.
Im zweiten Kapitel werden jeweils drei unterschiedliche Lage- und Streuparameter der deskriptiven Statistik erläutert und an einem selbsterstellten Beispiel mit 20 Studienteilnehmern, die im Rahmen einer Befragung ihr Alter angeben, veranschaulicht.
Im Rahmen der Dachevaluation der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) wurde von Infratest im Zeitraum vom Juni bis August 2015 eine telefonische repräsentative Beschäftigungsbefragung zum Thema physische und psychische Belastungen am Arbeitsplatz durchgeführt. Es wurden insgesamt N= 5.000 Personen befragt im Alter zwischen 15 und 80 Jahren (Sommer & Schmitt-Howe, 2018).
Der aus dieser Befragung stammente Datensatz ZA6759_Arbeitnehmer_v1-0-0.sav (Sommer & Schmitt-Howe, 2018), wird im letzten Kapitel der Arbeit mit Hilfe von inferenzstatistischen sowie deskriptiven Analysen ausgewertet. Die Auswertung erfolgt mit dem Statistikprogramm SPSS.
Inhaltsverzeichnis
- Erarbeitung eines Strukturbaumes
- Konstrukt Stressbewältigung
- Stressbewältigung nach Bandura
- Das ABC-Modell nach Ellis
- Stressbewältigung nach Lazarus
- Stressbewältigung auf transaktionaler Basis
- Erhebungskontext
- Strukturbaum
- Bestandteile des Fragebogens
- Deskriptive Statistiken
- Lageparameter
- Modus oder Modalwert
- Median
- Arithmetisches Mittel oder Mittelwert
- Streuparameter
- Spannweite
- Varianz und Standardabweichung
- Quartilsabstand und Boxplot
- Durchführung einer deskriptiven und inferenzstatistischen Analyse
- Deskriptive Analyse von Alter und Geschlechtsverteilung
- Darstellung der Verteilung von Führungskräften und Mitarbeitern ohne Personalverantwortung
- Deskriptive Analyse der Belastungen – Ergebnisse der Studie
- Belastung: Bewegungsarme Tätigkeit
- Belastung: Arbeitsumgebung
- Belastung: Schwere körperliche Belastungen
- Belastung: Umgang mit Maschinen und Arbeitsgeräte
- Belastung: Umgang mit Gefahr- oder Biostoffen
- Belastung: Umgang mit schwierigen Personengruppen
- Belastung: Zeitdruck oder organisatorisch bedingte Probleme
- Belastung: soziale Beziehungen
- Mittelwertberechnung der physischen Belastung (Variablen W15A212b bis W15A212e)
- Mittelwertberechnung der psychischen Belastung (Variablen W15A212f bis W15A212h)
- Untersuchung der Stärke der physischen und psychischen Belastung in Abhängigkeit der Personalverantwortung (Mitarbeiter mit vs. Mitarbeiter ohne Personalverantwortung)
- Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erarbeitung eines Strukturbaumes für die Untersuchung von Stressbewältigung und deren Einfluss auf die Belastung von Mitarbeitern. Die Arbeit analysiert die relevanten Konzepte und Theorien der Stressbewältigung und integriert diese in den Strukturbaum. Darüber hinaus werden die wichtigsten deskriptiven und inferenzstatistischen Verfahren zur Analyse der Daten erläutert und angewendet.
- Konzepte und Theorien der Stressbewältigung
- Entwicklung eines Strukturbaums für die Analyse von Stressbewältigung
- Deskriptive und inferenzstatistische Analyse der Daten
- Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Stressbewältigung, Belastung und Personalverantwortung
- Diskussion und Interpretation der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Erarbeitung eines Strukturbaumes, der als Grundlage für die Analyse von Stressbewältigung dient. Dafür werden verschiedene Konzepte und Theorien der Stressbewältigung, wie z. B. das Modell nach Bandura und das ABC-Modell nach Ellis, vorgestellt und in den Strukturbaum integriert. Im Anschluss wird der Erhebungskontext beschrieben und der Aufbau des Fragebogens erläutert.
Im zweiten Kapitel werden die deskriptiven Statistiken behandelt, wobei die Lage- und Streuparameter im Fokus stehen. Es werden die verschiedenen Parameter, wie z. B. Modus, Median und Mittelwert, sowie die Streuparameter Spannweite, Varianz und Standardabweichung vorgestellt und erläutert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Durchführung einer deskriptiven und inferenzstatistischen Analyse der erhobenen Daten. Es werden die Alters- und Geschlechtsverteilung der Stichprobe, die Verteilung von Führungskräften und Mitarbeitern ohne Personalverantwortung sowie die Belastung in verschiedenen Bereichen untersucht. Die Ergebnisse werden mithilfe von Tabellen und Grafiken visualisiert.
Schlüsselwörter
Stressbewältigung, Strukturbaum, Lageparameter, Streuparameter, deskriptive Statistik, inferenzstatistische Analyse, Belastung, Personalverantwortung, Mitarbeiter, Führungskräfte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Strukturbaum im Kontext der Stressbewältigung?
Ein Strukturbaum ist ein hierarchisches Modell, das komplexe Konstrukte wie „Stressbewältigung“ in messbare Unterkategorien und Variablen zerlegt, um darauf basierend Fragebögen oder Analysen zu erstellen.
Welche Stressbewältigungsmodelle werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit stellt unter anderem die Modelle nach Bandura (Selbstwirksamkeit), das ABC-Modell nach Ellis sowie den transaktionalen Ansatz nach Lazarus vor.
Was sind Lageparameter in der deskriptiven Statistik?
Lageparameter beschreiben das Zentrum einer Datenverteilung. Die wichtigsten sind der Modus (häufigster Wert), der Median (Zentralwert) und das arithmetische Mittel (Durchschnitt).
Was ist der Unterschied zwischen Varianz und Standardabweichung?
Beides sind Streuparameter. Die Varianz misst die durchschnittliche quadratische Abweichung vom Mittelwert, während die Standardabweichung die Wurzel daraus ist und die Streuung in der ursprünglichen Maßeinheit angibt.
Wie unterscheiden sich Belastungen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern?
Die Arbeit nutzt inferenzstatistische Analysen (mit SPSS), um zu untersuchen, wie sich physische und psychische Belastungen in Abhängigkeit von der Personalverantwortung unterscheiden.
Was ist ein Boxplot?
Ein Boxplot ist eine grafische Darstellung, die den Median, die Quartile und die Spannweite (einschließlich Ausreißer) einer Datenverteilung visualisiert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Erarbeitung eines Strukturbaumes. Lage- und Streuparameter, inferenzstatistische Analysen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1143575