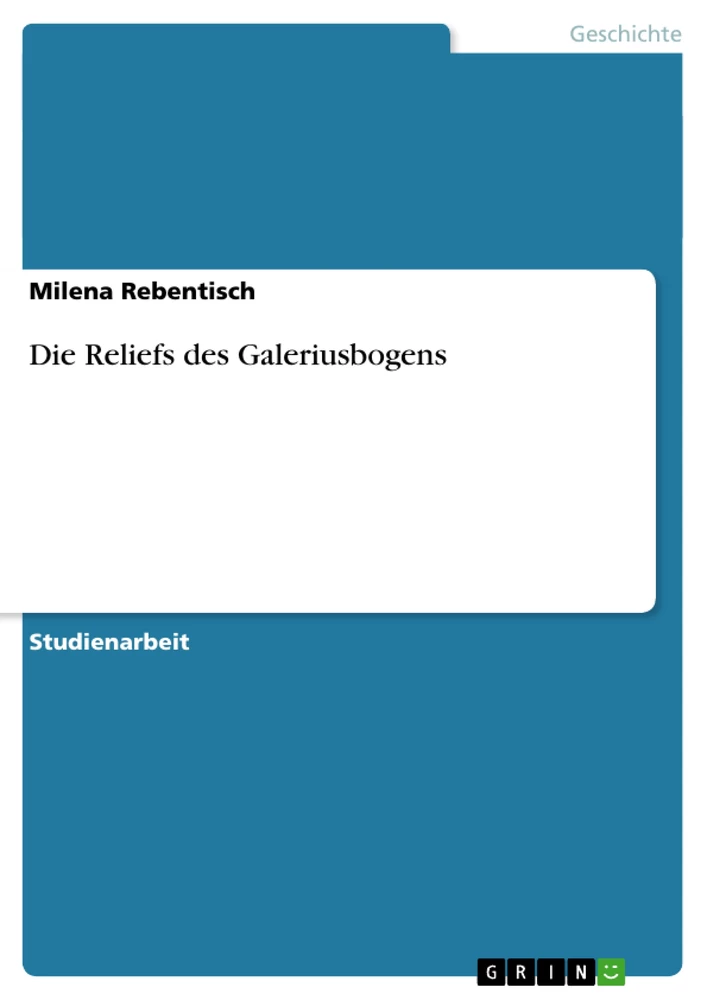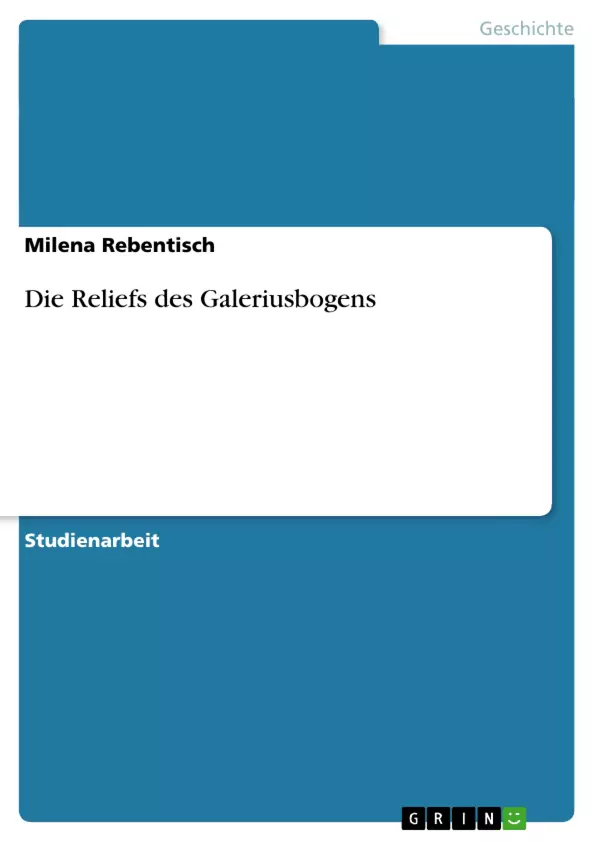In dieser Arbeit wird der so genannte Triumphbogen des Galerius in der antiken Stadt Thessaloniki behandelt. Auf die Baugeschichte und die Figurenfriese wird eingegangen. Der Reliefstil, die Pfeiler und der ornamentale Schmuck werden näher behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Aufbau des Bogens
- 2 Zur Baugeschichte des Galeriusbogens
- 3 Bildbeschreibung der Figurenfriese
- 3.1 Pfeiler A
- 3.2 Pfeiler B
- 4 Reliefstil
- 5 Der ornamentale Schmuck
- 6 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Reliefs des Galeriusbogens in Thessaloniki. Ziel ist es, den Aufbau des Bogens, seine Baugeschichte, die Ikonografie der Figurenfriese, den Reliefstil und den ornamentalen Schmuck zu beschreiben und zu analysieren. Die Arbeit konzentriert sich auf die Interpretation der dargestellten Szenen und deren Bedeutung im Kontext der römischen Kaiserzeit.
- Architektur und Baugeschichte des Galeriusbogens
- Ikonografische Analyse der Figurenfriese
- Stilistische Merkmale der Reliefs
- Ornamentale Gestaltung des Bogens
- Der Galeriusbogen im Kontext der römischen Triumphalkunst
Zusammenfassung der Kapitel
1 Aufbau des Bogens: Der Galeriusbogen in Thessaloniki, dessen ursprünglicher dreitoriger Aufbau nur noch teilweise erhalten ist, überspannte eine wichtige Straße. Die Anlage ruhte auf einer doppelten Pfeilerreihe, mit einem Tetrapylon in der Mitte. Der Mittelbogen weist eine Breite von 9,7 Metern auf. Trotz des erheblichen Verlustes an Substanz ist die verbleibende Ausschmückung als eines der prächtigsten Beispiele römischer Triumphalkunst zu bezeichnen. Die Friese, in vier übereinander angeordneten Reihen über einem profilierten Sockel, sind bemerkenswert durch ihre Anordnung und das Fehlen seitlicher Rahmungen. Die unmittelbare Anbringung des untersten Reliefstreifens über dem Sockel, ohne Orthostatenzone, ist ebenfalls auffällig.
2 Zur Baugeschichte des Galeriusbogens: Der Bogen wurde zum Gedenken an den Sieg des Caesars Galerius über die Sassaniden (297/298 n. Chr.) errichtet, um sowohl Galerius als auch die anderen Kaiser der Tetrarchie zu ehren. Die Bauzeit liegt zwischen 298 und 311 n. Chr., dem Todesjahr des Galerius. Der Bogen ähnelt anderen Triumphbögen durch seinen Bezug auf ein kaiserliches Regierungsjubiläum (z.B. Severusbogen). Die Zerstörungen des Bogens und seiner Reliefs sind ungeklärt, wobei Erdbeben und menschliches Einwirken als mögliche Ursachen in Betracht kommen. Die fehlende Dedikationsschrift lässt den Stifter ungeklärt, es wird jedoch aufgrund sprachlicher Hinweise auf Thessaloniki als Stifterin geschlossen. Architektonische Befunde deuten auf eine Planänderung während des Baus hin, die den Bogen in einen neu geschaffenen Kontext integrierte und darauf hindeutet, dass der Bogen der Palastanlage zeitlich vorausging.
3 Bildbeschreibung der Figurenfriese: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung der Figurenfriese auf den Pfeilern A und B, wobei die einzelnen Friese analysiert und ikonografisch gedeutet werden. Es werden verschiedene Kampfszenen, Triumphe, Gefangenenzüge und allegorische Darstellungen beschrieben, die den Sieg des Galerius über die Perser illustrieren. Die Beschreibungen beinhalten detaillierte Beobachtungen zu den einzelnen Figuren, ihrer Kleidung, ihrer Haltung und ihrer Bedeutung im Gesamtkontext des Frieses. Die Analyse verweist auf die historische Bedeutung der Ereignisse und ihre Darstellung in Bezug auf den römischen Kaiserkult.
Schlüsselwörter
Galeriusbogen, Thessaloniki, Triumphbogen, Römische Kaiserzeit, Tetrarchie, Sassaniden, Perserkrieg, Reliefs, Ikonografie, Triumphalkunst, Architektur, Baugeschichte, Militär, Sieg, Gefangenschaft, Allegorie.
Galeriusbogen in Thessaloniki: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Galeriusbogen in Thessaloniki, einen römischen Triumphbogen, umfassend. Sie untersucht dessen Architektur, Baugeschichte, die Ikonografie der Figurenfriese, den Reliefstil und den ornamentalen Schmuck. Der Fokus liegt auf der Interpretation der dargestellten Szenen und ihrer Bedeutung im Kontext der römischen Kaiserzeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Aufbau des Bogens, Baugeschichte des Galeriusbogens, Bildbeschreibung der Figurenfriese (inkl. Pfeiler A und B), Reliefstil, Ornamentaler Schmuck und Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Galeriusbogens.
Wann und warum wurde der Galeriusbogen errichtet?
Der Galeriusbogen wurde zwischen 298 und 311 n. Chr. errichtet, um den Sieg des Kaisers Galerius über die Sassaniden (297/298 n. Chr.) zu feiern und Galerius sowie die anderen Kaiser der Tetrarchie zu ehren. Er ähnelt anderen Triumphbögen, die kaiserliche Regierungsjubiläen markieren.
Wie ist der Aufbau des Galeriusbogens?
Der ursprünglich dreitorige Galeriusbogen überspannte eine wichtige Straße und ruhte auf einer doppelten Pfeilerreihe mit einem Tetrapylon in der Mitte. Der Mittelbogen hat eine Breite von 9,7 Metern. Die erhaltenen Friese, in vier übereinander angeordneten Reihen, sind bemerkenswert durch ihre Anordnung und das Fehlen seitlicher Rahmungen. Die unmittelbare Anbringung des untersten Reliefstreifens über dem Sockel, ohne Orthostatenzone, ist ebenfalls auffällig.
Welche Szenen zeigen die Figurenfriese?
Die Figurenfriese auf den Pfeilern A und B zeigen detailliert verschiedene Kampfszenen, Triumphe, Gefangenenzüge und allegorische Darstellungen, die den Sieg des Galerius über die Perser illustrieren. Die Beschreibungen umfassen detaillierte Beobachtungen zu den einzelnen Figuren, ihrer Kleidung, ihrer Haltung und ihrer Bedeutung im Gesamtkontext des Frieses.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Galeriusbogen, Thessaloniki, Triumphbogen, Römische Kaiserzeit, Tetrarchie, Sassaniden, Perserkrieg, Reliefs, Ikonografie, Triumphalkunst, Architektur, Baugeschichte, Militär, Sieg, Gefangenschaft, Allegorie.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Aufbau, die Baugeschichte, die Ikonografie der Figurenfriese, den Reliefstil und den ornamentalen Schmuck des Galeriusbogens zu beschreiben und zu analysieren. Ein Schwerpunkt liegt auf der Interpretation der dargestellten Szenen und deren Bedeutung im Kontext der römischen Kaiserzeit.
Wie sind die Zerstörungen des Bogens zu erklären?
Die Zerstörungen des Bogens und seiner Reliefs sind ungeklärt. Erdbeben und menschliches Einwirken werden als mögliche Ursachen in Betracht gezogen. Die fehlende Dedikationsschrift lässt den Stifter ungeklärt, es wird jedoch aufgrund sprachlicher Hinweise auf Thessaloniki als Stifterin geschlossen.
Gibt es Hinweise auf Planänderungen während des Baus?
Architektonische Befunde deuten auf eine Planänderung während des Baus hin, die den Bogen in einen neu geschaffenen Kontext integrierte und darauf hindeutet, dass der Bogen der Palastanlage zeitlich vorausging.
- Arbeit zitieren
- Milena Rebentisch (Autor:in), 2006, Die Reliefs des Galeriusbogens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114370