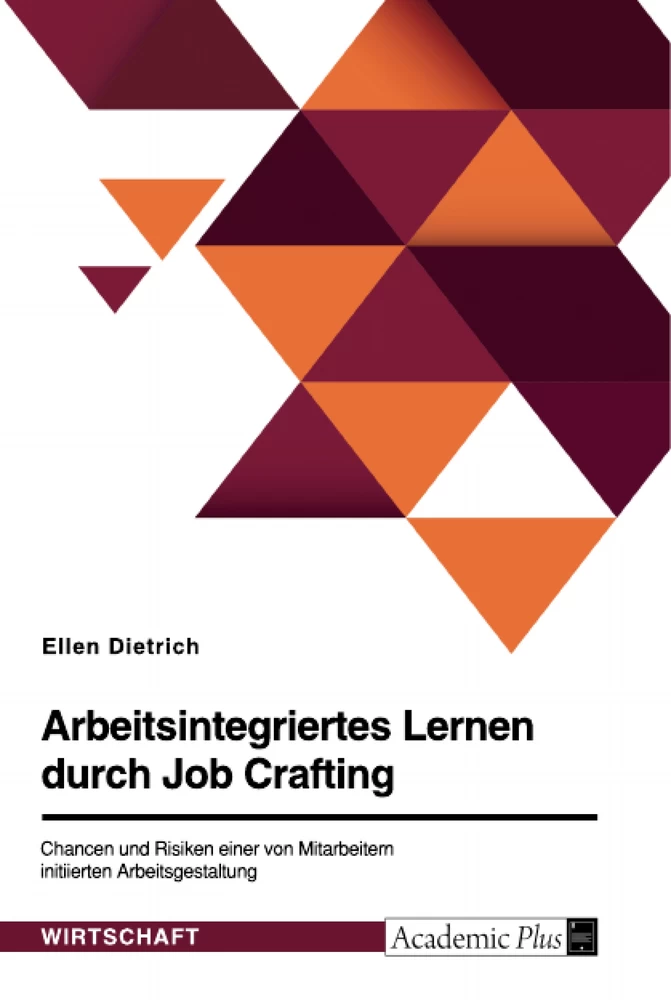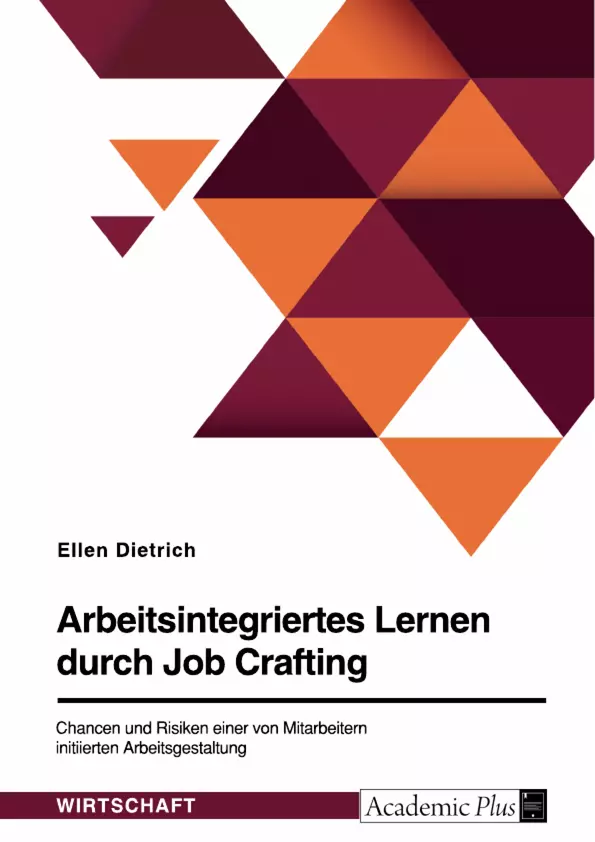Die Bachelorarbeit untersucht Chancen und Risiken, die mit Job Crafting als Form des arbeitsintegrierten Lernens verbunden sind. Damit greift sie ein aktuelles Thema auf, denn Unternehmen werden immer wieder vor die Frage gestellt, wie Beschäftigte mit den veränderten Anforderungen in einer schnelllebigen Arbeitswelt beständig Schritt halten und sich das erforderliche Wissen und notwendige Kompetenzen aneignen können.
Im Mittelpunkt betrieblicher Maßnahmen zur Förderung des arbeitsintegrierten Lernens steht die Gestaltung lernförderlicher Arbeitsumgebungen. Bislang kaum beachtet wurde allerdings, inwieweit sich die Gestaltung der Arbeit durch die Beschäftigten selbst als lernförderlich erweist. Diese offene Frage bzw. der ungeklärte Zusammenhang zwischen mitarbeiterinitiierter Arbeitsgestaltung und arbeitsintegriertem Lernen wird in dieser Arbeit aufgegriffen und erörtert. Am Beispiel von Job Crafting, das die US-amerikanischen Arbeitspsychologinnen Amy Wrzesniewski und Jane E. Dutton als mitarbeiterinitiierte Form der Arbeitsgestaltung beschreiben, wird dessen Lernpotenzial theoriegeleitet genauer untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Job Crafting
- 2.1 Job Crafting als Forschungsgegenstand der Betriebspädagogik
- 2.2 Job Crafting als mitarbeiterinitiierte Arbeitsgestaltung
- 2.3 Das implizite Lernpotenzial von Job Crafting
- 2.3.1 Job Crafting - Definition
- 2.3.2 Job Crafting - Erscheinungsformen
- 2.3.3 Job Crafting - Motive
- 2.3.4 Job Crafting - Effekte
- 2.3.5 Zusammenfassung
- 3 Arbeitsintegriertes Lernen im Kontext von Job Crafting
- 3.1 Begriffsbestimmung
- 3.1.1 Arbeitsintegriertes Lernen ohne betriebspädagogische Rahmung
- 3.1.2 Arbeitsintegriertes Lernen als informelles Lernen
- 3.2 Zielgrößen
- 3.2.1 Berufliche Handlungskompetenz
- 3.2.2 Reflexive Handlungsfähigkeit
- 3.3 Zwischenfazit
- 3.1 Begriffsbestimmung
- 4 Die pragmatistische Lerntheorie John Deweys
- 4.1 Die erkenntnistheoretische Position des Pragmatismus
- 4.2 „Experience“ als Grundbegriff des erfahrungsbasierten Lernens
- 4.3 Die Bedeutung der Reflexion im Lernprozess
- 4.4 Die Funktion von Interesse im Lernprozess
- 5 Das Lernpotenzial von Job Crafting aus pragmatistischer Perspektive
- 5.1 Chancen
- 5.2 Risiken
- 5.3 Fazit
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
- 7 Verzeichnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Lernpotenzial von Job Crafting als Form des arbeitsintegrierten Lernens. Die Arbeit zielt darauf ab, die Chancen und Risiken von Job Crafting im Hinblick auf die Kompetenzentwicklung von Beschäftigten zu analysieren und die Vereinbarkeit mit dem Konzept des arbeitsintegrierten Lernens aufzuzeigen. Hierbei wird die pragmatistische Lerntheorie John Deweys als theoretische Grundlage verwendet.
- Job Crafting als mitarbeiterinitiierte Arbeitsgestaltung
- Arbeitsintegriertes Lernen und seine Bedeutung in der modernen Arbeitswelt
- John Deweys pragmatistische Lerntheorie und deren Relevanz für arbeitsintegriertes Lernen
- Chancen und Risiken von Job Crafting als Lernmethode
- Analyse der Vereinbarkeit von Job Crafting und arbeitsintegriertem Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, den rasanten technologischen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen für die Kompetenzentwicklung von Beschäftigten. Sie problematisiert die Grenzen seminaristischer Weiterbildung und betont die Notwendigkeit arbeitsintegrierten Lernens als kontinuierliche Wissenserneuerung. Der zunehmende Fokus auf selbstgesteuertes Lernen („Self Service“) und der Perspektivenwechsel von lehrstoffzentrierter Wissensvermittlung zu subjektorientierter Wissensaneignung werden hervorgehoben. Die Arbeit fokussiert auf die noch unerforschte Frage des Lernpotenzials mitarbeiterinitiierter Arbeitsgestaltung, am Beispiel von Job Crafting, und wählt Deweys pragmatistische Lerntheorie als theoretischen Rahmen.
2 Job Crafting: Dieses Kapitel definiert Job Crafting als mitarbeiterinitiierte Arbeitsgestaltung und untersucht es als Forschungsgegenstand der Betriebspädagogik. Es beleuchtet verschiedene Erscheinungsformen, Motive und Effekte von Job Crafting, analysiert das implizite Lernpotenzial und fasst die zentralen Aspekte zusammen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Job Crafting als aktivem Gestaltungsprozess der eigenen Arbeit durch den Mitarbeiter.
3 Arbeitsintegriertes Lernen im Kontext von Job Crafting: Das Kapitel beschreibt Arbeitsintegriertes Lernen (AiL) und seine verschiedenen Ausprägungen, inklusive informellen Lernens und AiL ohne betriebspädagogische Rahmung. Es definiert zentrale Zielgrößen wie berufliche Handlungskompetenz und reflexive Handlungsfähigkeit im Kontext von AiL. Der Abschnitt verbindet die Konzepte von AiL und Job Crafting, analysiert deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede, und legt die Grundlage für die spätere Betrachtung des Lernpotenzials von Job Crafting.
4 Die pragmatistische Lerntheorie John Deweys: Dieses Kapitel präsentiert die erkenntnistheoretische Position des Pragmatismus und erklärt Deweys Verständnis von „Experience“ als grundlegenden Begriff des erfahrungsbasierten Lernens. Es betont die Bedeutung von Reflexion und Interesse im Lernprozess und legt die theoretische Basis für die spätere Bewertung des Lernpotenzials von Job Crafting. Die Kapitel erläutert Deweys Fokus auf das aktive, handelnde Individuum und dessen Rolle im Lernprozess.
5 Das Lernpotenzial von Job Crafting aus pragmatistischer Perspektive: Aufbauend auf den vorherigen Kapiteln, analysiert dieses Kapitel das Lernpotenzial von Job Crafting unter Einbezug von Deweys pragmatistischer Lerntheorie. Es untersucht sowohl die Chancen als auch die Risiken von Job Crafting als Form des arbeitsintegrierten Lernens. Die Analyse stützt sich auf die vorherigen Definitionen und die Beschreibung der pragmatistischen Lerntheorie.
Schlüsselwörter
Job Crafting, Arbeitsintegriertes Lernen, Pragmatismus, John Dewey, Kompetenzentwicklung, Mitarbeiterinitiierte Arbeitsgestaltung, Reflexion, Handlungskompetenz, informelles Lernen, Lernpotenzial, Chancen, Risiken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Das Lernpotenzial von Job Crafting
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht das Lernpotenzial von Job Crafting als Form des arbeitsintegrierten Lernens. Sie analysiert die Chancen und Risiken von Job Crafting für die Kompetenzentwicklung von Beschäftigten und prüft die Vereinbarkeit mit dem Konzept des arbeitsintegrierten Lernens. Die pragmatistische Lerntheorie John Deweys dient als theoretische Grundlage.
Was ist Job Crafting?
Die Arbeit definiert Job Crafting als mitarbeiterinitiierte Arbeitsgestaltung. Es werden verschiedene Erscheinungsformen, Motive und Effekte von Job Crafting beleuchtet, mit Fokus auf das implizite Lernpotenzial und Job Crafting als aktiven Gestaltungsprozess der eigenen Arbeit durch den Mitarbeiter.
Was ist arbeitsintegriertes Lernen (AiL) und wie wird es in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit beschreibt AiL und seine verschiedenen Ausprägungen, inklusive informellen Lernens und AiL ohne betriebspädagogische Rahmung. Zentrale Zielgrößen wie berufliche Handlungskompetenz und reflexive Handlungsfähigkeit im Kontext von AiL werden definiert. Die Arbeit analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen AiL und Job Crafting.
Welche Rolle spielt die pragmatistische Lerntheorie John Deweys?
Die Arbeit nutzt Deweys pragmatistische Lerntheorie als theoretischen Rahmen. Sie erklärt Deweys Verständnis von „Experience“, die Bedeutung von Reflexion und Interesse im Lernprozess und legt damit die Grundlage für die Bewertung des Lernpotenzials von Job Crafting. Der Fokus liegt auf dem aktiven, handelnden Individuum im Lernprozess.
Welche Chancen und Risiken von Job Crafting als Lernmethode werden untersucht?
Die Arbeit analysiert Chancen und Risiken von Job Crafting als Form des arbeitsintegrierten Lernens unter Einbezug von Deweys pragmatistischer Lerntheorie. Die Analyse stützt sich auf die vorherigen Definitionen und die Beschreibung der pragmatistischen Lerntheorie.
Welche Schlüsselthemen werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselthemen sind Job Crafting, Arbeitsintegriertes Lernen, Pragmatismus, John Dewey, Kompetenzentwicklung, Mitarbeiterinitiierte Arbeitsgestaltung, Reflexion, Handlungskompetenz, informelles Lernen, Lernpotenzial, Chancen und Risiken.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Job Crafting, arbeitsintegriertem Lernen, Deweys pragmatischer Lerntheorie, einer Analyse des Lernpotenzials von Job Crafting aus pragmatistischer Perspektive, einer Zusammenfassung und einem Ausblick sowie Verzeichnissen. Die Kapitel enthalten jeweils Detailinformationen und Zwischenzusammenfassungen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Vereinbarkeit von Job Crafting und arbeitsintegriertem Lernen und bewertet das Lernpotenzial von Job Crafting im Kontext der pragmatistischen Lerntheorie. Konkrete Ergebnisse und Schlussfolgerungen sind im Kapitel "Zusammenfassung und Ausblick" detailliert beschrieben.
- Citar trabajo
- Ellen Dietrich (Autor), 2021, Arbeitsintegriertes Lernen durch Job Crafting. Chancen und Risiken einer von Mitarbeitern initiierten Arbeitsgestaltung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1143930