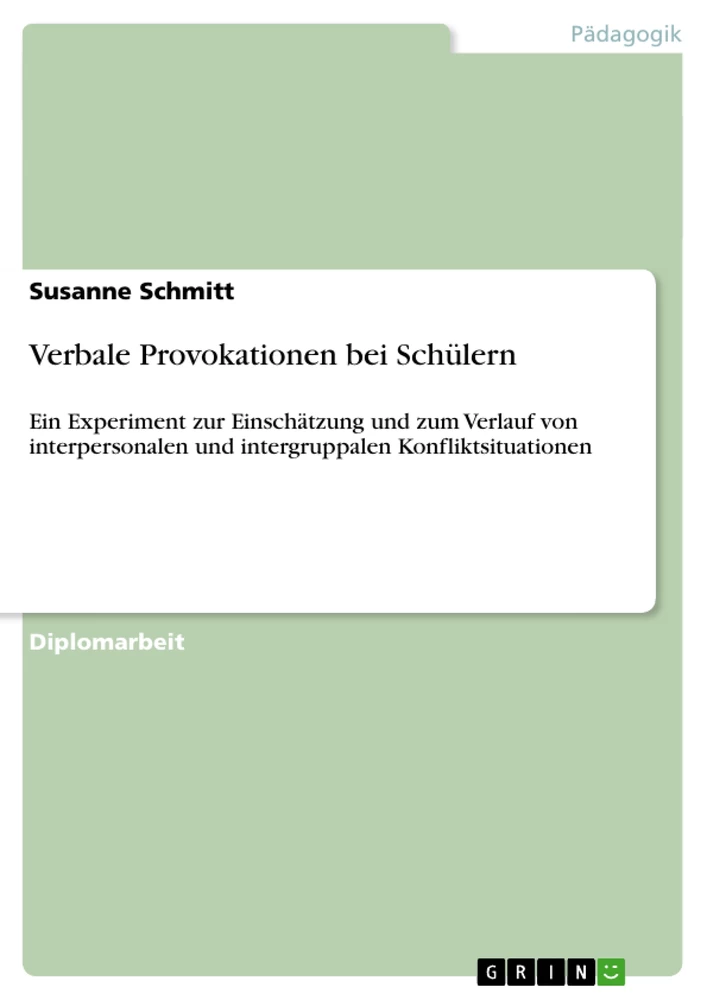Vor einiger Zeit gab es im deutschen Fernsehen einen Sketch. Zwei Komiker
unterhielten sich über einen besonders einfältigen Mann. Es drehte sich einige
Zeit um dessen Dummheiten und Fehler, bis die Zwei zu dem Schluss kamen:
“Das kann ja nur ein Österreicher sein!“
Ich hätte mich bis zu diesem Zeitpunkt nicht als besonders patriotisch bezeichnet, noch habe ich mir je große Gedanken über meine Staatszugehörigkeit gemacht. Aber in diesem Moment fühlte ich mich plötzlich als Österreicherin angegriffen. Ich war wütend, habe diese Geschichte viele Male erzählt und mich darüber beklagt, dass wir ÖsterreicherInnen im Fernsehen als Idioten dargestellt werden. Ich fühlte mich als Mitglied dieser Nation beleidigt und war bereit mich zu wehren. Vielen anderen Menschen in diesem Land geht es genauso und schlimmer, wenn sie zum Beispiel als Ausländer beschimpft und benachteiligt werden. Aufgrund der anderen Muttersprache gehören sie einer anderen Gruppe an und werden ausgestoßen. Besonders in Schulen, wo viele verschiedene Ethnizitäten zusammentreffen und auf engem Raum miteinander arbeiten müssen, können dadurch Konflikte entstehen. Genau da setzt auch das Hauptbestreben dieser Arbeit an, nämlich herauszufinden, wie aggressiv Schüler verbale Angriffe auf ihre Gruppenzugehörigkeit empfinden, bzw. ob es Unterschiede in den Einschätzungen gibt, wenn sie als Person beleidigt werden.
Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in einen Literaturteil (Kapitel 2) und einen empirischen Teil (Kapitel 3). Im Literaturteil soll zuerst geklärt werden was man unter aggressiven Handlungen versteht und wie es dazu kommen kann.
Anschließend wird das intergruppale Verhalten näher beleuchtet. In diesem Teil der Arbeit soll geklärt werden, wie es zu Gruppenbildungen kommt und warum die
eigene Gruppe wichtig wird. Das darauf folgende Subkapitel beschäftigt sich dann
eingehend mit den Gruppenkonflikten.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- LITERATURÜBERBLICK
- Aggression
- Definition von aggressivem Verhalten
- Sozial-interaktive Modelle aggressiven Verhaltens
- Aggression in der Schule
- Intergruppales Verhalten
- Der Gegensatz zwischen interpersonalem Verhalten und Gruppenverhalten
- Soziale Kategorisierung als grundlegender psychischer Prozess
- Erklärungsmodelle für Gruppenverhalten
- Intergruppaler Konflikt
- Interdependenzbeziehungen zwischen Gruppen
- Soziale Identität als Konflikttheorie
- Konflikte bei SchülerInnen
- Interetnische Konflikte bei SchülerInnen
- Aggression
- EMPIRISCHER TEIL
- Zielsetzungen
- Methodische Ziele
- Inhaltliche Ziele
- Methode
- Untersuchungsplan
- Erhebungsinstrumente
- Untersuchungsdurchführung
- Durchführung / Voruntersuchung
- Durchführung / Hauptuntersuchung
- Auswertungsschritte
- Voruntersuchung
- Stichprobe
- Ergebnisse
- Hauptuntersuchung
- Stichprobe
- Deskriptive Ergebnisse
- Methodische Ergebnisse
- Inhaltliche Ergebnisse
- Zielsetzungen
- DISKUSSION
- ZUSAMMENFASSUNG
- LITERATURVERZEICHNIS
- ANHANG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema verbaler Provokationen bei Schülern und untersucht, wie aggressiv Schüler verbale Angriffe auf ihre Gruppenzugehörigkeit empfinden. Die Arbeit zielt darauf ab, die Einschätzung und den Verlauf von interpersonalen und intergruppalen Konfliktsituationen zu analysieren. Dabei werden verschiedene Faktoren wie die Situation, die Muttersprache und das Geschlecht der Schüler berücksichtigt.
- Aggression und ihre Definition
- Intergruppales Verhalten und soziale Kategorisierung
- Intergruppaler Konflikt und soziale Identität
- Konflikte bei Schülern, insbesondere interetnische Konflikte
- Der Einfluss von Situation, Muttersprache und Geschlecht auf die Einschätzung von Aggression und die antizipierte Reaktion der Opfer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Relevanz des Themas verbaler Provokationen bei Schülern beleuchtet. Im Anschluss daran wird im Literaturteil ein umfassender Überblick über die relevanten Theorien und Forschungsbefunde zu Aggression, intergruppalem Verhalten und intergruppalen Konflikten gegeben. Dabei werden verschiedene Modelle und Konzepte vorgestellt, die das Verständnis von aggressiven Handlungen und Gruppenkonflikten fördern.
Der empirische Teil der Arbeit beschreibt die Methodik und die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, die sich mit der Einschätzung und dem Verlauf von Konfliktsituationen bei Schülern beschäftigt. Die Untersuchung wurde mit Hilfe von Vignetten durchgeführt, die verschiedene Szenarien von verbalen Provokationen darstellen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Detail analysiert und diskutiert.
Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und einer Diskussion der Ergebnisse im Kontext der bestehenden Literatur.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen verbale Provokationen, Aggression, Intergruppenverhalten, Intergruppenkonflikt, soziale Kategorisierung, soziale Identität, Konflikte bei Schülern, interetnische Konflikte, Einschätzung von Aggression, antizipierte Reaktion, Situation, Muttersprache, Geschlecht.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagieren Schüler auf verbale Provokationen?
Die Reaktion hängt stark davon ab, ob eine Beleidigung interpersonal (persönlich) oder intergruppal (gegen die Gruppenzugehörigkeit, z. B. Nationalität) gerichtet ist. Angriffe auf die Gruppe werden oft als besonders aggressiv empfunden.
Was ist soziale Kategorisierung im Schulkontext?
Es ist der psychische Prozess, Menschen in Gruppen einzuteilen (z. B. „In-Group“ vs. „Out-Group“). In Schulen mit hoher ethnischer Vielfalt kann dies zu Abgrenzung und Konflikten führen.
Welche Rolle spielt die soziale Identität bei Konflikten?
Die soziale Identitätstheorie besagt, dass Menschen Selbstwertgefühl aus ihrer Gruppe ziehen. Wird die Gruppe abgewertet, fühlen sich Individuen persönlich angegriffen und sind eher bereit, sich aggressiv zu wehren.
Gibt es Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen bei Provokationen?
Die empirische Untersuchung der Arbeit analysiert geschlechtsspezifische Unterschiede in der Einschätzung von Aggression und der antizipierten Reaktion der Opfer auf verbale Angriffe.
Wie wurden die Daten in der Studie erhoben?
Die Untersuchung nutzte Vignetten (kurze Fallbeispiele), um verschiedene Szenarien von Provokationen darzustellen und die Bewertungen der Schüler systematisch abzufragen.
- Citation du texte
- Mag. Susanne Schmitt (Auteur), 2006, Verbale Provokationen bei Schülern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114410