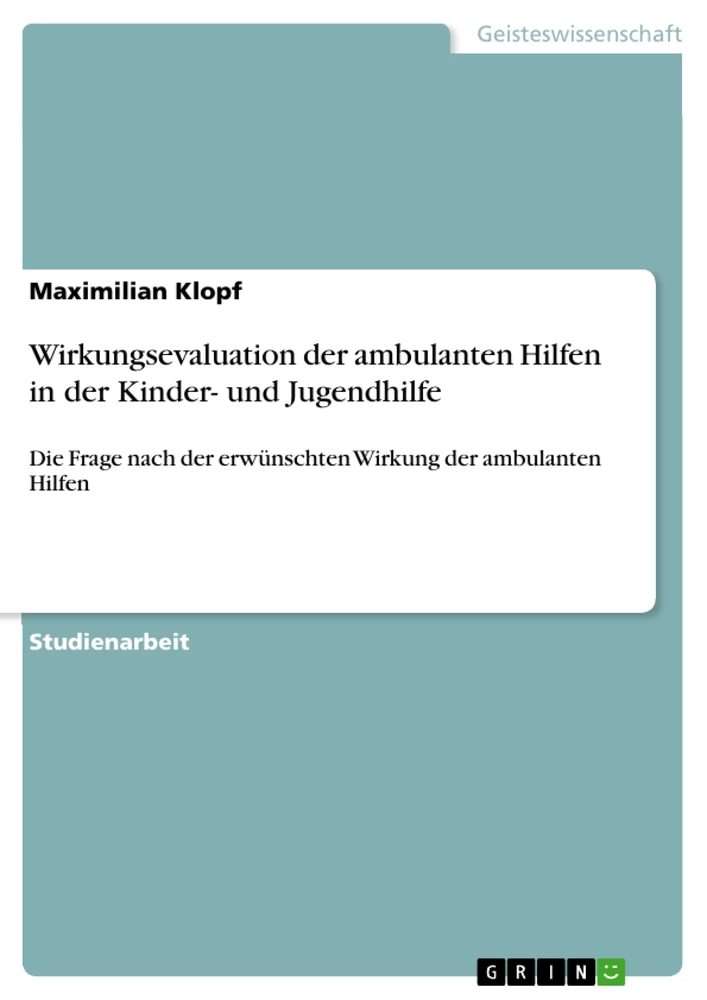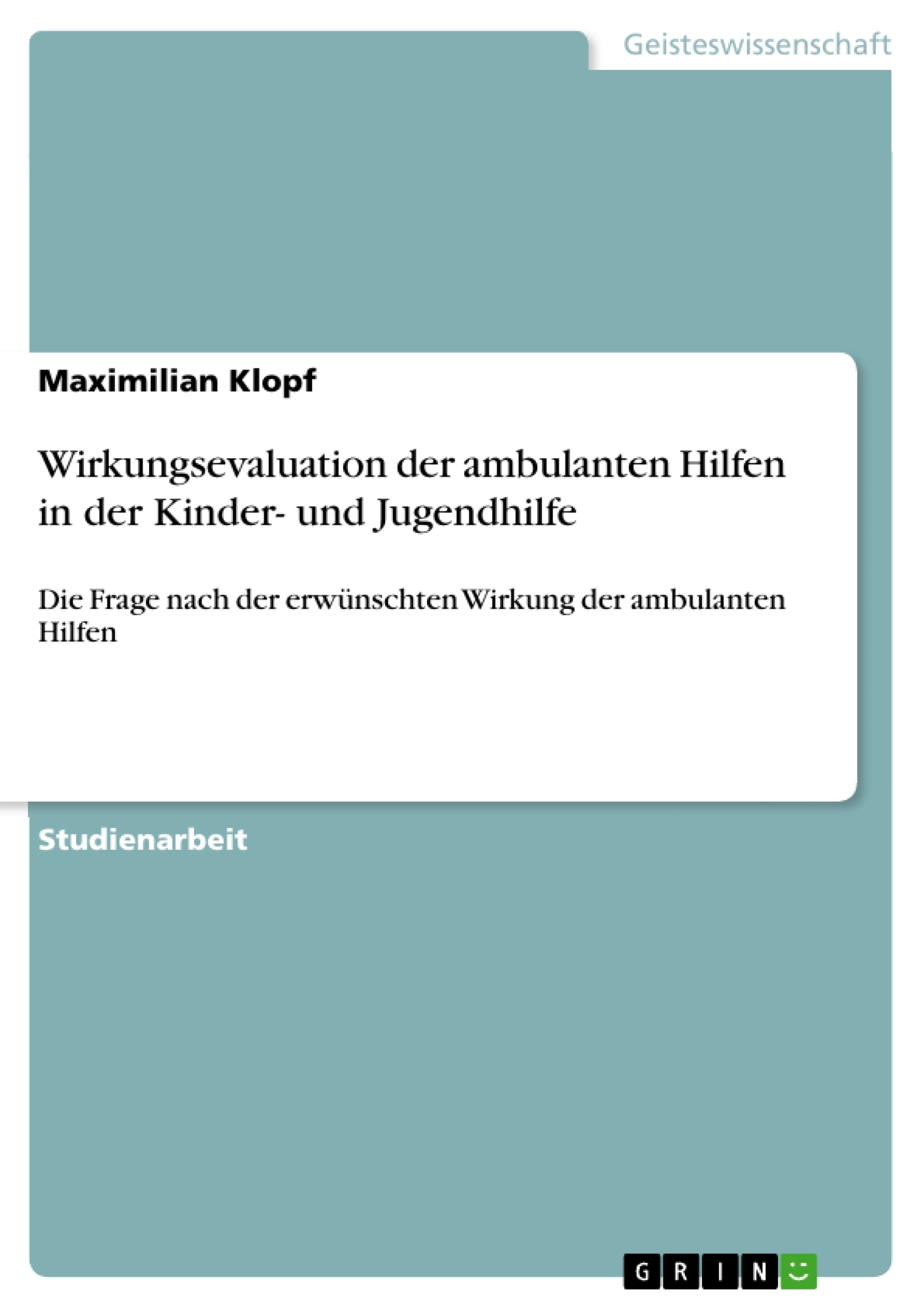In dieser Hausarbeit wird nach einer Definition und Beschreibung der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Wirkungs- und Wirkungsorientierung grundlegendes zum Thema der Wirkung in der Kinder- und Jugendhilfe beschrieben.
Daran anschließend werden verschiedene Wirkungsbeschreibungen vorgestellt bzw. abgeleitet. Abschließend werden durch den Autor Grundlagen hinsichtlich einer Wirkungsanalyse ambulanter Jugendhilfe dargestellt und ein Fazit gezogen.
Das Thema der Wirkung und deren Evaluation ist in den Bereichen der freien Wirtschaft schon lange angekommen und gang und gäbe. Ganz anders sieht es hier noch im Bereich der Jugendhilfe in Bayern aus. Die im SGB VIII vorgegebenen Leistungen werden zwar mit Hilfe von Hilfeplänen gesteuert, eine Auswertung bzw. Evaluation der Wirkung der Hilfe findet jedoch nicht statt. Auch lässt sich die Erreichung der im Hilfeplan vorgegebenen Ziele häufig kaum überprüfen.
Die Jugendämter geraten hier, wie in der gesamten Bundesrepublik, jedoch in einen immer größer werdenden Kosten- und Rechtfertigungsdruck. Dieser kommt nicht nur ausschließlich von der politischen Ebene. Auch von Seiten der Kooperations- und Netzwerkpartner, der Klienten sowie der Fachkräfte wird immer häufiger hinterfragt, wie gut die Angebote der Jugendhilfe wirken und was diese tatsächlich leisten können. Nicht zuletzt wird diese Frage auch durch die Presse und die Öffentlichkeit gestellt, wenn es zu einem Unglücksfall kam, bei dem beispielsweise ein Kind getötet wurde, obwohl die Jugendhilfe hier bereits involviert war. Neben all diesen Faktoren ist die Frage inwiefern die Leistungen der Jugendhilfe wirken, auch für die Jugendämter selbst interessant. So gilt es das gegebene Budget so zielführend wie möglich für die Klienten einzusetzen. Denn die Jugendämter, die auch der Kostenträger der Leistungen sind, möchten keine kostspieligen Unterstützungsleistungen finanzieren, die letztendlich keine oder nur minimale Wirkung haben.
Von den benannten Leistungen der Jugendhilfe kommen mit am häufigsten die sogenannten ambulanten Erziehungshilfen zum Einsatz. Hier ist seit etlichen Jahren festzustellen, dass die Fallzahlen kontinuierlich steigen und die Problemlagen in den Familien komplexer werden. Gerade im Hinblick auf diese Entwicklung werde ich mich nicht zuletzt auch aus Übersichtlichkeitsgründen in dieser Hausarbeit mit dem Themenfeld der ambulanten Hilfen beschäftigen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Kinder- und Jugendhilfe
- 3. Wirkung und Wirkungsorientierung
- 4. Wirkung und deren Evaluation / Analyse im Blickpunkt der § 79a SGB VIII.
- 5. Modellprojekt
- 6. Wirkung der ambulanten Hilfen.
- 6.1 Wirkungsbeschreibungen ambulanter Hilfen im gesetzlichen Kontext
- 6.2 Wirkungsbeschreibungen ambulanter Hilfen in der Fachliteratur
- 6.3 Wirkungsbeschreibungen ambulanter Hilfen im Modellprojekt
- 6.4 Wirkung anhand der Sozialpädagogischen Diagnostik
- 7. Wirkungsevaluation- / analyse
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Thema der Wirkungsevaluation in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe. Sie analysiert die aktuelle Situation, untersucht die Bedeutung von Wirkungsorientierung und beleuchtet die verschiedenen Wirkungsbeschreibungen im gesetzlichen Kontext, der Fachliteratur und im Rahmen eines Modellprojekts.
- Definition und Beschreibung der Kinder- und Jugendhilfe
- Wirkungsorientierung und Evaluation in der Jugendhilfe
- Wirkungsbeschreibungen ambulanter Hilfen
- Analyse der Wirkung von ambulanten Hilfen
- Grundlagen zur Wirkungsevaluation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und beleuchtet die Relevanz der Wirkungsevaluation in der Kinder- und Jugendhilfe. Kapitel 2 definiert die Kinder- und Jugendhilfe und erläutert die relevanten gesetzlichen Grundlagen. Kapitel 3 widmet sich dem Konzept der Wirkung und der Wirkungsorientierung in der Jugendhilfe. Kapitel 4 betrachtet die Rolle der Wirkungsevaluation im Kontext des § 79a SGB VIII. Kapitel 6 beleuchtet verschiedene Wirkungsbeschreibungen ambulanter Hilfen aus unterschiedlichen Perspektiven.
Schlüsselwörter
Ambulante Hilfen, Kinder- und Jugendhilfe, Wirkungsevaluation, Sozialpädagogische Diagnostik, § 79a SGB VIII, Wirkungsorientierung, Hilfeplanverfahren, Modellprojekt, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Wirkungsevaluation in der Jugendhilfe?
Ziel ist es, die Effektivität ambulanter Hilfen zu überprüfen und sicherzustellen, dass das Budget zielführend für die Klienten eingesetzt wird.
Welche Rolle spielt § 79a SGB VIII?
Dieser Paragraph bildet die gesetzliche Grundlage für die Qualitätsentwicklung und die Analyse der Wirksamkeit von Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe.
Warum stehen Jugendämter unter Rechtfertigungsdruck?
Der Druck entsteht durch steigende Kosten, politische Anforderungen sowie durch die Öffentlichkeit und Presse, besonders nach Unglücksfällen in Familien.
Was ist Sozialpädagogische Diagnostik?
Es ist ein Verfahren zur systematischen Erfassung der Problemlagen in Familien, um die passende Hilfeform (z.B. Familienhilfe) und deren Wirkung besser planen zu können.
Was sind typische ambulante Erziehungshilfen?
Dazu gehören insbesondere die Erziehungsbeistandschaft und die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH).
- Quote paper
- Sozialpädagoge (B.A.) Maximilian Klopf (Author), 2018, Wirkungsevaluation der ambulanten Hilfen in der Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1144614