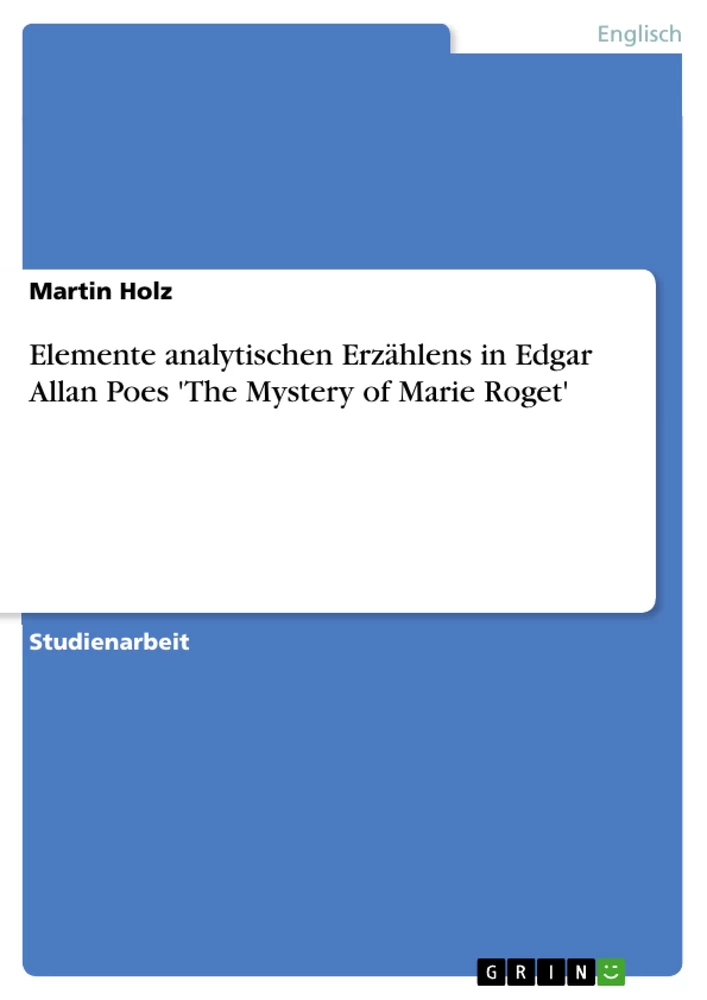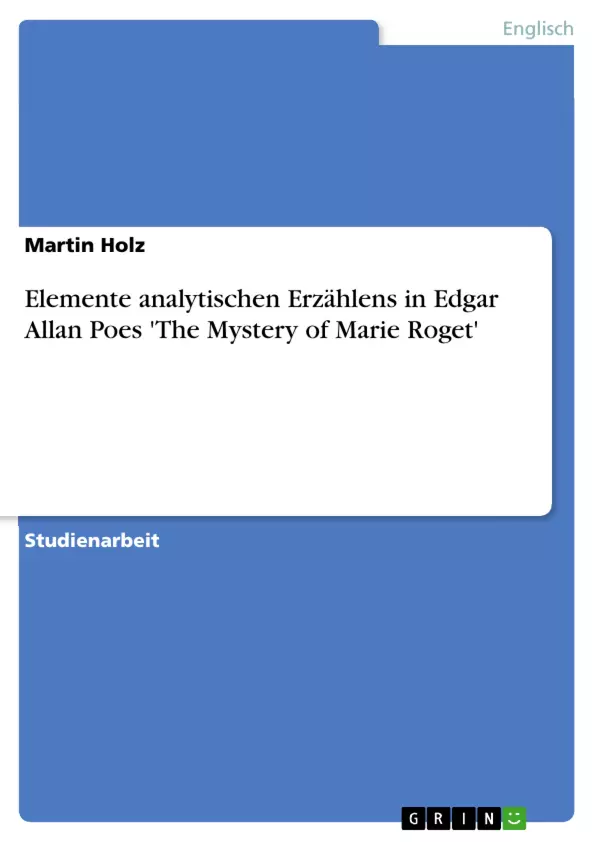Obgleich allgemein anerkannt als Pionier der Detektivgeschichte, hat Poe in seinen "tales of ratiocination" trotz gattungskonstitutiver Merkmale, die in die Tradition des Genres eingegangen sind, spezifische Varianten der detective story kreiert. "The Mystery of Marie Rogêt" entspricht nur partiell dem Typus der klassischen Detektivgeschichte, repräsentiert aber gleichwohl ein Paradig¬ma analytischen Erzählens, wobei signifikante Unterschiede gegenüber den beiden anderen Dupin-Geschichten evident sind. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Elemente analytischen Erzählens gemäß Webers Theorie in dieser Geschichte zu eruieren und ihre Funktion zu bestimmen. Ergänzend werden die Taxonomien von Alewyn und Neuhaus herangezogen, um der Spezifik der detective story als eines möglichen Falls analytischen Erzählens gerecht zu werden. Dabei wird sich zeigen, dass der facettenreiche Begriff "analytisch" bei Poe insofern eine über Webers Definition hinausgehende Bedeutung besitzt, als er nicht nur die Erzähltechnik, sondern auch die von Dupin eingesetzte de¬tektivische Methode bezeichnet und neben einer psychologischen auch eine semiotische Dimension aufweist.
Nicht nur unter dem letzten Aspekt wird scharf zwischen Dupin als fiktiver Figur, dem Erzähler als Figur und als Vermittlungsinstanz und schließlich Poe als Autor nicht bloß der Geschichte, sondern des kriminologischen Rätsels und seiner Lösung zu differenzieren sein:"Der Gefahr der Verwechslung von Poe und Dupin haben viele Kritiker nicht widerstanden." Hinzu kommt, dass in diesem Text - anders als in der ersten und der dritten Dupin-Geschichte - ein authentischer Mordfall fiktionalisiert wird; aufschlussreich ist dabei, welche Distanz Poe zum historisch dokumentierten Mord gewinnt, insbesondere indem er mehr die analytisches Talent exemplifizierende theoretisch-modell¬hafte Auflösung als die konkrete Ergreifung des Täters und die Erhellung seiner Motive akzentuiert. Das manifestiert sich im Handlungsverlauf, in Poes Umarbeitung des Textes, in Erzählerkommentaren zu Beginn und am Schluss und vor allem im Dénouement.
Inhaltsverzeichnis
- A. Poes "tales of ratiocination" als Paradigma analytischen Erzählens
- B. Die Trichotomie der literarischen Konstruktion
- I. Handlungskonstruktion
- 1. Handlungssubstanz und Handlungsverlauf
- 2. Betrachterfigur, Mittlerfigur und Gegenfigur
- II. Narrative Modellierung
- 1. Ereigniszusammenhang vs. Erzählzusammenhang
- 2. Chronologie, Erzähltes und Erzählvorgang
- III. Die Kommunikation zwischen Autor und Leser
- 1. Verrätselung und Enträtselung
- 2. Das problematische Dénouement
- IV. Poetologische und kompositionelle Besonderheiten
- I. Handlungskonstruktion
- C. Dupins analytische Methode
- I. "Ratiocination", Abduktion und der "Calculus of Probabilities"
- II. Detektion als exakte Wissenschaft
- D. Authentischer und fiktiver Mord: Mary Rogers und Marie Roget
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Elemente analytischen Erzählens in Edgar Allan Poes "The Mystery of Marie Rogêt" und untersucht die Funktion dieser Elemente im Kontext der Geschichte. Dabei wird die Theorie von Weber herangezogen, um die Ebenen der Handlungs-, Darstellungs- und Mitteilungskonstruktion zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet auch die spezifischen Merkmale der detective story als eines möglichen Falls analytischen Erzählens, wobei die Taxonomien von Alewyn und Neuhaus berücksichtigt werden. Darüber hinaus wird die analytische Methode Dupins untersucht, insbesondere im Hinblick auf "Ratiocination", Abduktion und den "Calculus of Probabilities". Die Arbeit zeigt, dass der Begriff "analytisch" bei Poe eine über Webers Definition hinausgehende Bedeutung besitzt, da er sowohl die Erzähltechnik als auch die detektivische Methode Dupins bezeichnet und neben einer psychologischen auch eine semiotische Dimension aufweist.
- Analytisches Erzählen in "The Mystery of Marie Rogêt"
- Dupins analytische Methode
- Die Beziehung zwischen Fiktion und Realität
- Die Rolle des Erzählers und der Figur Dupins
- Die Spezifik der detective story als Genre
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet Poes "tales of ratiocination" als Paradigma analytischen Erzählens und stellt die spezifischen Merkmale dieser Geschichten im Kontext der Detektivgeschichte dar. Es wird gezeigt, dass "The Mystery of Marie Rogêt" nur partiell dem Typus der klassischen Detektivgeschichte entspricht, aber dennoch ein Beispiel für analytisches Erzählen bietet. Das Kapitel analysiert die Unterschiede zwischen "The Mystery of Marie Rogêt" und den beiden anderen Dupin-Geschichten und stellt die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit vor.
Das zweite Kapitel untersucht die Trichotomie der literarischen Konstruktion in "The Mystery of Marie Rogêt" anhand der von Weber definierten Ebenen der Handlungs-, Darstellungs- und Mitteilungskonstruktion. Es werden die spezifischen Elemente der Handlungskonstruktion, der narrativen Modellierung und der Kommunikation zwischen Autor und Leser analysiert. Das Kapitel zeigt, wie Poe in "The Mystery of Marie Rogêt" die Elemente analytischen Erzählens nutzt, um Spannung und Rätselhaftigkeit zu erzeugen.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf Dupins analytische Methode und untersucht die Konzepte "Ratiocination", Abduktion und den "Calculus of Probabilities". Es wird gezeigt, wie Dupin seine analytischen Fähigkeiten einsetzt, um den Mordfall zu lösen. Das Kapitel beleuchtet auch die Frage, ob Detektion als exakte Wissenschaft betrachtet werden kann.
Das vierte Kapitel untersucht die Beziehung zwischen dem authentischen Mordfall von Mary Rogers und der fiktionalisierten Geschichte von Marie Roget. Es wird gezeigt, wie Poe den historischen Fall in eine literarische Geschichte umwandelt und dabei die analytischen Fähigkeiten Dupins in den Vordergrund stellt. Das Kapitel analysiert die Distanz, die Poe zum historischen Mordfall gewinnt, und die Bedeutung der theoretisch-modellhaften Auflösung im Vergleich zur konkreten Ergreifung des Täters.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen analytisches Erzählen, Detektivgeschichte, "tales of ratiocination", Edgar Allan Poe, "The Mystery of Marie Rogêt", Dupin, "Ratiocination", Abduktion, "Calculus of Probabilities", Handlungskonstruktion, Narrative Modellierung, Kommunikation zwischen Autor und Leser, Authentizität, Fiktion, Mary Rogers, Marie Roget.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Poes „tales of ratiocination“?
Es handelt sich um Poes Detektivgeschichten, in denen logisches Denken und analytische Methoden (Ratiocination) im Vordergrund stehen, wie bei der Figur C. Auguste Dupin.
Worin besteht das Besondere an „The Mystery of Marie Rogêt“?
Die Geschichte fiktionalisiert einen realen, authentischen Mordfall (Mary Rogers) und konzentriert sich fast ausschließlich auf die theoretische Analyse statt auf Action.
Was versteht man unter analytischem Erzählen?
Analytisches Erzählen bedeutet, dass die Handlung rückwärts konstruiert wird: Ausgehend von einem Ereignis (dem Mord) wird der Hergang durch Analyse rekonstruiert.
Welche Methoden nutzt Dupin zur Lösung des Falls?
Er nutzt Abduktion, den „Calculus of Probabilities“ (Wahrscheinlichkeitsrechnung) und eine exakte wissenschaftliche Beobachtungsgabe.
Wie unterscheidet Poe zwischen Fiktion und Realität?
Poe wahrt Distanz zum historischen Fall, indem er die Lösung als theoretisches Modell präsentiert und den Fokus auf das analytische Talent seines Detektivs legt.
- Quote paper
- Dr. Martin Holz (Author), 1999, Elemente analytischen Erzählens in Edgar Allan Poes 'The Mystery of Marie Roget', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114521