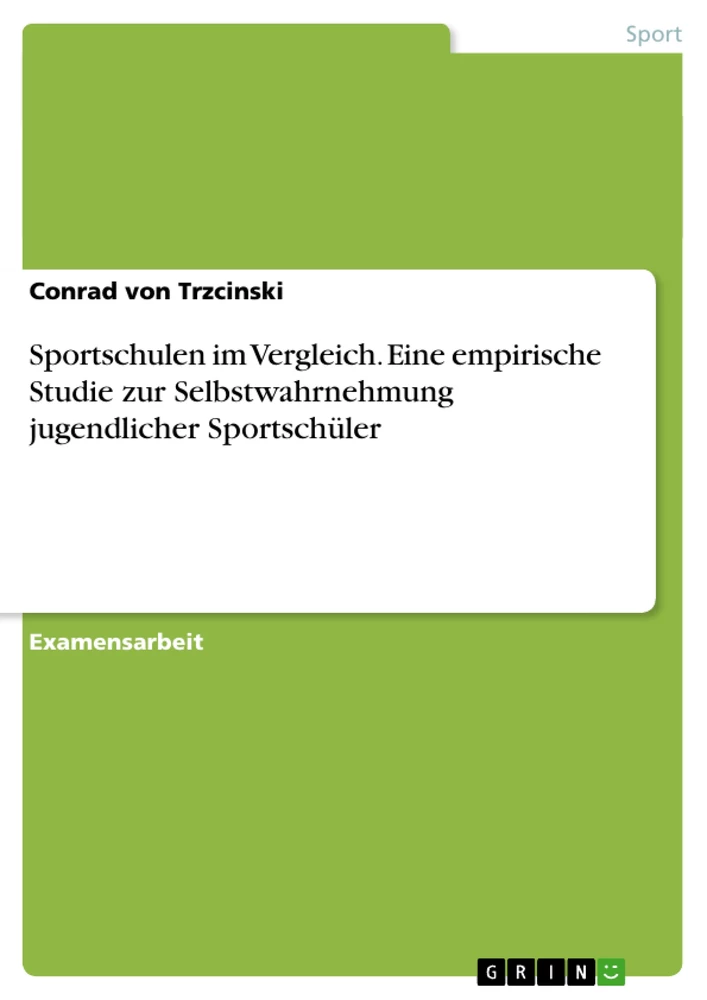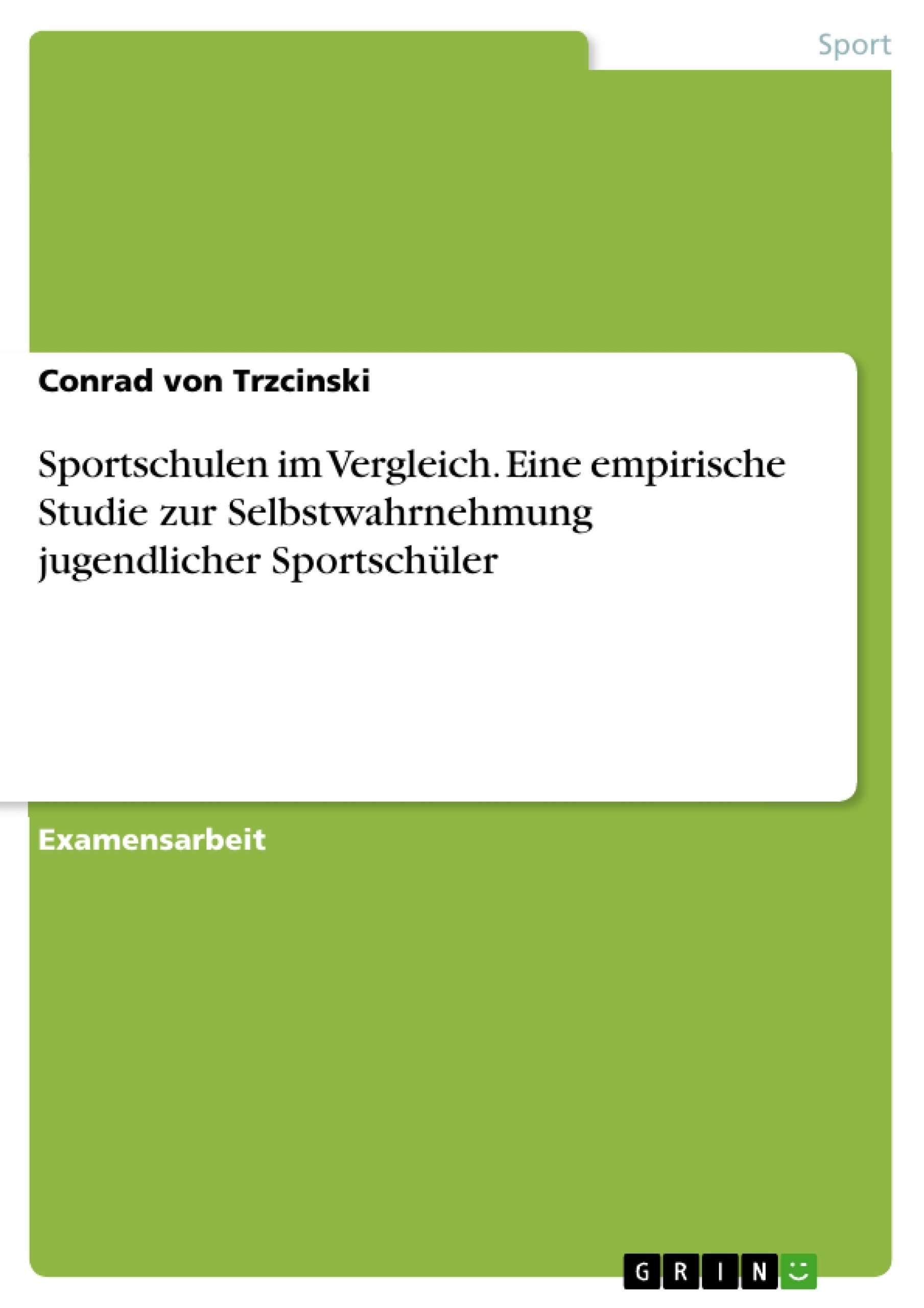Jeden Tag träumen Tausende deutscher Jugendlicher den Traum, erfolgreich Sport zu treiben. Medienpräsente Vorbilder wie der Fußballer Michael Ballack, Turner Fabian Hambüchen, Biathletin Magdalena Neuner oder Basketball-Star Dirk Nowitzki lassen Kinder davon träumen, so berühmt zu werden wie ihre Idole. Auch ich hatte als Kind diesen Traum. Als ich zehn Jahre alt war, hieß mein Vorbild Boris Becker und mein erklärtes Ziel war der Gewinn des Wimbledon-Turniers. Mit zunehmendem Alter und abnehmender Motivation dieses Ziel zu verfolgen, geriet diese Vision jedoch mehr und mehr in den Hintergrund. Ich erkannte bald, dass ich meine Energie lieber in meine Freizeit investieren wollte, als jeden Tag eineinhalb Stunden lang auf dem Tennisplatz zu trainieren. Zudem blieben die erhofften Erfolge aus und so entschied ich mich dafür, mir meine Freizeit so einteilen zu können wie ich es wollte und dagegen, all meine freie Zeit in den Sport zu stecken. Zudem nahmen schulische Belange ab der gymnasialen Oberstufe einen nicht unerheblichen Teil des Tages ein und somit verschwand der Gedanke des Leistungssports gänzlich aus meinem Kopf. Anders verlief die Sportkarriere meines Bruders. Er verließ nach der elften Klasse das Gymnasium, um professionell Eishockey zu spielen. Bereits während seines letzten Schuljahres hatte sich abgezeichnet, dass die Schulleitung nicht bereit war, seine Sportkarriere zu fördern, was zunächst zu sehr vielen versäumten Unterrichtsstunden und schließlich zum Weggang meines Bruders von der Schule führte. Er entschied sich dafür, das Gymnasium zu verlassen, um sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren zu können. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass seine Entscheidung von vielen Lehrern mit Kopfschütteln quittiert und belächelt wurde. Eine Vereinbarung von Schule und Leistungssport war also unmöglich. Das ist fast 15 Jahre her. Mittlerweile hört man immer häufiger den Begriff des Sportinternats. Es wird versucht, Schule und Leistungssport miteinander zu verbinden. Kindern und Jugendlichen soll die Chance gegeben werden, ihr Abitur machen zu können und sich gleichzeitig auf ihre sportliche Laufbahn zu konzentrieren. Dabei gibt es verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten, die in dieser Arbeit vorgestellt werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Verbundsysteme von Schule und Leistungssport
- 2.1 Kooperationsmodelle von Schule und Sport
- 2.1.1 Sportinternate
- 2.1.2 Sportbetonte Schulen
- 2.1.3 Partnerschulen des Leistungssports
- 2.1.4 Sportgymnasien
- 2.2 Sportschulmodelle in der ehemaligen DDR
- 2.2.1 Die Kinder- und Jugendsportschule (KJS)
- 2.2.2 Zur Vergleichbarkeit von KJS mit ihren Nachfolgern
- 3. Konzipierung der Studie
- 3.1 Methodische Vorgehensweise
- 3.1.1 Qualitative Forschung
- 3.1.2 Auswahl der Einrichtungen
- 3.1.3 Auswahl der Interviewpartner
- 3.1.4 Interview
- 3.1.4.1 Formen des Interviews
- 3.1.4.2 Durchführung des Interviews
- 3.1.5 Leitfaden
- 3.1.6 Transkription
- 3.1.7 Auswertungsverfahren
- 3.2 Vorstellung der besuchten Einrichtungen
- 3.2.1 Sportbetonte Schule 1
- 3.2.2 Sportbetonte Schule 2
- 3.2.3 Fußballinternat
- 3.2.4 Sportgymnasium
- 4. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- 4.1 Der Zugang zum Leistungssport
- 4.1.1 Forschungsstand und eigene Vermutungen
- 4.1.2 Zugang zum Sport
- 4.1.3 Der Weg zum Internat
- 4.1.4 Die Rolle der Eltern
- 4.1.5 Ergebnisse
- 4.2 Wahrnehmung der Mehrfachbelastung von Schule und Sport und des damit zusammenhängenden Lebensstils
- 4.2.1 Forschungsstand und eigene Vermutungen
- 4.2.2 Der Tagesablauf
- 4.2.3 Selbsteinschätzung schulischer Leistungen
- 4.2.4 Freizeit
- 4.2.5 Ergebnisse
- 4.3 Wahrnehmung der Unterstützung von Seiten der Schulen
- 4.3.1 Forschungsstand und eigene Vermutungen
- 4.3.2 Zufriedenheit der Fördermaßnahmen an den Schulen und der Unterstützung der Lehrer
- 4.3.3 Ergebnisse
- 4.4 Wahrnehmung der „öffentlichen Meinung“
- 4.4.1 Forschungsstand und eigene Vermutungen
- 4.4.2 Ansichten „normaler“ Schüler
- 4.4.3 Der Freundeskreis
- 4.4.4 Ergebnisse
- 4.5 Wahrnehmung der eigenen Zukunft
- 4.5.1 Forschungsstand und eigene Vermutungen
- 4.5.2 Zukunftspläne
- 4.5.3 Vorstellung eines Lebens ohne Sport
- 4.5.4 Ergebnisse
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Selbstwahrnehmung jugendlicher Sportschüler an verschiedenen Schulformen, die Leistungssport und schulische Bildung verbinden. Ziel ist es, die Erfahrungen und Herausforderungen dieser Schüler im Umgang mit der Mehrfachbelastung zu beleuchten und die verschiedenen Modelle von Sportschulen zu vergleichen.
- Vergleich verschiedener Sportschulmodelle (Sportinternate, sportbetonte Schulen, Sportgymnasien)
- Erfahrungen der Schüler mit der Doppelbelastung von Schule und Leistungssport
- Wahrnehmung der Unterstützung durch Schulen und Lehrer
- Einfluss des sozialen Umfelds auf die Schüler
- Zukunftsperspektiven der Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung schildert die persönliche Erfahrung des Autors mit dem Thema Schule und Leistungssport, ausgehend von eigenen Kindheitserfahrungen und den kontrastierenden Wegen des Autors und seines Bruders. Sie führt in die Thematik der Sportschulen ein und beschreibt die Notwendigkeit, Schule und Leistungssport zu verbinden, um jungen Talenten eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Modellen zur Integration von Leistungssport und schulischer Ausbildung.
2. Verbundsysteme von Schule und Leistungssport: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Kooperationsmodelle von Schule und Leistungssport. Es werden Sportinternate, sportbetonte Schulen, Partnerschulen des Leistungssports und Sportgymnasien detailliert beschrieben und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Sportschulmodellen der ehemaligen DDR und deren Vergleichbarkeit mit heutigen Systemen. Der Vergleich dient als Grundlage für die spätere empirische Untersuchung.
3. Konzipierung der Studie: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der empirischen Studie. Es wird die qualitative Forschungsmethode erläutert, die Auswahl der Einrichtungen und Interviewpartner begründet, und das Vorgehen bei der Interviewdurchführung, -transkription und -auswertung detailliert dargestellt. Die Auswahl der Einrichtungen zielt auf eine breite Darstellung der verschiedenen Sportschulmodelle ab, um einen umfassenden Vergleich zu ermöglichen.
4. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert und interpretiert die Ergebnisse der durchgeführten Interviews. Es beleuchtet den Zugang zum Leistungssport, die Wahrnehmung der Mehrfachbelastung, die Unterstützung durch Schulen, die öffentliche Meinung und die Zukunftsperspektiven der befragten Schüler. Die Ergebnisse werden im Kontext des bestehenden Forschungsstandes diskutiert und analysiert. Jedes Unterkapitel gliedert sich in Forschungsstand, eigene Vermutungen, detaillierte Beschreibungen der Ergebnisse und deren Interpretation.
Schlüsselwörter
Sportschulen, Leistungssport, Schule, Jugendlicher, Selbstwahrnehmung, Mehrfachbelastung, Kooperationsmodelle, Qualitative Forschung, Interview, DDR-Sportschulsystem, Zukunftsperspektiven.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Verbundsysteme von Schule und Leistungssport
Was ist der Gegenstand der Studie?
Die Studie untersucht die Selbstwahrnehmung jugendlicher Sportschüler an verschiedenen Schulformen, die Leistungssport und schulische Bildung verbinden. Sie beleuchtet die Erfahrungen und Herausforderungen dieser Schüler im Umgang mit der Mehrfachbelastung und vergleicht verschiedene Modelle von Sportschulen.
Welche Sportschulmodelle werden verglichen?
Die Studie vergleicht verschiedene Kooperationsmodelle von Schule und Leistungssport, darunter Sportinternate, sportbetonte Schulen, Partnerschulen des Leistungssports und Sportgymnasien. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich mit den Sportschulmodellen der ehemaligen DDR.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine qualitative Forschungsmethode. Die Daten wurden durch Interviews mit Schülern an verschiedenen Sportschulen erhoben. Die Auswahl der Einrichtungen und Interviewpartner erfolgte gezielt, um verschiedene Sportschulmodelle repräsentativ abzubilden. Die Auswertung der Interviews erfolgte nach einem detailliert beschriebenen Verfahren.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie behandelt folgende Themenschwerpunkte: Zugang zum Leistungssport, Wahrnehmung der Mehrfachbelastung von Schule und Sport, Wahrnehmung der Unterstützung durch Schulen und Lehrer, Einfluss des sozialen Umfelds und Zukunftsperspektiven der Schüler.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Studie gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Verbundsysteme von Schule und Leistungssport, Konzipierung der Studie, Darstellung und Interpretation der Ergebnisse und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Welche Ergebnisse liefert die Studie?
Die Studie präsentiert und interpretiert die Ergebnisse der Interviews. Sie beleuchtet den Zugang der Schüler zum Leistungssport, ihre Erfahrungen mit der Mehrfachbelastung, die Unterstützung durch Schulen und Lehrer, die öffentliche Meinung zu ihrem Lebensstil und ihre Zukunftspläne. Die Ergebnisse werden im Kontext des bestehenden Forschungsstandes diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter zur Studie sind: Sportschulen, Leistungssport, Schule, Jugendlicher, Selbstwahrnehmung, Mehrfachbelastung, Kooperationsmodelle, Qualitative Forschung, Interview, DDR-Sportschulsystem, Zukunftsperspektiven.
Wo finde ich detailliertere Informationen zur Methodik?
Detaillierte Informationen zur methodischen Vorgehensweise, einschließlich der Auswahl der Einrichtungen und Interviewpartner, der Interviewführung, der Transkription und der Auswertungsverfahren, finden sich im Kapitel „Konzipierung der Studie“.
Wie werden die verschiedenen Sportschulmodelle im Detail beschrieben?
Die verschiedenen Sportschulmodelle (Sportinternate, sportbetonte Schulen, Partnerschulen des Leistungssports und Sportgymnasien) werden im Kapitel „Verbundsysteme von Schule und Leistungssport“ detailliert beschrieben und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile analysiert. Der Vergleich mit den Sportschulmodellen der ehemaligen DDR wird ebenfalls in diesem Kapitel behandelt.
- Citar trabajo
- Conrad von Trzcinski (Autor), 2008, Sportschulen im Vergleich. Eine empirische Studie zur Selbstwahrnehmung jugendlicher Sportschüler, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114566