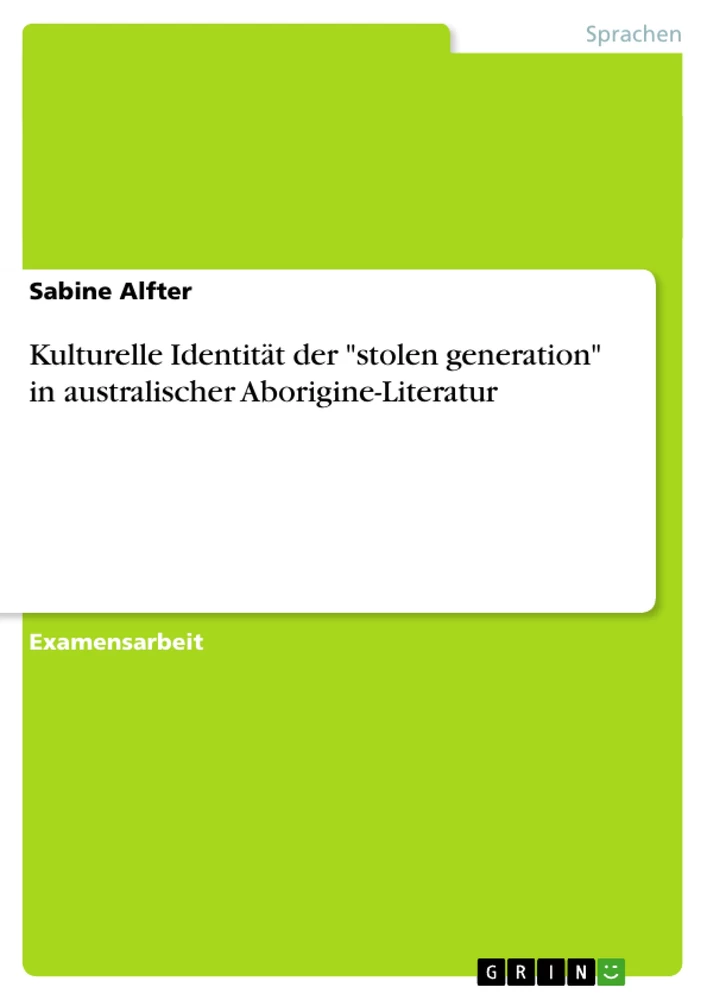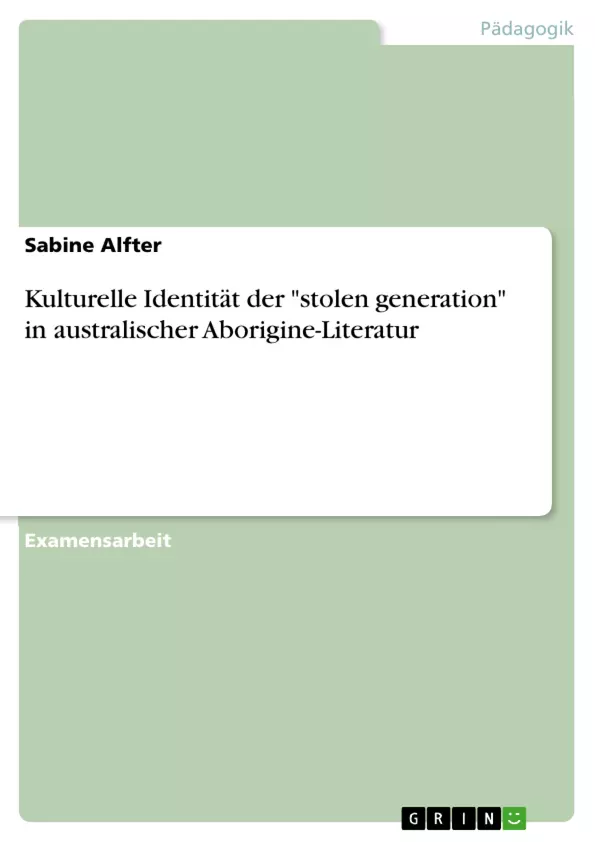Der Ausdruck Stolen Generation bezeichnet schätzungsweise 20.000 bis 25.000 Kinder mit einem aborigenen und einem weißen Elternteil, die zwischen 1910 und 1970 im Rahmen der von der australischen Regierung verfolgten Assimilationspolitik unter Zwang von ihren Eltern und aborigenen Gemeinschaften getrennt wurden. In weißen Adoptionsfamilien, kirchlichen Missionen und staatlichen Kinderheimen wurden sie auf ein Leben in der weißen Gesellschaft vorbereitet. Die australische Regierung verfolgte dabei das Ziel, die Kinder von ihren kulturellen Wurzeln zu trennen und so die Kultur der Aborigines und Torres Strait Insulaner zu zerstören.
Wird in der vorliegenden Arbeit vereinfachend von Aborigines gesprochen, so schließt dies die Torres Strait Insulaner mit ein, die allerdings auf ihre kulturelle Eigenständigkeit Wert legen. Der zugegebenermaßen etwas grobe Ausdruck „weiße Gesellschaft“ umfasst die Mitglieder der angelsächsisch geprägten Dominanzkultur in Australien.
Die unter Zwang von ihren Eltern getrennten Kinder wurden nicht nur ihrer aborigenen Kultur entrissen, sondern gleichzeitig in einer Entwicklungsphase von ihren Familien getrennt, in der diese eine elementare Rolle in der Primärsozialisation der Kinder spielt, um ein gesundes Urvertrauen auszubilden, das als wichtige Grundlage für die Konstruktion einer ausgewogenen Identität des Individuums angesehen wird. In der Folge dieser Trennungen berichten die institutionalisierten Opfer häufig von Identitätsproblemen, gekoppelt mit vergleichsweise erhöhtem Alkohol- und Drogenkonsum, vermehrten psychischen und physischen Krankheiten, höherer Arbeitslosigkeit, häufigeren Gefängnisaufenthalten und einer insgesamt niedrigeren Lebenserwartung.
Das Erzählen ihrer Geschichten wird für die Opfer der Stolen Generation zu einem bedeutsamen Schritt auf dem Weg ihres mentalen Heilungsprozesses.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Identität
- Kulturelle Identität
- Aboriginality
- Die Stolen Generation
- Konstruktion von Aboriginality
- Sally Morgans My Place
- Doris Pilkingtons Follow the Rabbit-Proof Fence
- Jane Harrisons Stolen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kulturelle Identität der Stolen Generation in australischer Aborigine-Literatur. Das Hauptziel ist die Analyse, wie die erzwungene Trennung von ihren Familien und Kulturen die Identitätsbildung der Betroffenen beeinflusst hat und wie diese Erfahrungen in ausgewählten literarischen Werken verarbeitet werden. Die Arbeit beleuchtet die Konstruktion von Aboriginality in der Literatur und untersucht die Bedeutung des Erzählens als Teil des Heilungsprozesses.
- Identitätsbildung in der Stolen Generation
- Kulturelle Identität und deren Verlust
- Die Rolle der Literatur in der Aufarbeitung traumatischer Erfahrungen
- Konstruktion von Aboriginality in literarischen Texten
- Assimilationspolitik Australiens und ihre Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Stolen Generation ein, beschreibt die historische und soziokulturelle Situation der zwischen 1910 und 1970 zwangsweise von ihren Familien getrennten Kinder und skizziert die Ziele und den methodischen Ansatz der Arbeit. Sie stellt die drei analysierten literarischen Werke vor und begründet deren Auswahl, wobei der Fokus auf der Auseinandersetzung mit den Schicksalen der Betroffenen aus verschiedenen Perspektiven liegt. Die Einleitung betont die Bedeutung der Texte für den mentalen Heilungsprozess der Betroffenen und die alternative Perspektive auf die offizielle Geschichtsschreibung, die sie bieten.
Identität: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Identität" aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven, insbesondere der Biologie und Psychologie. Es wird der Prozess der Identitätsbildung im Kontext der Primärsozialisation und die besondere Rolle der Mutter für die Entwicklung des Urvertrauens erörtert. Das Kapitel untersucht die Auswirkungen der Trennung von den Familien auf die Identitätsentwicklung der Kinder der Stolen Generation, die zu Identitätsproblemen und psychosozialen Schwierigkeiten führt, wie erhöhter Suchtproblematik, psychischen und physischen Krankheiten, Arbeitslosigkeit und verkürzter Lebenserwartung.
Die Stolen Generation: Dieses Kapitel liefert einen historischen Überblick über die Stolen Generation, beleuchtet die Hintergründe und die politischen Ziele der Assimilationspolitik der australischen Regierung, die zur gewaltsamen Trennung aboriginer Kinder von ihren Familien führte. Es beschreibt die Lebensbedingungen der Kinder in weißen Adoptionsfamilien, kirchlichen Missionen und staatlichen Heimen, in denen sie von ihren kulturellen Wurzeln getrennt wurden, um sie in die weiße Gesellschaft zu integrieren.
Konstruktion von Aboriginality: Dieses Kapitel analysiert die literarische Darstellung von Aboriginality in den Werken von Sally Morgan (My Place), Doris Pilkington (Follow the Rabbit-Proof Fence), und Jane Harrison (Stolen). Es untersucht, wie die Autorinnen ihre individuellen Erfahrungen und die Erfahrungen der Stolen Generation literarisch verarbeiten und wie sie durch ihre Texte eine alternative Sicht auf die Geschichte und die kulturelle Identität der Aborigines konstruieren. Die Analyse beleuchtet die unterschiedlichen literarischen Mittel und die verschiedenen Perspektiven, die in den drei Werken zum Ausdruck kommen, und stellt deren Relevanz für das Verständnis der Thematik heraus.
Schlüsselwörter
Stolen Generation, kulturelle Identität, Aboriginality, Assimilationspolitik, Australien, Identitätsbildung, Trauma, Literatur, Sally Morgan, Doris Pilkington, Jane Harrison, My Place, Follow the Rabbit-Proof Fence, Stolen, Identitätskonstruktion, interkulturelle Kommunikation, postkoloniale Literatur.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der kulturellen Identität der Stolen Generation in australischer Aborigine-Literatur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die kulturelle Identität der Stolen Generation in australischer Aborigine-Literatur. Sie untersucht, wie die erzwungene Trennung von Familien und Kulturen die Identitätsbildung der Betroffenen beeinflusste und wie diese Erfahrungen in ausgewählten literarischen Werken verarbeitet werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Konstruktion von „Aboriginality“ in der Literatur und der Bedeutung des Erzählens im Heilungsprozess.
Welche Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert drei literarische Werke: Sally Morgans „My Place“, Doris Pilkingtons „Follow the Rabbit-Proof Fence“ und Jane Harrisons „Stolen“. Die Auswahl dieser Werke ermöglicht eine Betrachtung der Thematik aus verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen der Stolen Generation.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Identitätsbildung in der Stolen Generation, den Verlust kultureller Identität, die Rolle der Literatur in der Aufarbeitung traumatischer Erfahrungen, die Konstruktion von „Aboriginality“ in literarischen Texten und die Auswirkungen der Assimilationspolitik Australiens.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Identität, der Stolen Generation, der Konstruktion von „Aboriginality“ und einem Resümee. Die Einleitung stellt die Thematik, die Ziele und den methodischen Ansatz vor. Die Kapitel behandeln die theoretischen Grundlagen, den historischen Kontext und die literarische Analyse der ausgewählten Werke.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse, wie die erzwungene Trennung von Familien und Kulturen die Identitätsbildung der Betroffenen der Stolen Generation beeinflusste und wie diese Erfahrungen in der Literatur verarbeitet werden. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Literatur als Instrument der Aufarbeitung und des Heilungsprozesses.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Stolen Generation, kulturelle Identität, Aboriginality, Assimilationspolitik, Australien, Identitätsbildung, Trauma, Literatur, Sally Morgan, Doris Pilkington, Jane Harrison, „My Place“, „Follow the Rabbit-Proof Fence“, „Stolen“, Identitätskonstruktion, interkulturelle Kommunikation und postkoloniale Literatur.
Wie wird die Identität der Stolen Generation betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen der Identitätsbildung im Kontext der erzwungenen Trennung von Familien und Kulturen. Sie beleuchtet die Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung und die langfristigen Folgen, wie z.B. erhöhte Suchtproblematik und psychische Erkrankungen.
Welche Rolle spielt die Literatur in der Arbeit?
Die Literatur spielt eine zentrale Rolle, da sie als Medium der Aufarbeitung traumatischer Erfahrungen und der Konstruktion einer alternativen Sicht auf die Geschichte der Aborigines dient. Die Analyse der literarischen Werke ermöglicht ein tieferes Verständnis der Perspektiven und Erfahrungen der Betroffenen.
Wie wird die Assimilationspolitik Australiens behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische und soziokulturelle Situation der Stolen Generation im Kontext der Assimilationspolitik der australischen Regierung. Es wird gezeigt, wie diese Politik zur gewaltsamen Trennung aboriginer Kinder von ihren Familien führte und welche Folgen dies hatte.
Welche wissenschaftlichen Perspektiven werden einbezogen?
Die Arbeit bezieht verschiedene wissenschaftliche Perspektiven ein, insbesondere aus der Biologie, Psychologie und Literaturwissenschaft, um den Prozess der Identitätsbildung und die Auswirkungen traumatischer Erfahrungen umfassend zu analysieren.
- Quote paper
- Sabine Alfter (Author), 2007, Kulturelle Identität der "stolen generation" in australischer Aborigine-Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114574