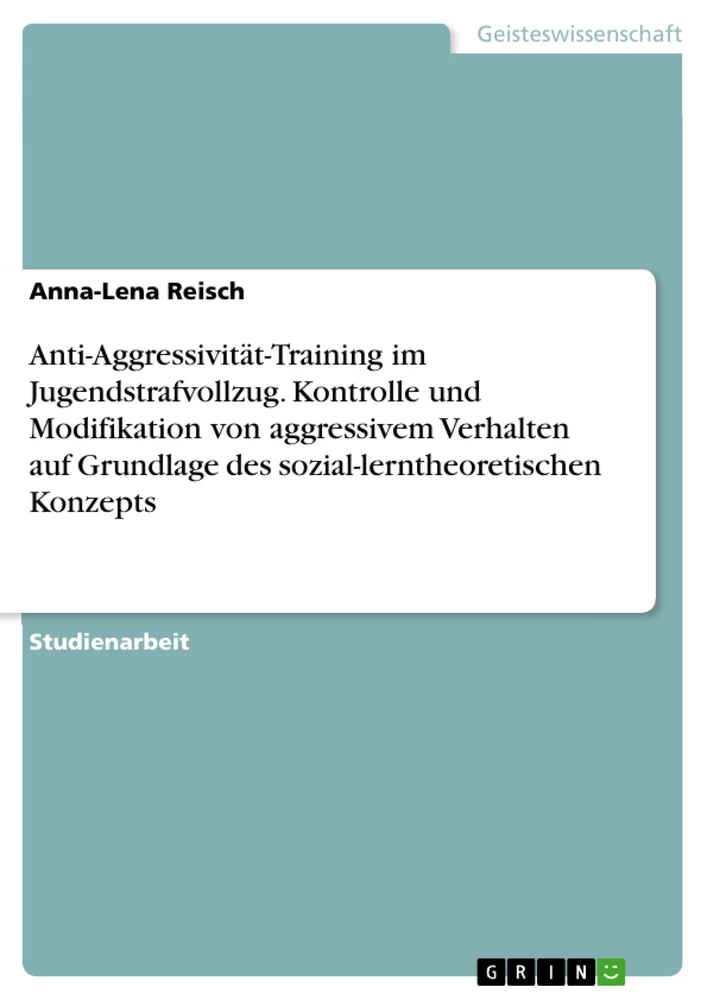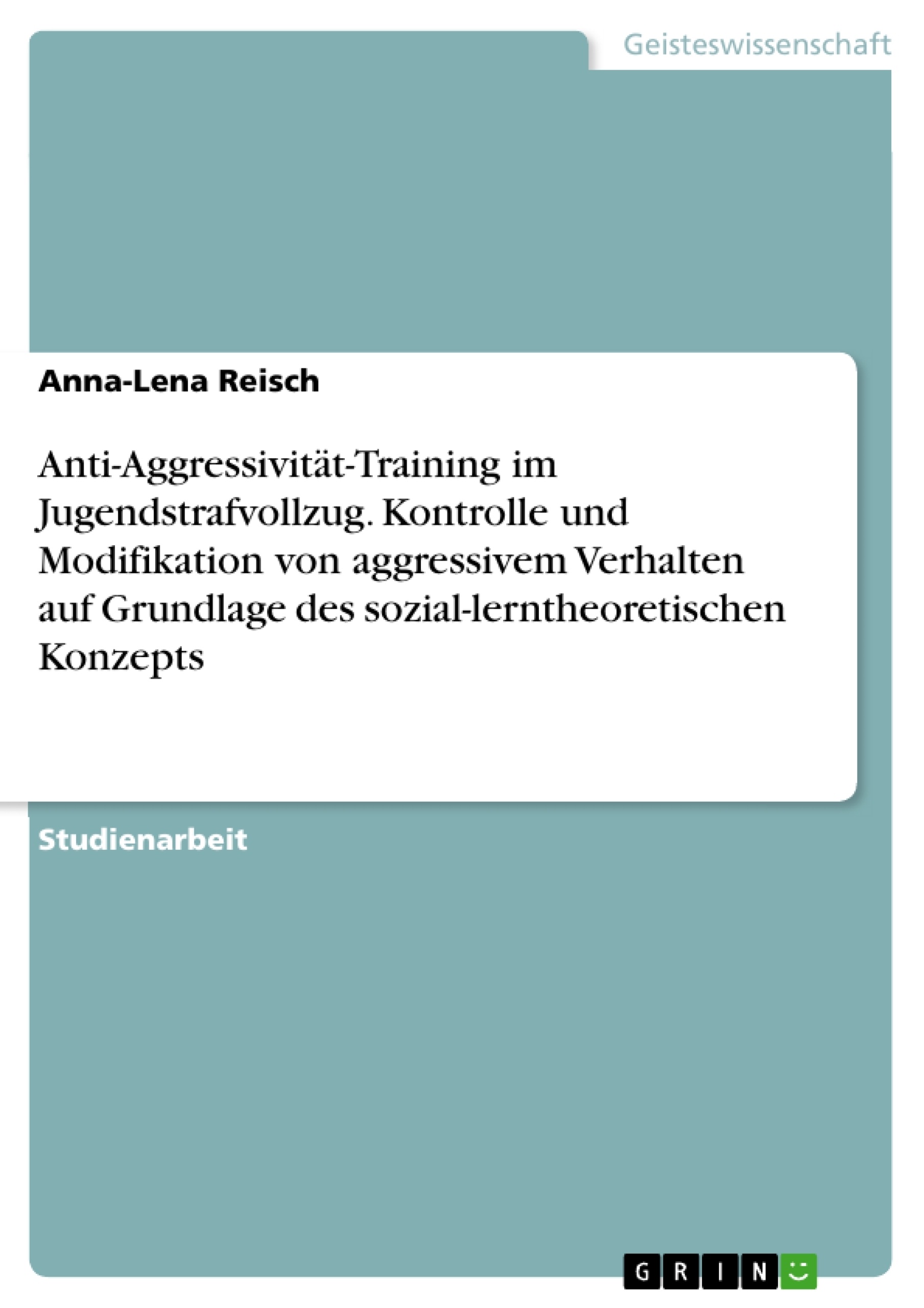Diese Arbeit untersucht, inwiefern beim Anti-Aggressivität-Training (AAT), auf Grundlage des sozio-kognitiven Ansatzes, aggressives Verhalten modifiziert und kontrolliert werden kann? Sie thematisiert auf Grundlage des sozio-kognitiven Ansatzes von Albert Bandura (1976) Aggression und Gewalt und zeigt am Beispiel des AATs eine mögliche Maßnahme zur Kontrolle und Modifikation von aggressivem Verhalten auf. Die zugrundeliegende Thematik fällt in den Gegenstandsbereich der Sozialpsychologie, die sich damit auseinandersetzt, inwiefern die tatsächliche, vorgestellte oder implizierte Anwesenheit anderer das Denken, Fühlen und Verhalten eines Individuums beeinflusst.
Da bei Jugendlichen die psychosoziale Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und es daher noch Möglichkeiten gibt, bei Fehlentwicklungen geeignete Maßnahmen einzuleiten, glaubt die Gesellschaft noch an eine Interventionsmöglichkeit. Deshalb werden Jugendliche nach dem Jugendstrafrecht verurteilt und erhalten in diesem Zuge Weisungen, die ihre Erziehung fördern und sichern sollen. Dazu gehört neben anderen Auflagen auch die Weisung, an einem sozialen Trainingskurs wie zum Beispiel einem Anti-Aggressivität-Training teilzunehmen. Dieser Kurs soll den Jugendlichen also bei der Kontrolle ihres aggressiven Verhaltens helfen. Das soll dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Gewaltstraftat sinkt und somit auch das Risiko für eine Wiederverurteilung der straffällig gewordenen Jugendlichen. Diese Maßnahmen sind notwendig, da bei Straftaten, die nach dem Jugendstrafrecht sanktioniert werden, die gesamte Rückfallrate bei 41 Prozent liegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Einführung in die theoretischen Grundlagen
- 2.1 Definition von Aggression, Gewalt, Aggressivität und antisozialem Verhalten
- 2.2 Sozio-kognitiver Ansatz
- 2.2.1 Aufmerksamkeitsprozesse
- 2.2.2 Bekräftigungs- und Motivationsprozesse
- 3 Aggression und Gewalt aus Sicht des sozio-kognitive Ansatzes
- 3.1 Hauptquellen und Auslösebedingungen für Aggressives Verhalten
- 3.2 Bedingungen für die Beibehaltung aggressiven Verhaltens
- 3.2.1 Externe Bekräftigung
- 3.2.2 Stellvertretende Bekräftigung
- 3.2.3 Selbstbekräftigung
- 4 Modifikation und Kontrolle von Aggressionsverhalten im Jugendstrafvollzug
- 4.1 Anti-Aggressivitätstraining im Jugendstrafvollzug
- 4.2 Sozial-kognitive Maßnahmen im Anti-Aggressivitätstraining
- 4.2.1 Darbietung eines positiven Modells
- 4.2.2 Entwicklung von Handlungsalternativen
- 4.2.3 Aufzeigen aversiver Konsequenzen
- 4.2.4 Bestrafung durch Belohnungsentzug
- 4.2.5 Abbau von Neutralisierungstechniken
- 4.2.6 Konfrontation zur Übung der alternativen Handlungsweißen
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert Aggression und Gewalt unter dem sozio-kognitiven Ansatz von Albert Bandura und zeigt am Beispiel des Anti-Aggressivitätstrainings (AAT) eine mögliche Maßnahme zur Kontrolle und Modifikation von aggressivem Verhalten auf. Die Arbeit beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen und den empirischen Befunden, die das Verständnis von Aggression im Kontext des Jugendstrafvollzugs erweitern.
- Definition und Differenzierung von Aggression, Gewalt, Aggressivität und antisozialem Verhalten
- Der sozio-kognitive Ansatz von Albert Bandura und seine Bedeutung für das Verständnis von Aggression
- Hauptquellen und Auslösebedingungen für aggressives Verhalten
- Bedingungen für die Beibehaltung von aggressivem Verhalten
- Anti-Aggressivitätstraining im Jugendstrafvollzug als Interventionsmaßnahme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert die aktuelle gesellschaftliche Debatte über die Zunahme von Aggression und Gewalt, insbesondere im Kontext von jugendlichen und heranwachsenden Tatverdächtigen bei Gewaltverbrechen. Der Bezug zum Jugendstrafvollzug und dem Anti-Aggressivitätstraining (AAT) als Interventionsmaßnahme wird hergestellt.
Kapitel 2 führt in die theoretischen Grundlagen ein, indem die Begriffe "Aggression", "Gewalt", "Aggressivität" und "antisoziales Verhalten" definiert und differenziert werden. Der sozio-kognitive Ansatz von Albert Bandura wird vorgestellt, der Lernen am Modell als zentralen Faktor für die Entstehung und Modifikation von Verhaltensweisen betont. Die Rolle der Aufmerksamkeitsprozesse sowie der Bekräftigungs- und Motivationsprozesse wird erläutert.
Kapitel 3 untersucht Aggression und Gewalt aus der Sicht des sozio-kognitiven Ansatzes. Die Hauptquellen und Auslösebedingungen für aggressives Verhalten werden analysiert, und es werden die Bedingungen für die Beibehaltung aggressiven Verhaltens im Detail betrachtet, inklusive externer, stellvertretender und selbstbekräftigender Prozesse.
Kapitel 4 konzentriert sich auf die Modifikation und Kontrolle von Aggressionsverhalten im Jugendstrafvollzug. Das Anti-Aggressivitätstraining (AAT) wird als ein wichtiger Ansatz zur Intervention vorgestellt. Die sozial-kognitiven Maßnahmen des AATs, wie die Darbietung eines positiven Modells, die Entwicklung von Handlungsalternativen, das Aufzeigen aversiver Konsequenzen und die Bestrafung durch Belohnungsentzug, werden detailliert betrachtet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den Themenfeldern Aggression und Gewalt, insbesondere im Kontext des Jugendstrafvollzugs. Im Fokus stehen die sozio-kognitiven Prozesse der Entstehung und Modifikation von Aggression, die Bedeutung von Lernen am Modell, und die Anwendung des Anti-Aggressivitätstrainings (AAT) als Interventionsmaßnahme. Die Analyse der Schlüsselbegriffe wie Aggression, Gewalt, Aggressivität, antisoziales Verhalten, sozio-kognitiver Ansatz, Modelllernen, Bekräftigung, AAT, und Jugendstrafvollzug bilden den Rahmen für die Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen zum Anti-Aggressivität-Training (AAT)
Was ist das Ziel des Anti-Aggressivität-Trainings im Jugendstrafvollzug?
Das Ziel ist die Modifikation und Kontrolle aggressiven Verhaltens, um die Rückfallrate bei Gewaltstraftaten zu senken.
Worauf basiert der sozio-kognitive Ansatz von Albert Bandura?
Der Ansatz betont das "Lernen am Modell" sowie die Bedeutung von Aufmerksamkeit, Motivation und Bekräftigungsprozessen für das menschliche Verhalten.
Was versteht man unter "Neutralisierungstechniken"?
Dies sind Rechtfertigungsstrategien, mit denen Straftäter ihr eigenes Fehlverhalten vor sich selbst und anderen legitimieren. Der Abbau dieser Techniken ist Teil des AAT.
Welche Rolle spielt die "Bekräftigung" bei aggressivem Verhalten?
Aggressives Verhalten wird oft durch externe Belohnungen (z. B. Erfolg durch Gewalt) oder stellvertretende Bekräftigung (Beobachtung erfolgreicher Vorbilder) beibehalten.
Wie werden Handlungsalternativen im AAT entwickelt?
Durch Rollenspiele und Konfrontationsübungen lernen die Jugendlichen, Konflikte gewaltfrei zu lösen und die aversiven Konsequenzen ihres früheren Verhaltens zu erkennen.
- Citar trabajo
- Anna-Lena Reisch (Autor), 2021, Anti-Aggressivität-Training im Jugendstrafvollzug. Kontrolle und Modifikation von aggressivem Verhalten auf Grundlage des sozial-lerntheoretischen Konzepts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1146056