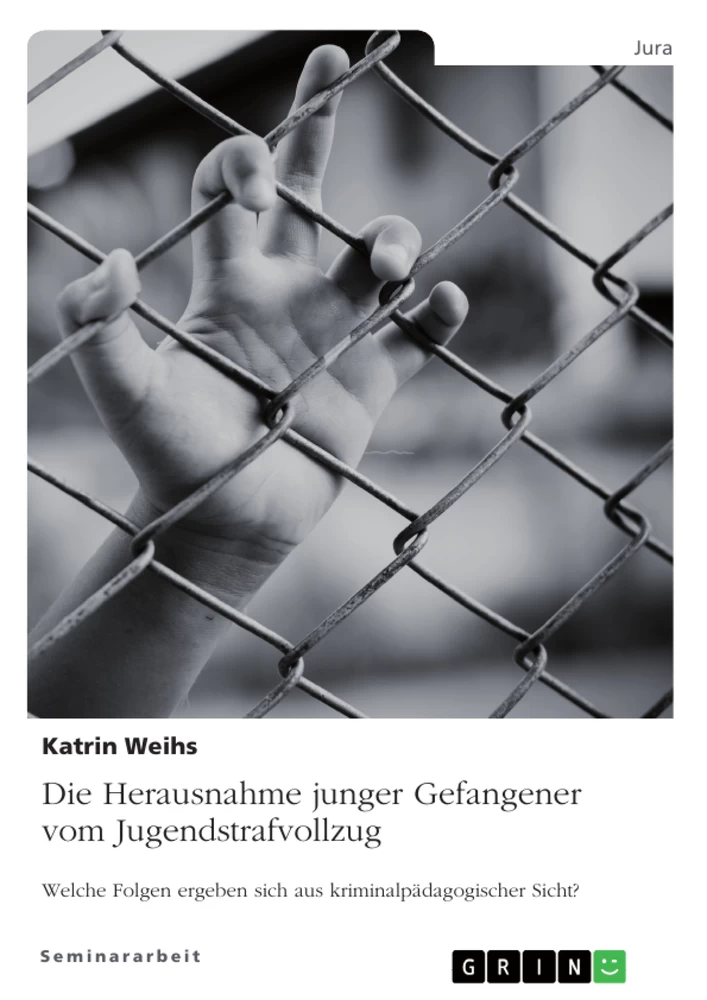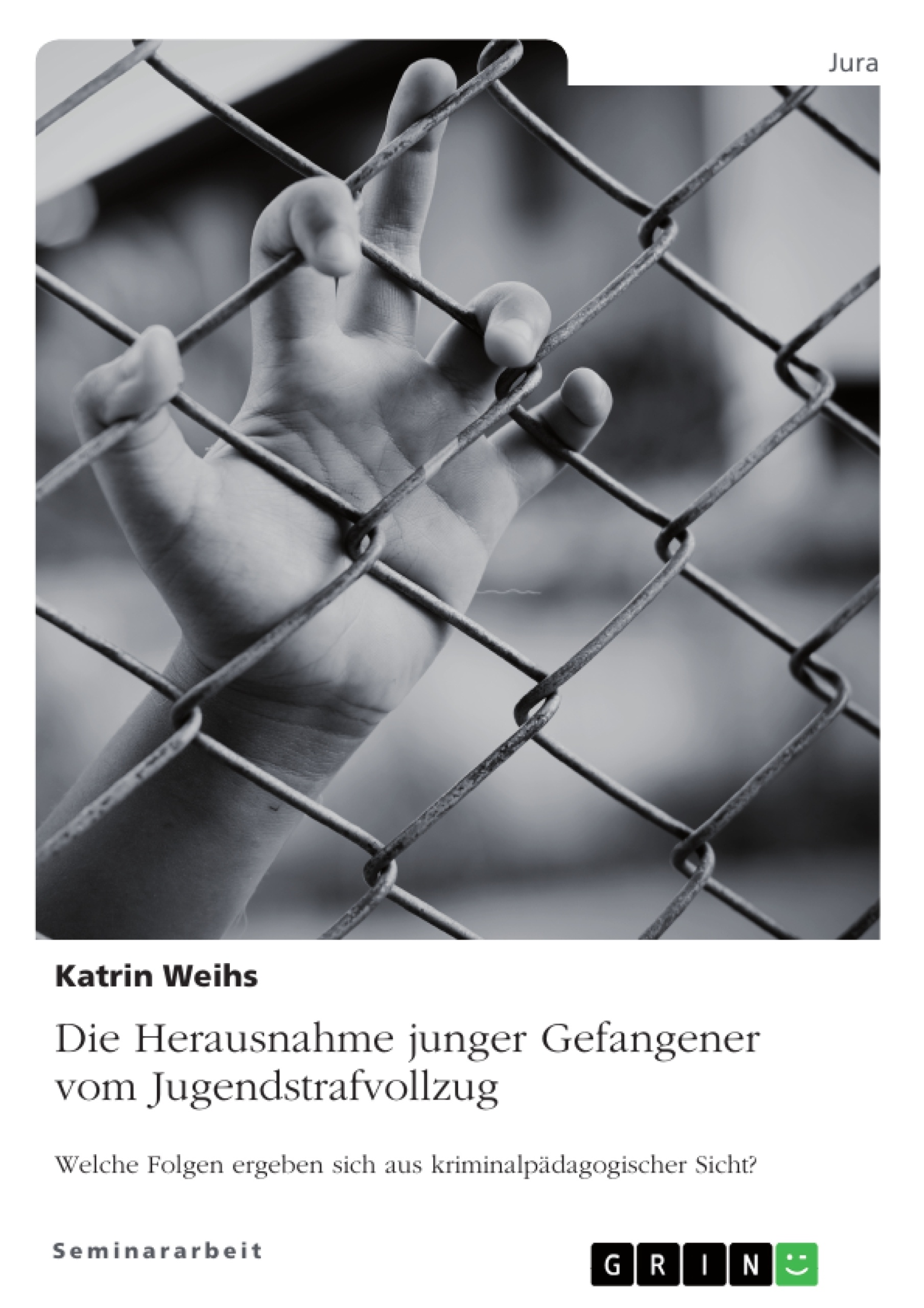Der Gesetzgeber des JGG hat dem Umstand, dass zwischen Tat und Vollstreckung beachtliche Zeitfenster liegen können, in denen sich die Persönlichkeit des Täters verändert und verfestigt, seine Erziehbarkeit inzwischen möglicherweise nicht mehr vorhanden sein kann, dadurch Bedeutung beigemessen, dass er die Herausnahme des Verurteilten aus dem Jugendstrafvollzug gestattet. Nach § 89b Abs. 1 S. 1 JGG braucht die Jugendstrafe an einem nach Jugendstrafrecht Verurteilten, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und sich nicht für den Jugendstrafvollzug eignet, nicht in der Jugendstrafanstalt vollzogen zu werden. Die Jugendstrafe kann statt nach den Vorschriften für den Jugendstrafvollzug, nach den Vorschriften des Strafvollzuges für Erwachsene vollzogen werden.
Es drängt sich die Frage auf, „wann“ ein junger Gefangener für den Jugendstrafvollzug nicht geeignet erscheint und was unter dem Begriff der „Ungeeignetheit“ genau zu verstehen ist. Weiterhin fragt sich, ob es – abgesehen von der „Ungeeignetheit“ – noch weitere Kriterien oder sonstige Gründe gibt, die eine „Herausnahme“ vom Jugendstrafvollzug nahelegen. Welche Konsequenzen können sich aus der Herausnahme vom Jugendstrafvollzug auf die kriminalpädagogische Einwirkung ergeben? Könnte sich eine derartige Maßnahme gegebenenfalls nachteilig auf den Herausgenommenen auswirken?
Die aufgeworfenen Fragen sind Gegenstand der folgenden Ausführung und beleuchtet die Herausnahme aus dem Jugendstrafvollzug im Lichte der Kriminalpädagogik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorstellungen über Sinn und Zweck der Strafe
- Absolute Straftheorien
- Relative Straftheorien
- Vereinigungstheorien
- Ziele und Aufgaben des Jugendstrafvollzugs
- Bedeutung
- Differenzierung von Ziel und Aufgaben bzw. Aufträgen
- Die Gesetzeslage
- Zukünftiges Legalverhalten
- § 89b JGG Ausnahme vom Jugendstrafvollzug
- Allgemeines zur Norm
- Kriterien für die Ausnahme gem. § 89b Abs. 1 JGG
- Auswirkungen der Ausnahme vom Jugendstrafvollzug
- Optimierungsbedarf
- Wirkung der Haft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Konsequenzen der Ausnahme vom Jugendstrafvollzug nach § 89b JGG auf die kriminalpädagogische Einwirkung. Sie analysiert die verschiedenen Straftheorien und die Ziele des Jugendstrafvollzugs, um die Auswirkungen dieser Ausnahme auf die Resozialisierung von Jugendlichen zu beleuchten.
- Sinn und Zweck von Strafe im Jugendstrafrecht
- Ziele und Aufgaben des Jugendstrafvollzugs
- Auswirkungen von § 89b JGG auf die Resozialisierung
- Kriminalpädagogische Strategien bei Ausnahmen vom Jugendstrafvollzug
- Optimierungspotential im Umgang mit § 89b JGG
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und beschreibt die zentrale Forschungsfrage: Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Ausnahme vom Jugendstrafvollzug nach § 89b JGG für die kriminalpädagogische Einwirkung? Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die relevanten Straftheorien, die im weiteren Verlauf detailliert untersucht werden. Die Einleitung stellt die Notwendigkeit der Untersuchung heraus, da die Ausnahme nach § 89b JGG impliziert, dass alternative Maßnahmen zur Resozialisierung gefunden und deren Wirksamkeit geprüft werden müssen.
Ziele und Aufgaben des Jugendstrafvollzugs: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung und die differenzierten Ziele und Aufgaben des Jugendstrafvollzugs. Es analysiert die gesetzliche Grundlage und untersucht das Spannungsfeld zwischen Bestrafung und Resozialisierung. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die verschiedenen Ziele des Jugendstrafvollzugs (z.B. Schutz der Allgemeinheit, Resozialisierung des Täters) miteinander vereinbart und in der Praxis umgesetzt werden können. Das Kapitel liefert eine solide Grundlage für die spätere Analyse der Auswirkungen der Ausnahme nach § 89b JGG.
§ 89b JGG Ausnahme vom Jugendstrafvollzug: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Ausnahme vom Jugendstrafvollzug gemäß § 89b JGG. Es erläutert die Kriterien für die Anwendung dieser Ausnahme und analysiert deren Auswirkungen auf die weitere Behandlung des Jugendlichen. Der Fokus liegt auf der Frage, welche Konsequenzen sich aus der Nicht-Inhaftierung für die kriminalpädagogische Arbeit ergeben. Das Kapitel untersucht auch den Optimierungsbedarf bezüglich der Anwendung und der Wirksamkeit dieser Regelung. Es wird dargelegt, inwiefern die gewählten Alternativmaßnahmen den Zielen des Jugendstrafvollzugs gerecht werden.
Wirkung der Haft: Dieses Kapitel analysiert die Wirkung von Jugendhaft auf den Jugendlichen. Es beleuchtet die potenziellen positiven und negativen Auswirkungen des Gefängnisaufenthaltes auf die Resozialisierung. Diese Analyse liefert einen wichtigen Vergleichspunkt für die Bewertung der Auswirkungen der Ausnahme nach § 89b JGG. Es werden dabei verschiedene Studien und empirische Befunde herangezogen, um ein möglichst umfassendes Bild der Wirkung der Haft zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Jugendstrafvollzug, § 89b JGG, Kriminalpädagogik, Resozialisierung, Straftheorien, Generalprävention, Spezialprävention, Jugendstrafrecht, Alternativmaßnahmen, Wirkung von Haft, Optimierungsbedarf.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Ausnahme vom Jugendstrafvollzug nach § 89b JGG
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Konsequenzen der Ausnahme vom Jugendstrafvollzug nach § 89b JGG für die kriminalpädagogische Einwirkung auf Jugendliche. Sie analysiert die Auswirkungen dieser Ausnahme auf die Resozialisierung und prüft die Wirksamkeit alternativer Maßnahmen.
Welche Straftheorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt absolute und relative Straftheorien sowie Vereinigungstheorien, um den Sinn und Zweck von Strafe im Jugendstrafrecht zu beleuchten und die Grundlage für die Analyse der Auswirkungen von § 89b JGG zu schaffen.
Welche Ziele und Aufgaben des Jugendstrafvollzugs werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Bedeutung und die differenzierten Ziele und Aufgaben des Jugendstrafvollzugs, einschließlich des Spannungsfelds zwischen Bestrafung und Resozialisierung. Es wird untersucht, wie die verschiedenen Ziele (z.B. Schutz der Allgemeinheit, Resozialisierung) in der Praxis vereinbart und umgesetzt werden.
Wie wird § 89b JGG im Detail behandelt?
Das Kapitel zu § 89b JGG erläutert die Kriterien für die Anwendung der Ausnahme vom Jugendstrafvollzug und analysiert deren Auswirkungen auf die weitere Behandlung des Jugendlichen. Es untersucht die Konsequenzen der Nicht-Inhaftierung für die kriminalpädagogische Arbeit und den Optimierungsbedarf bezüglich der Anwendung und Wirksamkeit dieser Regelung.
Welche Rolle spielt die Wirkung von Haft in der Analyse?
Die Arbeit analysiert die Wirkung von Jugendhaft auf die Resozialisierung, um einen Vergleichspunkt für die Bewertung der Auswirkungen der Ausnahme nach § 89b JGG zu liefern. Es werden dabei verschiedene Studien und empirische Befunde herangezogen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen Jugendstrafvollzug, § 89b JGG, Kriminalpädagogik, Resozialisierung, Straftheorien, Generalprävention, Spezialprävention, Jugendstrafrecht, Alternativmaßnahmen, Wirkung von Haft und Optimierungsbedarf.
Welche zentralen Forschungsfragen werden gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Ausnahme vom Jugendstrafvollzug nach § 89b JGG für die kriminalpädagogische Einwirkung? Die Arbeit untersucht zudem die Wirksamkeit alternativer Maßnahmen zur Resozialisierung im Vergleich zur Inhaftierung.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu den Zielen und Aufgaben des Jugendstrafvollzugs, zu § 89b JGG, zur Wirkung der Haft und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit sind im Fazit zusammengefasst. Sie basieren auf der Analyse der verschiedenen Straftheorien, der Ziele des Jugendstrafvollzugs, der Auswirkungen von § 89b JGG und der Wirkung von Haft. Die Arbeit identifiziert möglicherweise Optimierungspotential im Umgang mit § 89b JGG.
- Citation du texte
- Katrin Weihs (Auteur), 2018, Die Herausnahme junger Gefangener vom Jugendstrafvollzug. Welche Folgen ergeben sich aus kriminalpädagogischer Sicht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1146146