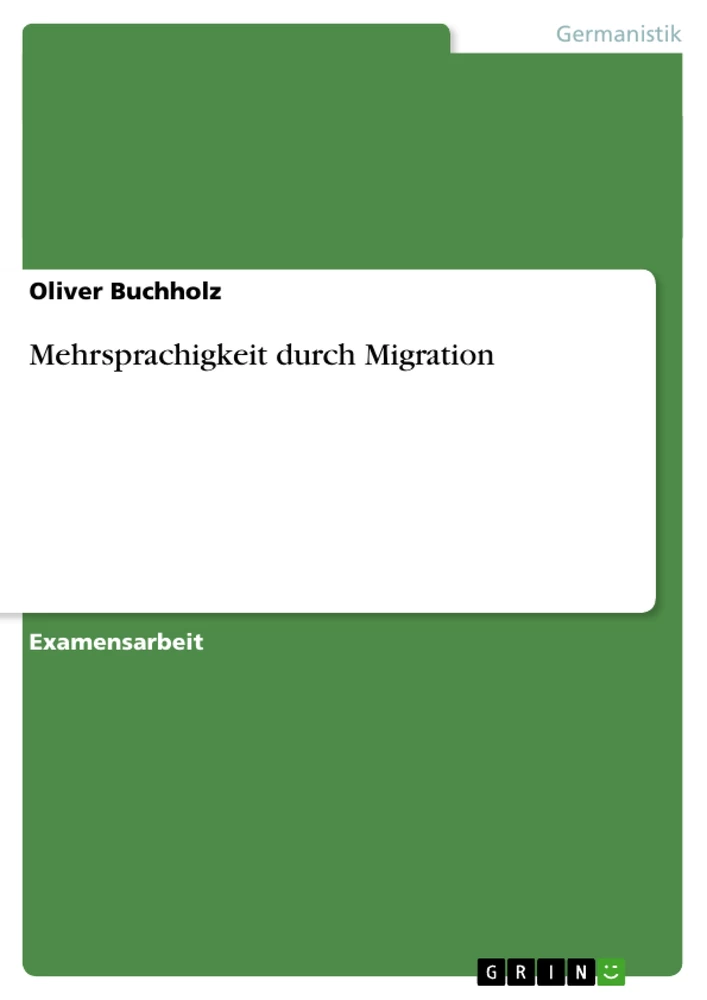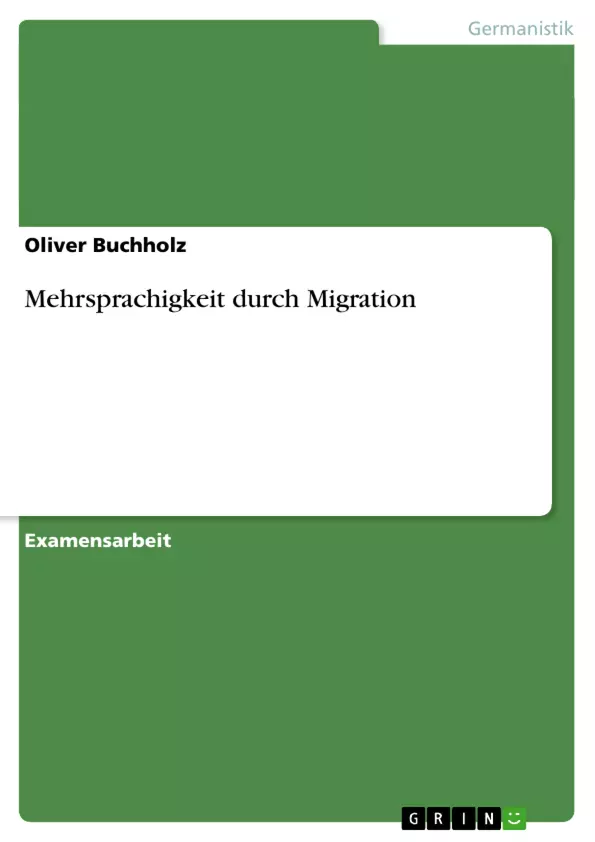Seit dem Beginn des Kapitalismus im Zuge der industriellen Revolution vor allem im 19. Jahrhundert und der zunehmenden Globalisierung der Welt seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist es zu einer Mobilisierung von Millionen von Menschen gekommen, die infolge von Migrationsbewegungen ihr Herkunftsland verlassen haben, was zu einer Fülle von neuen Sprachkontaktsituationen geführt hat, die aufgrund der immer weiter steigenden Mobilität des modernen Menschen auch immer häufiger wechseln.
Die Folgen dieser neuen Sprachkontakte im Zuge der Wanderungsbewegungen der letzten 150 Jahre „sind vielleicht nur mit den Folgen der europäischen Völkerwanderung in der Spätantike zu vergleichen“ , die der Auslöser für die Entwicklung vieler moderner europäischer Sprachen aus durch Sprachkontakten entstandener Mehr- und Mischsprachigkeit war.
Der Vergleich dieser Völkerwanderung mit den neuen Migrationsbewegungen soll das Ausmaß deutlich machen, das Wanderungsbewegungen auf Sprachen haben können, wobei jedoch die inzwischen gefestigten Sprachstrukturen in den in dieser Arbeit hauptsächlich untersuchten Aufnahmeländern Westeuropas berücksichtigt werden müssen, so daß trotz der mit der Globalisierung der Welt einhergehenden größeren Mobilität des Menschen im Vergleich zur Migration der Spätantike durch den Einfluß anderer Sprachen so gut wie keine Veränderungen in den Aufnahme-sprachen zu erwarten sind.
Diese These wird dadurch bestätigt, daß das Bewußtsein für diese Sprachmischungen im Laufe der letzten zweihundert Jahre im Zusammenhang mit der Etablierung bürgerlicher Nationalstaaten in Europa größtenteils verdrängt worden ist, so daß die allgemeine Einstellung zur Sprachmischung eher negativ ist. Außerdem ist die Anzahl der Mitglieder anderssprachiger ethnischer Minderheiten in diesen Ländern meist zu gering, um Einfluß auf die Aufnahmesprache zu nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- MIGRATION
- Geschichte der Migration
- Vor 1945
- 1945 bis 1989
- Erste Phase
- Zweite Phase
- 1989 bis 2002
- Aufnahmeländer
- Geschichte der Migration
- BILINGUALISMUS
- Individueller Bilingualismus
- Gesellschaftlicher Bilingualismus
- Monolinguale Staaten
- Eigentlich multilinguale Staaten
- Bilinguale Staaten
- Territorialer Bilingualismus am Beispiel Belgiens
- Institutioneller Bilingualismus am Beispiel Kanadas
- Multilinguale Staaten
- Gründe für die Entstehung multilingualer Staaten
- Diglossie
- SPRACHMIGRATION
- Die Geschichte der Sprachmigration
- Arbeitsmigration gleich Sprachmigration?
- Definition
- Integration oder Assimilation
- Periodisierung der Gastarbeitermigration
- L 1 und L 2 zwischen den Generationen
- Die erste Generation
- Gruppe 1
- Gruppe 2
- Die zweite Generation
- Die dritte Generation
- Die erste Generation
- Interne und externe Migration
- Sozioökonomische Aspekte
- Sprachliche Aspekte
- Fallstudie
- MIGRATION UND SPRACHE
- Vorgeschichte
- Neue Sprachen
- L 1-Sprachen in den Niederlanden
- Vorausgehende Studien
- NWO - Studie
- Grundlagen
- Frühe bilinguale Entwicklung
- Hintergrund
- NWO - Ergebnisse
- Bilinguale Entwicklung im Schulalter
- Hintergrund
- NWO Ergebnisse
- Politische Konzepte bilingualer Erziehung
- Grundlagen
- Schweden
- Deutschland
- Niederlande
- Zusammenfassung
- Codeswitching
- Hintergrund
- NWO Ergebnisse
- Fallbeispiel: Codeswitching
- Hintergrund
- Ergebnisse
- Sprachwandel und Sprachverlust
- Hintergrund
- NWO - Methoden
- Sprachwahl
- Sprachkompetenz
- Relativsätze
- Ergebnisse
- Sprachwandel bei Rückkehrern
- Hintergrund
- Untersuchungen
- Ergebnisse
- Vorgeschichte
- RESÜMEE
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Mehrsprachigkeit im Kontext von Migration. Ziel ist es, die Auswirkungen von Migrationsbewegungen auf die Sprachen der Migranten und der Aufnahmegesellschaften zu untersuchen. Dabei werden sowohl die Geschichte der Migration als auch die Entwicklung des Bilingualismus und der Sprachmigration beleuchtet.
- Die Geschichte der Migration und ihre Auswirkungen auf die Sprachen
- Die Entwicklung des Bilingualismus und die verschiedenen Formen des Sprachkontakts
- Die Sprachmigration und die Herausforderungen der Integration und Assimilation
- Die Auswirkungen von Migration auf die Sprachen der Migranten und der Aufnahmegesellschaften
- Die Rolle der Sprache in der Integration und der Herausforderungen des Sprachwandels und Sprachverlusts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Mehrsprachigkeit durch Migration ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der Globalisierung und der zunehmenden Mobilität der Menschen dar. Sie beleuchtet die historischen Parallelen zwischen der Völkerwanderung der Spätantike und den modernen Migrationsbewegungen und diskutiert die Auswirkungen von Migration auf Sprachen.
Das erste Kapitel befasst sich mit der Geschichte der Migration und ihren verschiedenen Phasen. Es werden die historischen Entwicklungen der Migration vor 1945, von 1945 bis 1989 und von 1989 bis 2002 beleuchtet. Dabei werden die wichtigsten Migrationsströme und ihre Ursachen sowie die Rolle der Aufnahmeländer analysiert.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Bilingualismus und seinen verschiedenen Formen. Es werden der individuelle Bilingualismus, der gesellschaftliche Bilingualismus und die Diglossie behandelt. Dabei werden die verschiedenen Modelle des Bilingualismus in verschiedenen Ländern und die Gründe für die Entstehung multilingualer Staaten untersucht.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Sprachmigration und ihren Besonderheiten. Es werden die Geschichte der Sprachmigration, die Definition von Sprachmigration, die Integration und Assimilation von Migranten sowie die Entwicklung der Sprachen zwischen den Generationen analysiert. Darüber hinaus werden die sozioökonomischen und sprachlichen Aspekte der internen und externen Migration beleuchtet.
Das vierte Kapitel untersucht die Auswirkungen von Migration auf die Sprache. Es werden die Vorgeschichte der Sprachentwicklung in den Niederlanden, die NWO-Studie und ihre Ergebnisse sowie die bilinguale Entwicklung im Schulalter und die Herausforderungen des Codeswitching und des Sprachwandels und Sprachverlusts analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Migration, Mehrsprachigkeit, Bilingualismus, Sprachmigration, Integration, Assimilation, Sprachwandel, Sprachverlust, Codeswitching, NWO-Studie, Niederlande, Deutschland, Schweden, Belgien, Kanada.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Migration die Mehrsprachigkeit in einer Gesellschaft?
Migration führt zu neuen Sprachkontaktsituationen, in denen die Herkunftssprachen der Migranten auf die Aufnahmesprachen treffen, was oft zu individueller und gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit führt.
Was ist der Unterschied zwischen individuellem und gesellschaftlichem Bilingualismus?
Individueller Bilingualismus bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, zwei Sprachen zu sprechen. Gesellschaftlicher Bilingualismus beschreibt Staaten, in denen zwei oder mehr Sprachen offiziell oder faktisch existieren (z.B. Kanada oder Belgien).
Was versteht man unter „Codeswitching“?
Codeswitching bezeichnet das fließende Wechseln zwischen zwei Sprachen innerhalb eines Gesprächs oder sogar eines Satzes, was typisch für bilinguale Gemeinschaften ist.
Kommt es durch Migration zu einem Wandel der Aufnahmesprache?
In modernen Nationalstaaten Westeuropas sind die Sprachstrukturen so gefestigt, dass trotz Migration kaum tiefgreifende Veränderungen in der Aufnahmesprache durch den Einfluss von Minderheitensprachen zu erwarten sind.
Was bedeutet Sprachverlust bei Migranten?
Sprachverlust tritt oft in der zweiten oder dritten Generation auf, wenn die Herkunftssprache (L1) zugunsten der Umgebungssprache (L2) in ihrer Kompetenz und Nutzung stark abnimmt.
- Citation du texte
- Oliver Buchholz (Auteur), 2002, Mehrsprachigkeit durch Migration, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114639