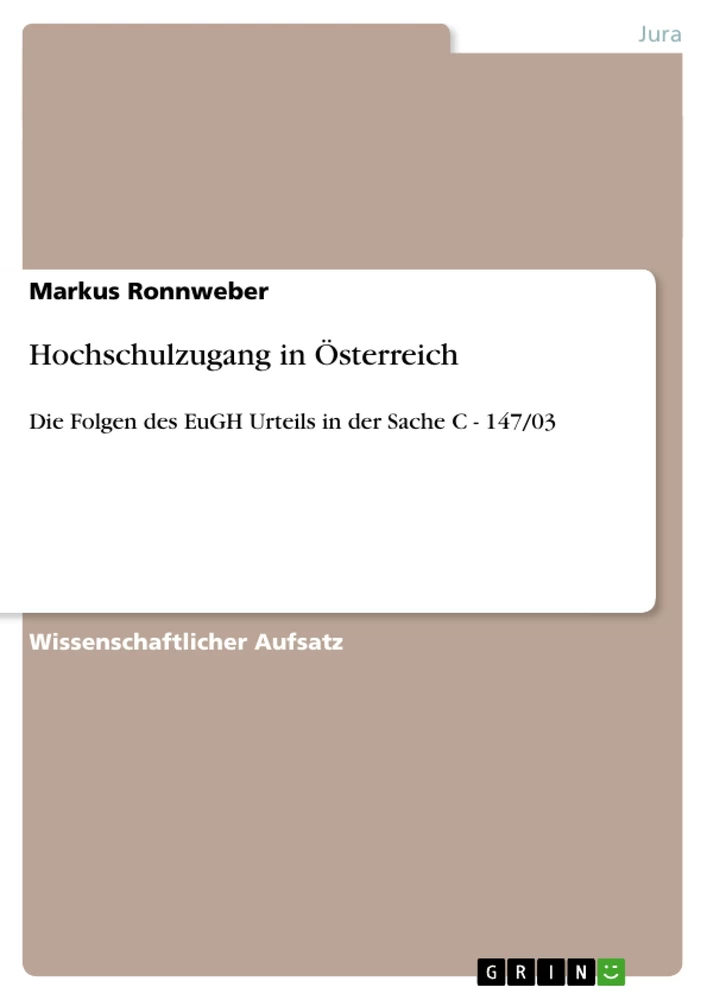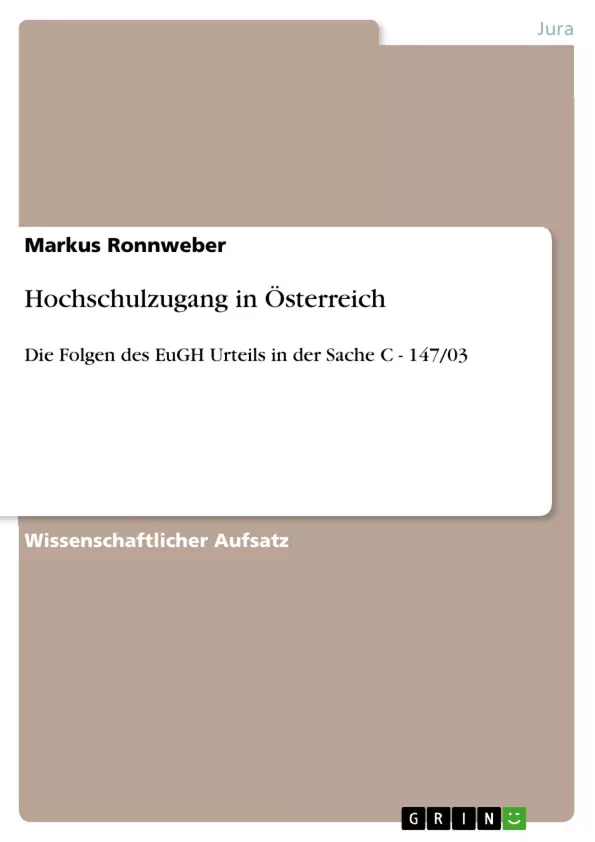Die bis zum Urteil des EuGH in Österreich geltenden Bestimmungen, welche den Zugang für Angehörige anderer Mitgliedsstaaten zu den österreichischen Universitäten regelten, nämlich § 36 (1) UniStG bzw. § 65 (1) UG 2002, besagten, dass zusätzlich zur allgemeinen Universitätsreife die Erfüllung der studienrichtungsspezifischen Zulassungsvoraussetzungen einschließlich des Rechts zur unmittelbaren Zulassung zum Studium nachzuweisen ist, die im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die allgemeine Universitätsreife nachgewiesen wird, bestehen. Der EuGH kam am 07. 07. 2005 jedoch zu der Erkenntnis, dass die Republik Österreich dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den Artikeln 12 EG, 149 EG und 150 EG verstoßen hat, weil sie nicht die erforderlichen Maßnahmen getroffen hat, um sicherzustellen, dass die Inhaber von in anderen Mitgliedstaaten erworbenen Sekundärabschlüssen unter den gleichen Voraussetzungen wie die Inhaber von in Österreich erworbenen Sekundärabschlüssen Zugang zum Hochschul- und Universitätsstudium in Österreich haben.
Die Ausgangslage – Das Urteil des EuGH
Die bis zum Urteil des EuGH in Österreich geltenden Bestimmungen, welche den Zugang für Angehörige anderer Mitgliedsstaaten zu den österreichischen Universitäten regelten, nämlich § 36 (1) UniStG bzw. § 65 (1) UG 2002, besagten, dass zusätzlich zur allgemeinen Universitätsreife die Erfüllung der studienrichtungsspezifischen Zulassungsvoraussetzungen einschließlich des Rechts zur unmittelbaren Zulassung zum Studium nachzuweisen ist, die im Ausstellungsstaat der Urkunde, mit der die allgemeine Universitätsreife nachgewiesen wird, bestehen. Der EuGH kam am 07. 07. 2005 jedoch zu der Erkenntnis, dass die Republik Österreich dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den Artikeln 12 EG, 149 EG und 150 EG verstoßen hat, weil sie nicht die erforderlichen Maßnahmen getroffen hat, um sicherzustellen, dass die Inhaber von in anderen Mitgliedstaaten erworbenen Sekundärabschlüssen unter den gleichen Voraussetzungen wie die Inhaber von in Österreich erworbenen Sekundärabschlüssen Zugang zum Hochschul- und Universitätsstudium in Österreich haben.
Anmerkungen zum Urteil des EuGH
Das Urteil des EuGH war für Österreich sehr unbefriedigend, dennoch war es in gewisser Weise bereits vorhersehbar. Bereits im Jahr 2004 war in einem Verfahren gegen Belgien eine Regelung welche der österreichischen sehr ähnlich war, für rechtswidrig erklärt worden.[1]
Eine der wesentlichsten Fragen, die durch den EuGH aufgeworfen wird, ist jene der Gleichbehandlung von österreichischen Studenten mit jenen aus anderen Mitgliedsstaaten. Der EuGH ist zu dem Entschluss gekommen, dass Österreich Studierende anderer Mitgliedsstaaten beim Zugang zum österreichischen Universitätssystem indirekt diskriminiert und somit keine Gleichbehandlung vorliegt. Der EuGH hat es jedoch versäumt den Begriff Gleichbehandlung genau zu bestimmen.
Ob Gleichbehandlung in einem konkreten Sachverhalt vorliegt, hängt wesentlich vom gewählten Vergleichsgesichtspunkt ab. Der Vergleichsgesichtspunkt entscheidet darüber, ob eine Differenzierung sachlich gerechtfertigt ist oder nicht. Vergleichsgesichtspunkt für die Zulassung zu einem Hochschulstudium, so könnte man meinen, ist die Verfügung über ein Reifezeugnis, welches die ausreichende Qualifikation für ein solches Studium belegt.[2] „Unter dieser Voraussetzung ist es, jedenfalls bei Fehlen von Vereinbarungen über die Harmonisierung von Reifezeugnissen und den Zugang zum Studium, zumindest nicht unsachlich, an die Regelungen jenes Landes anzuknüpfen, in dem das fragliche Zeugnis ausgestellt wurde. Das genau ist es, was die beiden Übereinkommen aus 1953 und 1997 festschreiben. Es kommt nicht auf ihre Bindungswirkung im Gemeinschaftsrecht an. Vielmehr enthalten sie die Festlegung eines Vergleichsgesichtspunkts bei der Zulassung zum Hochschulstudium, die keineswegs willkürlich ist. Allein wegen diesen sachlichen Gewichts kann man ihr die Relevanz auch im Rahmen der innergemeinschaftlichen Gleichheitsprüfung nicht rundweg absprechen. Akzeptiert man diesen Ansatz, so müssten Inhaber solcher Zeugnisse, die je und je den Hochschulzugang verschaffen, gleich behandelt werden. Ob man unter diesen Umständen, nämlich unter der Prämisse, dass ohnedies am sachlich relevanten Vergleichsgesichtspunkt angeknüpft wird, überhaupt noch von einer versteckten Ungleichbehandlung von Ausländern sprechen kann, erscheint durchaus diskutabel, auch wenn konkret mehr Ausländer als Inländer an der Aufnahme eines Hochschulstudiums behindert sind. Jedenfalls aber, so wäre zu folgern, stellt es, allenfalls auf der Grundlage einer Rechtfertigungsprüfung, keine Verletzung des Diskriminierungsverbots dar, an die Berechtigung anzuknüpfen, die das Reifezeugnis im Herkunftsland verschafft.“[3]
Dieser Ansatz hat jedoch keinen Eingang in die vorliegende Entscheidung gefunden und wurde vom EuGH in keinster Weise aufgegriffen, wodurch das Auflammen von kritischen Stimmen gegen dieses Urteil mit Bezug auf die eben erörterten Punkte als durchaus berechtigt zu klassifizieren sind.
Ein Begriff, welcher mit jenem der Gleichbehandlung in engem Zusammenhang steht und sehr wohl Eingang in das Urteil gefunden hat, ist jener der Unionsbürgerschaft. Der Gerichtshof verweist in diesem Fall auf seine Rechtssprechung, wonach der Unionsbürgerstatus dazu bestimmt sei, der grundlegende Status der Angehörigen der Mitgliedstaaten zu sein, der es denjenigen unter ihnen, die sich in der gleichen Situation befinden, erlaubt, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und unbeschadet der insoweit ausdrücklich vorgesehenen Ausnahmen die gleiche rechtliche Behandlung zu genießen, so trägt er weiter dazu bei, diesem Status einen eigenständigen Gehalt zu geben und ihn vom allgemeinen Bewegungs- und Aufenthaltsrecht zu emanzipieren.[4] Die Unionsbürgerschaft wird damit zu einem Instrument für die weitere Expansion des Diskriminierungsverbots zu einem allgemeinen Gleichheitssatz bzw. zur Herausbildung eines „radikalen“ Gleichheitsgrundsatzes. Es erscheint jedoch fraglich, ob ein solcher Gleichheitsgrundsatz vom gegenwärtigen „Gerüst“ des Gemeinschaftsrechts getragen werden kann, denn das zentrale Problem sind die damit verbundenen finanziellen Belastungen der einzelnen Mitgliedsstaaten.[5]
[...]
[1] Vgl. Rs C-65/03, Kommission/Belgien (Hochschulzugang), Slg 2004, I-6427 Rz 28 f.
[2] Vgl. Stefan Griller, Hochschulzugang in Österreich: Von Missverständnissen und Kurzschlüssen beim Diskriminierungsschutz, JBl 2006, 280.
[3] Stefan Griller, Hochschulzugang in Österreich: Von Missverständnissen und Kurzschlüssen beim Diskriminierungsschutz, JBl 2006, 280.
[4] Vgl. Peter Hilpold, Hochschulzugang und Unionsbürgerschaft, EuZW 2005, 651f; C – 184/99, Grzelczyk, Slg. 2001, I – 6193, Randnr. 31 und D´Hoop, Randnr. 28.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Ausgangslage vor dem Urteil des EuGH bezüglich des Hochschulzugangs in Österreich für EU-Bürger?
Vor dem Urteil des EuGH regelten § 36 (1) UniStG bzw. § 65 (1) UG 2002 den Zugang zu österreichischen Universitäten für Angehörige anderer Mitgliedsstaaten. Diese Bestimmungen verlangten zusätzlich zur allgemeinen Universitätsreife den Nachweis der studienrichtungsspezifischen Zulassungsvoraussetzungen einschließlich des Rechts zur unmittelbaren Zulassung zum Studium, wie sie im Ausstellungsstaat der Urkunde bestehen, mit der die Universitätsreife nachgewiesen wird.
Was hat der EuGH in seinem Urteil vom 07.07.2005 festgestellt?
Der EuGH entschied, dass die Republik Österreich gegen ihre Verpflichtungen aus den Artikeln 12 EG, 149 EG und 150 EG verstoßen hat. Dies geschah, weil Österreich nicht die erforderlichen Maßnahmen ergriffen hatte, um sicherzustellen, dass Inhaber von in anderen Mitgliedstaaten erworbenen Sekundärabschlüssen unter den gleichen Voraussetzungen Zugang zum Hochschul- und Universitätsstudium in Österreich haben wie Inhaber von in Österreich erworbenen Sekundärabschlüssen.
Warum war das Urteil des EuGH aus österreichischer Sicht unbefriedigend, aber dennoch vorhersehbar?
Das Urteil war unbefriedigend, aber in gewisser Weise vorhersehbar, da bereits 2004 eine ähnliche Regelung in Belgien für rechtswidrig erklärt worden war.
Welche wesentliche Frage wurde durch den EuGH aufgeworfen?
Eine wesentliche Frage betrifft die Gleichbehandlung von österreichischen Studenten mit Studenten aus anderen Mitgliedsstaaten. Der EuGH kam zu dem Schluss, dass Österreich Studierende anderer Mitgliedsstaaten beim Zugang zum Universitätssystem indirekt diskriminiert und somit keine Gleichbehandlung vorliegt, definierte aber den Begriff Gleichbehandlung nicht genau.
Welchen Vergleichsgesichtspunkt schlug Stefan Griller bezüglich des Hochschulzugangs vor?
Stefan Griller argumentierte, dass der Vergleichsgesichtspunkt für die Zulassung zu einem Hochschulstudium das Vorhandensein eines Reifezeugnisses sein sollte, welches die ausreichende Qualifikation für ein solches Studium belegt. Seiner Meinung nach ist es, bei Fehlen von Vereinbarungen über die Harmonisierung von Reifezeugnissen und den Zugang zum Studium, zumindest nicht unsachlich, an die Regelungen jenes Landes anzuknüpfen, in dem das Zeugnis ausgestellt wurde.
Welche Rolle spielt der Begriff der Unionsbürgerschaft im Urteil des EuGH?
Der EuGH verweist auf seine Rechtssprechung, wonach der Unionsbürgerstatus dazu bestimmt sei, der grundlegende Status der Angehörigen der Mitgliedstaaten zu sein. Dies ermöglicht es Personen in der gleichen Situation, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, die gleiche rechtliche Behandlung zu genießen. Die Unionsbürgerschaft wird somit zu einem Instrument für die weitere Expansion des Diskriminierungsverbots.
Welches Problem wird in Bezug auf die Ausweitung des Diskriminierungsverbots und die Unionsbürgerschaft angesprochen?
Es wird in Frage gestellt, ob ein umfassender Gleichheitsgrundsatz vom gegenwärtigen „Gerüst“ des Gemeinschaftsrechts getragen werden kann, da die damit verbundenen finanziellen Belastungen der einzelnen Mitgliedsstaaten ein zentrales Problem darstellen.
- Quote paper
- Markus Ronnweber (Author), 2008, Hochschulzugang in Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114654