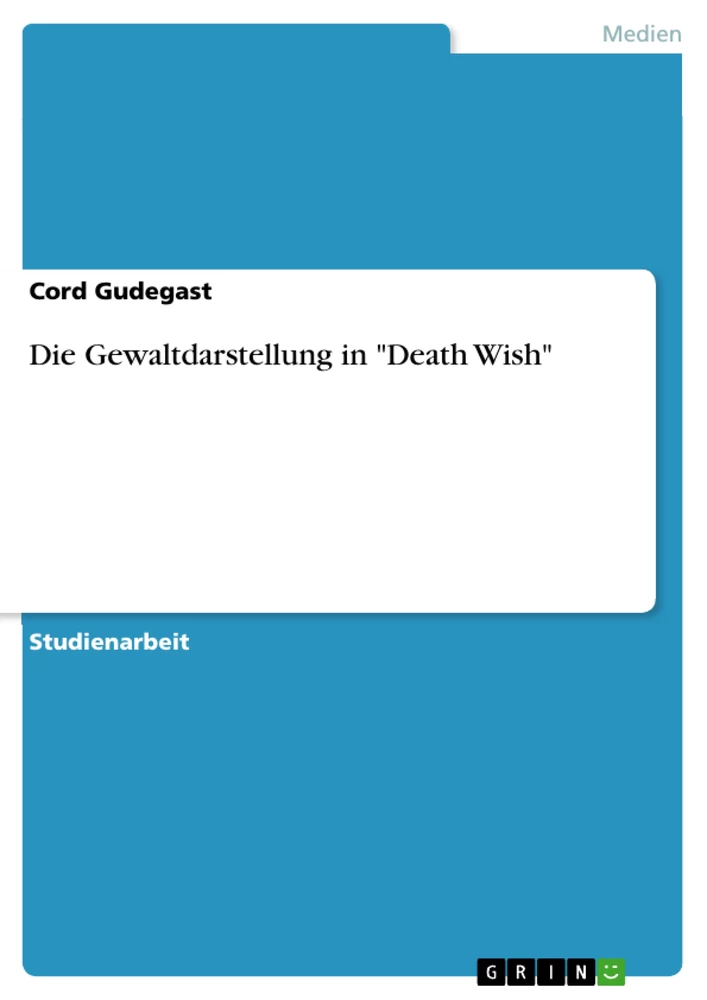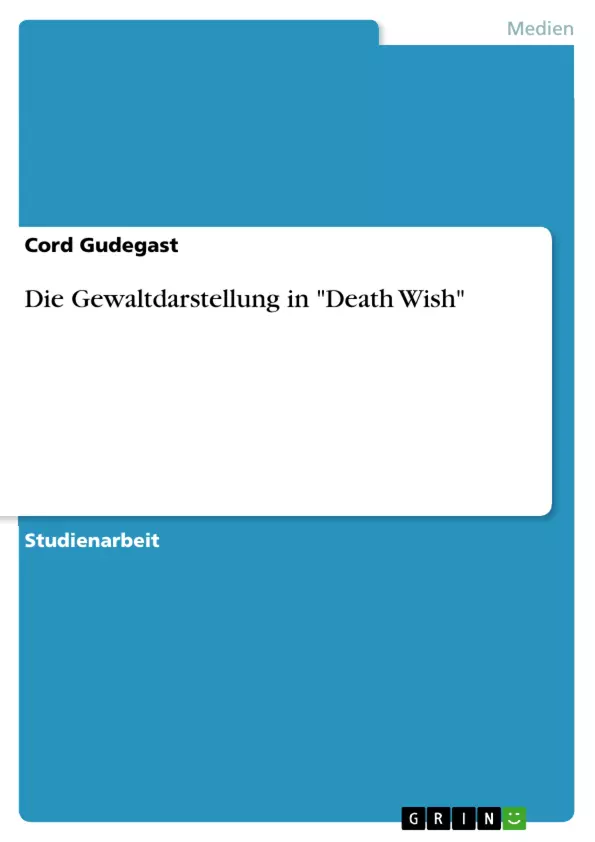Death Wish erschien im November 1974 mit über 50 Kopien in den deutschen Kinos(1) und sorgte für Stürme der Entrüstung in der Presse, die dem Film Gewaltverherrlichung, mangelnde Moral und Förderung faschistischem Gedankenguts vorwarfen. Die in ihm vertretene Ideologie “trifft auf ein Vakuum, das entstanden ist, nach dem liberale Illusionen über Staat, Gesellschaft und Recht (nach Watergate etc. pp.) verdunstet sind.”(2)
In der Tat ist Winners Film erschreckend eindimensional und voller Klischees. Dem Publikum wird mit voller Absicht jeder Anstoß zum kritischen Überdenken des Gezeigten vorenthalten. Aber die Moral des Filmes soll nicht das Thema dieser Arbeit sein, auch wenn man diesen Aspekt nicht ganz ausklammern kann. Statt dessen soll es um die Gewaltdarstellung gehen, denn immerhin ist der Film noch immer auf dem Index, was bedeutet, daß er nicht beworben werden darf und Personen unter 18 Jahren nicht zugänglich ist.
[...]
_____
1 Frankfurter Rundschau 1.11.1974
2 Eb.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Inhaltsangabe
- III. Die Vorgeschichte
- IV. Der Weg zum Rächer
- V. Der Rächer
- VI. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gewaltdarstellung in Michael Winners Film "Death Wish" von 1974. Der Fokus liegt auf der Analyse der filmischen Mittel, die zur Darstellung von Gewalt eingesetzt werden und deren Wirkung auf den Zuschauer. Die Arbeit beleuchtet den Kontext des Films, seine Entstehungszeit und die gesellschaftlichen Reaktionen auf ihn.
- Gewaltdarstellung und ihre filmische Umsetzung
- Der Protagonist als Rächer und seine Motivation
- Gesellschaftliche und politische Kontexte des Films
- Rezeption und Kritik des Films
- Moralische Ambivalenz der Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gewaltdarstellung in "Death Wish" ein und beschreibt die kontroversen Reaktionen auf den Film bei seiner Veröffentlichung. Sie hebt die eindimensionale Darstellung und die fehlende kritische Reflexion im Film hervor, betont aber, dass der Fokus der Arbeit auf der Gewaltdarstellung selbst und nicht auf der Moral des Films liegt. Der Indexstatus des Films wird als Ausgangspunkt für die Analyse genannt.
II. Inhaltsangabe: Diese Sektion fasst die Handlung von "Death Wish" zusammen. Der angesehene Architekt Paul Kersey wird Opfer eines brutalen Überfalls, bei dem seine Frau getötet und seine Tochter vergewaltigt wird. Die Ohnmacht der Polizei führt dazu, dass Kersey selbst zur Selbstjustiz greift, zahlreiche Kriminelle tötet und zum "Vigilante" wird. Obwohl seine Aktionen die Kriminalität reduzieren, wird er letztendlich von den Behörden aufgefordert, die Stadt zu verlassen.
III. Die Vorgeschichte: Dieser Abschnitt beschreibt den Kontrast zwischen der Idylle des Lebens von Paul Kersey vor dem Überfall und der brutalen Realität der Stadt New York. Es wird der Gegensatz zwischen Kerseys liberaler Einstellung und der konservativen Haltung seines Kollegen Sam Kreutzer herausgestellt. Die Szene im Supermarkt, in der drei Jugendliche randalieren und Kerseys Frau und Tochter als Opfer ausgewählt werden, bildet den Wendepunkt und bereitet den zentralen Konflikt des Films vor.
Schlüsselwörter
Gewaltdarstellung, Death Wish, Michael Winner, Selbstjustiz, Vigilante, Film Noir, gesellschaftliche Kritik, Moral, Rezeption, Kriminalität, Stadtgewalt.
Häufig gestellte Fragen zu "Death Wish" - Filmanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gewaltdarstellung im Film "Death Wish" (1974) von Michael Winner. Der Fokus liegt auf den filmischen Mitteln der Gewaltdarstellung und deren Wirkung auf den Zuschauer, sowie dem gesellschaftlichen Kontext des Films und den Reaktionen darauf.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die filmische Umsetzung von Gewalt, die Motivation des Protagonisten als Rächer, den gesellschaftlichen und politischen Kontext des Films, die Rezeption und Kritik des Films sowie die moralische Ambivalenz der Handlung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Inhaltsangabe, Die Vorgeschichte, Der Weg zum Rächer, Der Rächer und Zusammenfassung. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die kontroversen Reaktionen auf den Film. Die Inhaltsangabe fasst die Handlung zusammen. "Die Vorgeschichte" beschreibt den Kontrast zwischen Kerseys Leben vor und nach dem Überfall. Die Kapitel "Der Weg zum Rächer" und "Der Rächer" analysieren die Transformation des Protagonisten und seine Handlungen. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird die Gewalt im Film dargestellt?
Die Arbeit untersucht, welche filmischen Mittel eingesetzt werden, um Gewalt darzustellen und welche Wirkung diese auf den Zuschauer haben. Es wird jedoch betont, dass der Fokus auf der Darstellung der Gewalt und nicht auf der Moral des Films liegt.
Welche Rolle spielt der Protagonist?
Der Protagonist, Paul Kersey, ist ein angesehen Architekt, der Opfer eines brutalen Überfalls wird. Die Ohnmacht der Polizei und das Versagen des Rechtssystems führen dazu, dass er selbst zur Selbstjustiz greift und zum "Vigilante" wird. Die Arbeit analysiert seine Motivation und seine Transformation.
Welchen gesellschaftlichen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den gesellschaftlichen und politischen Kontext des Films, seine Entstehungszeit (1974) und die gesellschaftlichen Reaktionen auf ihn. Der Kontrast zwischen der Idylle von Kerseys Leben und der brutalen Realität der Stadt New York wird thematisiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gewaltdarstellung, Death Wish, Michael Winner, Selbstjustiz, Vigilante, Film Noir, gesellschaftliche Kritik, Moral, Rezeption, Kriminalität, Stadtgewalt.
Was ist der Indexstatus des Films und seine Bedeutung für die Analyse?
Der Indexstatus des Films wird als Ausgangspunkt für die Analyse genannt. Dies impliziert, dass der Film kontrovers diskutiert wurde und seine Gewaltdarstellung als problematisch angesehen wurde.
- Quote paper
- Cord Gudegast (Author), 1995, Die Gewaltdarstellung in "Death Wish", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1146