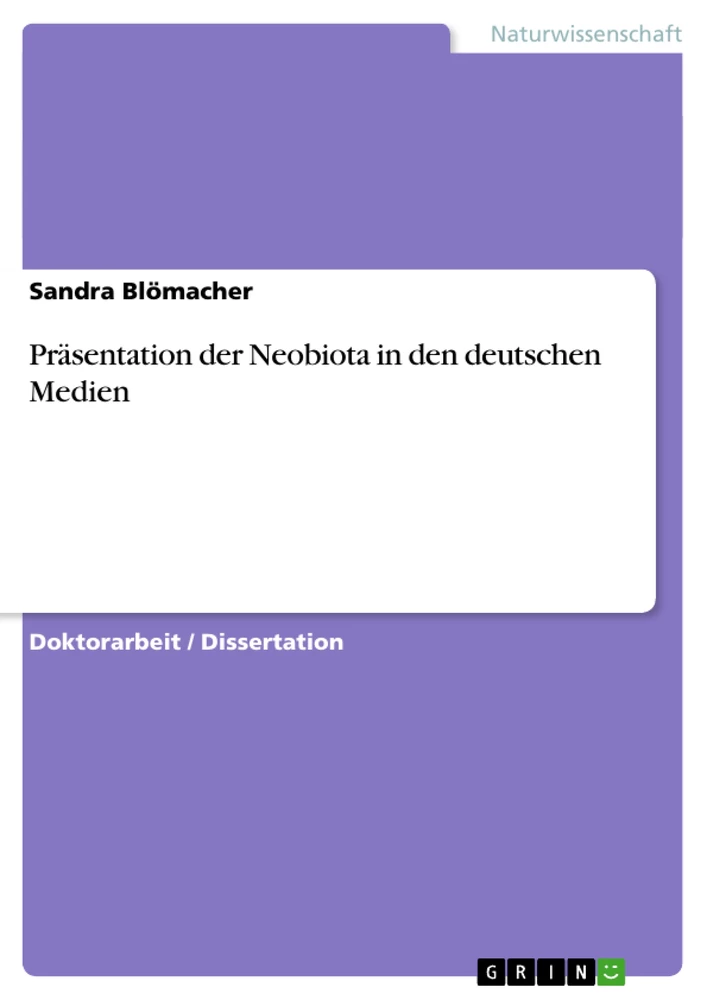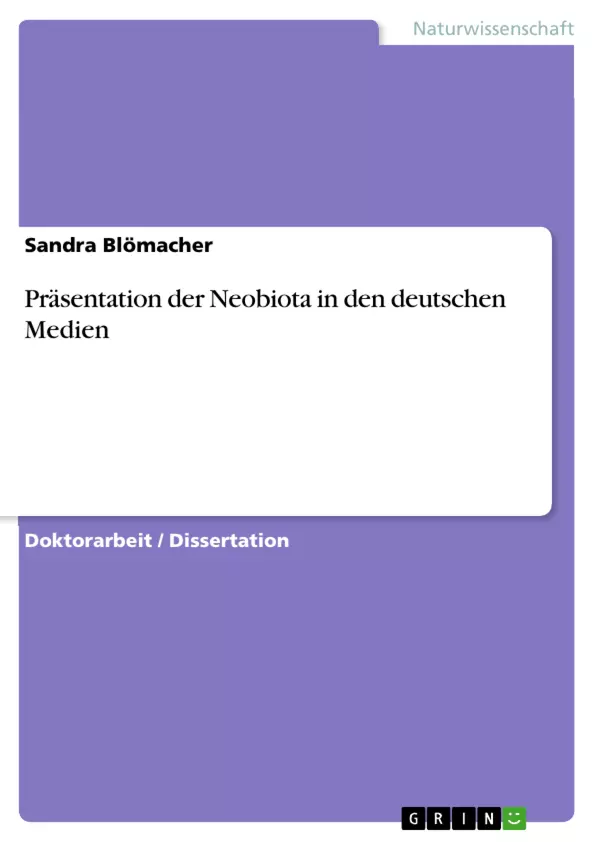Fremdländische Pflanzen und Tiere wurden schon immer wahrgenommen und als neuartig und unerwartet in den jeweiligen Heimatländern einer einheimischen Flora und Fauna registriert. Mit dem Beginn der Erschließung bisher unbekannter Kontinente und Territorien, besonders seit dem Jahr 1492, haben sich Mittel, Distanzen und Wege des Transports für fremdländische Organismen verändert. Zunächst wurden jedoch lediglich spektakuläre Einzelfälle vermerkt und mancher Neuling sogar aus wirtschaftlichen, garten- oder landschaftsbaulichen oder rein ästhetischen Gründen importiert bzw. exportiert. Pflanzen und Tiere wurden oftmals als Kuriosa von Entdeckungsreisen mitgebracht und galten als Sensation in den botanischen und zoologischen Gärten (KINZELBACH 2001, KOWARIK 2003, NIETHAMMER 1963). Im letzten Drittel des 20. Jh. bekam das Phänomen einen anderen Stellenwert. Die Zahl der registrierten Fälle vor allem unbeabsichtigt transportierter Arten verdichtete sich weltweit. Mit dem Beginn des Zeitalters der Globalisierung von Wirtschaft, Wissenschaft, Handel und dem Einsetzen des Massentourismus hatte die Überführung von Lebewesen aus ihren Heimatarealen in andere Regionen der Erde eine neue Dimension erreicht. In einigen Ländern (z. B. Hawaii, Australien, Neuseeland) führten „invasive Arten“ zu erheblichen ökologischen Schäden, mitunter zum Verlust von Arten bzw. ganzer Artengemeinschaften (KEGEL 1999). Seit der Konferenz von Rio de Janeiro (1992) zum Schutz der globalen Artenvielfalt ist klar, dass die Vermischung exotischer Flora und Fauna mit jeweils einheimischen Beständen eine Kaskade von negativen Auswirkungen nach sich zieht. Die Einbringung von „neobiotischen“ Organismen gilt neben der Habitatzerstörung als eine der schwerwiegendsten Bedrohungen der globalen Artenvielfalt (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (BFN) 2001, EHLERS (WWF) 2001, GROSVENOR et al. 2002, HURKA 2000, KINZELBACH 1995, WILSON 1992 u. 2002). Aufgrund dieser Tatsache stellt das Phänomen der „Neobiota“ oder der „Invasiven Arten“ (vgl. Kap. 2.1 u. Glossar) eine für das Ökosystem und den wirtschaftenden Menschen sehr praktische und greifbare Bedrohung dar. Es handelt sich nicht länger um ein Phänomen, das lediglich von der Fachwissenschaft registriert und behandelt wird, sondern tritt zunehmend in das Blickfeld der Öffentlichkeit. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Neobiota oder Invasive Arten? – Ein Überblick
- 2.1 Definition der Begriffe „Neobiota“, „invasive Arten“ und „Exoten“
- 2.2 Die Entwicklung der Wahrnehmung und Darstellung von Neobiota
- 2.3 Zur Auswirkung der Neobiota auf die Artenvielfalt
- 2.3.1 Neobiota als Ursache für die Veränderung der globalen Artenvielfalt
- 2.3.2 Veränderungen heimischer Flora und Fauna durch Neobiota
- 2.3.3 Die Vielfalt der Vorstellungen zu Neobiota
- 3 Material und Methoden
- 3.1 Gewinnung der Materialien
- 3.2 Auswertung der Materialien
- 4 Zur Präsentation der Neobiota in den deutschen Medien
- 4.1 Häufigkeit der Medienbeiträge zu Neobiota
- 4.1.1 Häufigkeit der Beiträge in allen Medien
- 4.1.2 Häufigkeit der Beiträge differenziert nach Medien
- 4.1.3 Zusammenfassung
- 4.2 Die zeitlichen Ursachen für Medienbeiträge zu Neobiota
- 4.3 Die Vorstellungen von Neobiota in den Medienbeiträgen
- 4.1 Häufigkeit der Medienbeiträge zu Neobiota
- 5 Zum Inhalt der Medienbeiträge über Neobiota
- 5.1 Wie glaubwürdig bzw. sachlich sind die Medienberichte?
- 5.2 Zur Inhaltsanalyse von Medienbeiträgen
- 5.3 Der Adressat
- 6 Schlussfolgerungen und Ausblick
- 6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6.2 Schlussfolgerungen
- 6.3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht die Darstellung von Neobiota in deutschen Medien. Ziel ist es, die Häufigkeit, den zeitlichen Verlauf und die inhaltliche Gestaltung der Berichterstattung zu analysieren und die Vorstellungen von Neobiota in den Medien zu ergründen. Die Arbeit bewertet auch die Glaubwürdigkeit und Sachlichkeit der Medienbeiträge im Vergleich zum wissenschaftlichen Kenntnisstand.
- Häufigkeit und zeitliche Verteilung von Medienbeiträgen zu Neobiota
- Analyse der inhaltlichen Darstellung von Neobiota in verschiedenen Medien
- Bewertung der Glaubwürdigkeit und Sachlichkeit der Medienberichte
- Untersuchung der Vorstellungen von Neobiota in der Öffentlichkeit, vermittelt durch die Medien
- Identifizierung von Faktoren, die die Berichterstattung beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Neobiota ein und beschreibt die historische Entwicklung der Wahrnehmung und des Umgangs mit fremdländischen Pflanzen und Tieren. Sie betont die zunehmende Bedeutung des Themas im Kontext der Globalisierung und des Artenverlusts und führt die Forschungslücke und die wachsende Bedeutung der Medienberichterstattung aus.
2 Neobiota oder Invasive Arten? – Ein Überblick: Dieses Kapitel liefert grundlegende Definitionen der Begriffe „Neobiota“, „invasive Arten“ und „Exoten“. Es beleuchtet die Entwicklung der Wahrnehmung und Darstellung von Neobiota, die Auswirkungen auf die Artenvielfalt, und die unterschiedlichen Vorstellungen zum Thema. Es etabliert die terminologische Basis und den Kontext des Forschungsprojekts.
3 Material und Methoden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methoden der Datenerhebung und -auswertung für die Dissertation. Es legt dar, wie die Medienbeiträge ausgewählt und analysiert wurden, um die wissenschaftliche Fundiertheit der Studie sicherzustellen und die Methodik nachvollziehbar zu machen.
4 Zur Präsentation der Neobiota in den deutschen Medien: Dieses Kapitel analysiert die Häufigkeit der Medienbeiträge zu Neobiota und untersucht zeitliche Muster in der Berichterstattung. Es differenziert die Häufigkeit nach verschiedenen Medien und identifiziert potenzielle Einflussfaktoren wie wissenschaftliche Erkenntnisse, wirtschaftliche Interessen oder saisonale Effekte ("Sommerloch").
5 Zum Inhalt der Medienbeiträge über Neobiota: Dieses Kapitel befasst sich mit der inhaltlichen Analyse der Medienbeiträge, bewertet deren Glaubwürdigkeit und Sachlichkeit im Vergleich zum wissenschaftlichen Kenntnisstand und untersucht die Art und Weise der Darstellung von Neobiota in den Medien. Es analysiert die Berichterstattung über einzelne Arten exemplarisch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Dissertation: Darstellung von Neobiota in deutschen Medien
Was ist das Thema dieser Dissertation?
Die Dissertation untersucht die Darstellung von Neobiota in deutschen Medien. Sie analysiert die Häufigkeit, den zeitlichen Verlauf und die inhaltliche Gestaltung der Berichterstattung und ergründet die Vorstellungen von Neobiota in den Medien. Ein weiterer Fokus liegt auf der Bewertung der Glaubwürdigkeit und Sachlichkeit der Medienbeiträge im Vergleich zum wissenschaftlichen Kenntnisstand.
Welche Aspekte der Medienberichterstattung werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Häufigkeit und zeitliche Verteilung von Medienbeiträgen zu Neobiota, untersucht die inhaltliche Darstellung in verschiedenen Medien, bewertet die Glaubwürdigkeit und Sachlichkeit der Berichte und erforscht die in den Medien vermittelten Vorstellungen von Neobiota in der Öffentlichkeit. Zusätzlich werden Faktoren identifiziert, die die Berichterstattung beeinflussen könnten.
Welche Begriffe werden definiert und wie werden sie im Kontext der Arbeit verwendet?
Die Dissertation definiert die Begriffe „Neobiota“, „invasive Arten“ und „Exoten“ und beleuchtet deren Entwicklung in der Wahrnehmung und Darstellung. Diese Definitionen bilden die terminologische Grundlage für die gesamte Analyse.
Wie werden die Daten erhoben und ausgewertet?
Das Kapitel "Material und Methoden" beschreibt detailliert die Methoden der Datenerhebung und -auswertung. Es wird erläutert, wie die Medienbeiträge ausgewählt und analysiert wurden, um die wissenschaftliche Fundiertheit der Studie sicherzustellen und die Methodik nachvollziehbar zu machen.
Welche Ergebnisse werden in Bezug auf die Häufigkeit der Medienbeiträge präsentiert?
Die Dissertation analysiert die Häufigkeit von Medienbeiträgen zu Neobiota und untersucht zeitliche Muster in der Berichterstattung. Es wird differenziert nach verschiedenen Medien und es werden potenzielle Einflussfaktoren identifiziert.
Wie wird die Glaubwürdigkeit und Sachlichkeit der Medienbeiträge bewertet?
Die Arbeit bewertet die Glaubwürdigkeit und Sachlichkeit der Medienbeiträge im Vergleich zum wissenschaftlichen Kenntnisstand. Die Inhaltsanalyse der Medienbeiträge ist ein zentraler Bestandteil dieser Bewertung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Dissertation?
Die Dissertation fasst die Ergebnisse zusammen, zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse und bietet einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen. Das Fazit gibt eine umfassende Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Welche Kapitel umfasst die Dissertation?
Die Dissertation gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Neobiota oder Invasive Arten? – Ein Überblick, Material und Methoden, Zur Präsentation der Neobiota in den deutschen Medien, Zum Inhalt der Medienbeiträge über Neobiota und Schlussfolgerungen und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik.
Für wen ist diese Dissertation relevant?
Diese Dissertation ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Neobiota, invasiven Arten, Medienwissenschaft und der öffentlichen Wahrnehmung wissenschaftlicher Themen beschäftigen. Sie ist auch für Personen von Interesse, die sich für den Umgang mit Umweltproblemen und die Rolle der Medien in der öffentlichen Meinungsbildung interessieren.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die vollständige Dissertation bietet eine detaillierte und umfassende Analyse der Thematik. Weitere Informationen können in der vollständigen Arbeit gefunden werden.
- Citation du texte
- Dr. Sandra Blömacher (Auteur), 2006, Präsentation der Neobiota in den deutschen Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114715