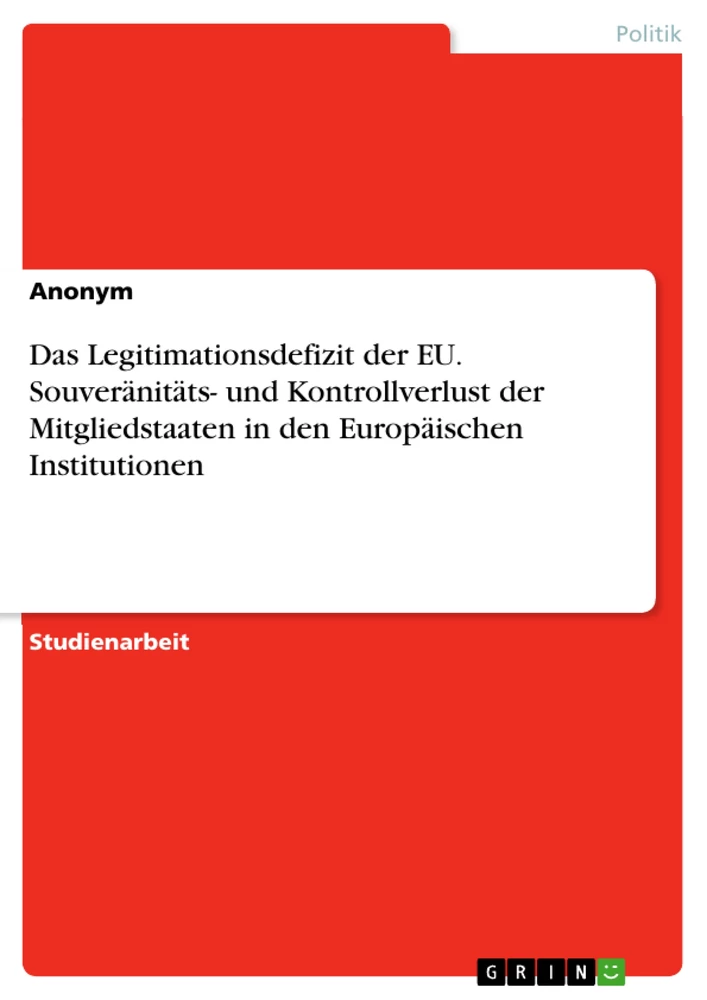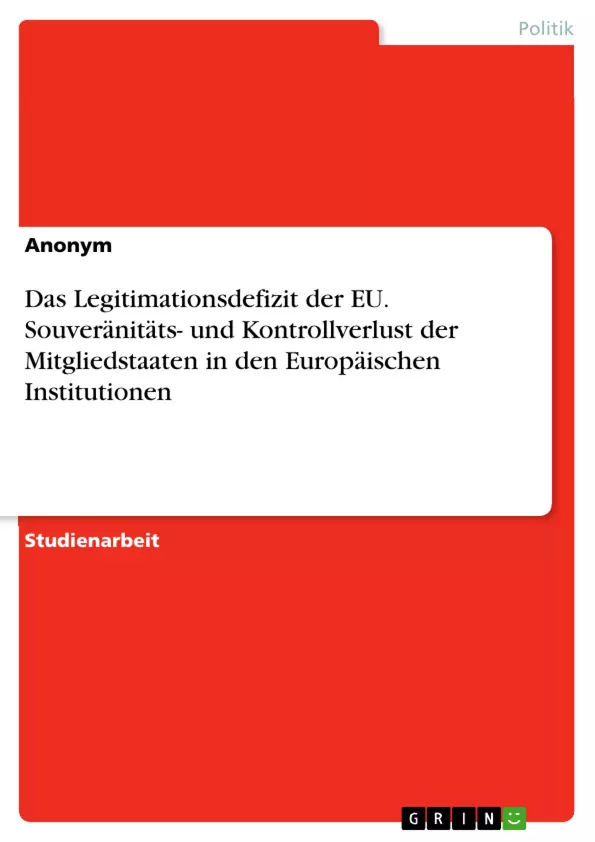Die Arbeit behandelt die Frage, inwiefern die Europäische Union ein Legitimationsdefizit im Sinne einer Untergrabung der Souveränität der einzelnen Mitgliedstaaten durch die EU-Institutionen aufweist.
Geklärt wird, ob und inwiefern die Konstitution, der Aufbau und das Verhalten der Europäischen Institutionen zur Legitimität der supranationalen EU beiträgt bzw. inwiefern die Souveränität der Nationalstaaten, die in der Arbeit definiert wird, durch die EU beeinträchtigt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Die Notwendigkeit der Legitimation der EU.
- Gesellschaftliche und wissenschaftliche Relevanz..
- Fragestellung.......
- Methodisches Vorgehen und Forschungsstand……....
- Beeinträchtigungen der Legitimität der europäischen Institutionen......
- Konzepte zur Theoretisierung von Legitimität...\n
- Souveränität und Rechtstaatlichkeit....
- Multi-level-model.....
- Europäisches Entscheidungssystem..\n
- Luxemburger Kompromiss....
- Der Rat der Europäischen Union……
- Das Europäische Parlament.....
- Die Europäische Kommission....
- Der Europäische Gerichtshof..\n
- Der Europäische Rat und die EZB..\n
- Konzepte zur Theoretisierung von Legitimität...\n
- Zusammenfassung und Bewertung der Erkenntnisse……
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern die Europäische Union (EU) ein Legitimationsdefizit im Sinne einer Untergrabung der Souveränität der Mitgliedstaaten durch die EU-Institutionen aufweist. Sie analysiert die Konstitution, den Aufbau und das Verhalten der europäischen Institutionen und bewertet, ob diese zur Legitimität der supranationalen EU beitragen oder ob die Souveränität der Nationalstaaten durch die EU beeinträchtigt wird.
- Legitimitätsdefizit der EU
- Beeinträchtigung der Souveränität der Mitgliedstaaten
- Konstitution und Aufbau der europäischen Institutionen
- Verhalten der europäischen Institutionen
- Bewertung der Legitimität der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Notwendigkeit der Legitimation der EU im Kontext aktueller Krisen und Herausforderungen wie der Finanzkrise, der Sozialkrise, dem Aufstieg populistischer Bewegungen und dem Brexit. Es diskutiert die gesellschaftliche und wissenschaftliche Relevanz des Themas, stellt die Fragestellung der Arbeit dar und skizziert das methodische Vorgehen sowie den Forschungsstand.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Beeinträchtigungen der Legitimität der europäischen Institutionen. Es analysiert zunächst verschiedene Konzepte zur Theoretisierung von Legitimität, darunter die Begriffe der Souveränität und der Rechtstaatlichkeit, sowie das Multi-Level-Modell. Im Anschluss werden die einzelnen europäischen Institutionen, wie der Rat der Europäischen Union, das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, der Europäische Gerichtshof und der Europäische Rat, im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Legitimität der EU untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen Legitimität, Souveränität, Rechtstaatlichkeit, Europäische Institutionen, Entscheidungsfindung, Konstitution, und Multi-Level-Modell. Im Fokus steht die Analyse der europäischen Institutionen und deren Einfluss auf die Legitimität der EU.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Legitimationsdefizit der EU?
Es beschreibt die Frage, ob die EU-Institutionen die Souveränität der Mitgliedstaaten untergraben und ob das politische System der EU ausreichend demokratisch legitimiert ist.
Welche Rolle spielt die Souveränität in dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert, inwiefern die nationalstaatliche Souveränität durch supranationale Entscheidungen der EU-Organe eingeschränkt oder beeinträchtigt wird.
Welche EU-Institutionen werden untersucht?
Untersucht werden unter anderem der Rat der EU, das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, der Europäische Gerichtshof sowie die EZB.
Was ist der Luxemburger Kompromiss?
Er ist Teil des europäischen Entscheidungssystems und wird im Kontext der historischen Entwicklung der EU-Legitimität und Entscheidungsfindung betrachtet.
Wie beeinflussen Krisen wie der Brexit die Legitimität der EU?
Krisen wie der Brexit oder die Finanzkrise verstärken die gesellschaftliche Relevanz der Frage nach der Notwendigkeit und der Form der EU-Legitimation.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Das Legitimationsdefizit der EU. Souveränitäts- und Kontrollverlust der Mitgliedstaaten in den Europäischen Institutionen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1147428