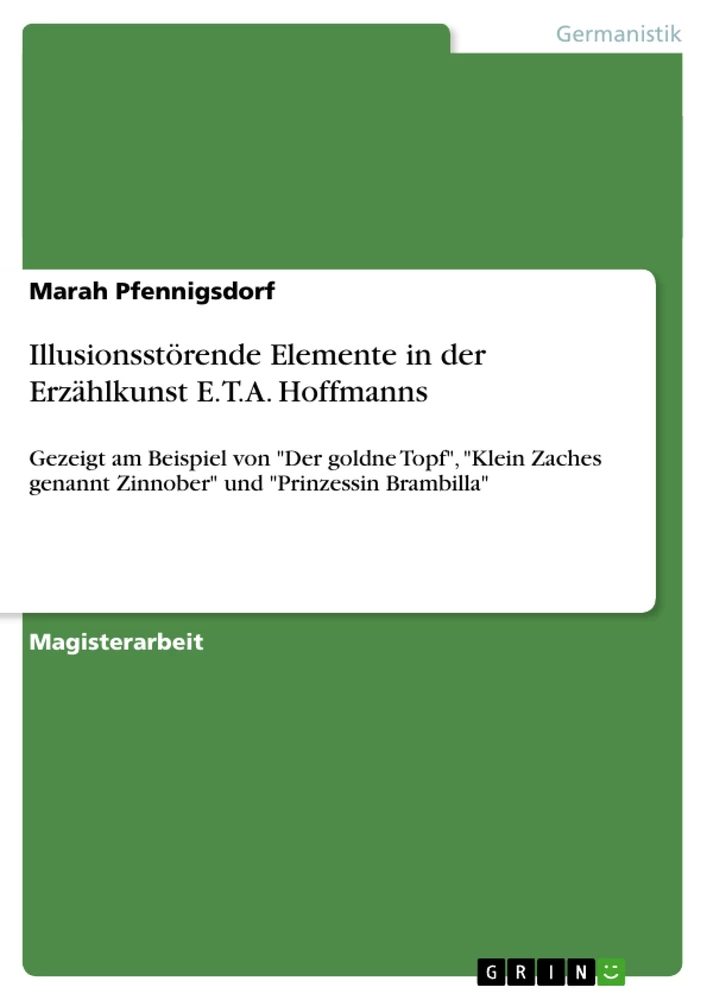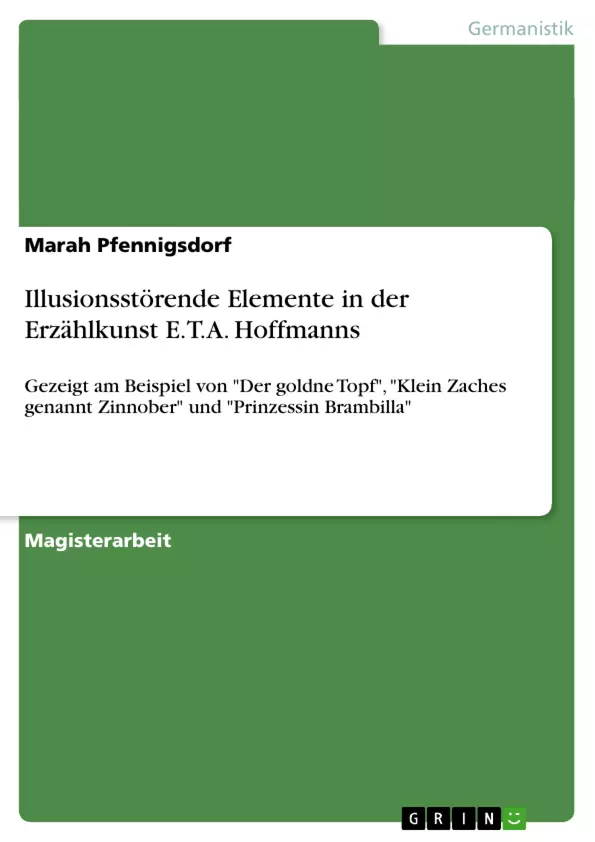Fiktive Texte erzeugen eine Illusion, die umso mächtiger ist, je konsistenter und wahrscheinlicher die erzählte Welt bezüglich der lebensweltlichen Erfahrung des Rezipienten gestaltet ist. Bei der Etablierung einer möglichst perfekten Illusion spielt darüber hinaus vor allem die Unauffälligkeit der Vermittlung eine große Rolle; der Fokus soll auf dem Dargestellten und nicht auf den Darstellungsmitteln liegen, denn sobald die sogenannten Darstellungsmittel für den Rezipienten offensichtlich werden, entsteht eine illusionsstörende Distanz zum Erzählinhalt. Neben den textseitigen Voraussetzungen hängt das Gelingen der Fiktion, also der Aufbau einer wie auch immer gearteten Illusion, wesentlich von der Rezeptionsleistung des Lesers ab. Der englische Literaturkritiker Samuel T. Coleridge hat in diesem Zusammenhang den Ausdruck Willing Suspension of Disbelief geprägt, der verstanden wird als „Rezeptionsmodus im Rahmen der Nutzung narrativer fiktionaler Medienangebote, bei dem der Rezipient Handlungskonsistenz und Wirklichkeitsnähe des fiktionalen Medieninhalts nicht kritisch hinterfragt, bzw. entsprechende Brüche und Verletzungen nicht beachtet.“1 Mit anderen Worten: der Rezipient unterdrückt bei der Rezeption von fiktiven Medieninhalten, z.B. narrativen Texten, bewusst oder unbewusst störende Informationen, um sein Rezeptionsziel zu erreichen. Der Rezipient ist demnach an einer ästhetischen Illusionierung interessiert und deshalb bereit, über illusionsstörende Details hinwegzusehen.
Doch bis zu welchem Grad können Irritationen ausgeblendet werden, und wann ist die Toleranz gegenüber störender Faktoren insofern erreicht, als dass ein tatsächlicher disbelief bezüglich des Dargestellten eintritt? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungslage
- Zu den Begriffen Erzähler und Leser
- Theoretischer Hintergrund
- Die ästhetische Illusion. Ein Überblick.
- Illusionsfördernde und illusionsstörende Strategien in der Erzählkunst
- Textanalyse
- Explizite Metafiktion
- Die direkte Leseranrede
- Interferenz der Erzählebenen
- Multiperspektivisches Erzählen
- Unzuverlässiges Erzählen
- Komisches Erzählen als distanzaktualisierendes Darstellungsmittel
- Literatur und Karneval/Groteske Darstellung
- Satire
- Ironie
- Humor
- Fazit: Konsequenz der illusionsstörenden Erzählweise
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Analyse der illusionsstörenden Elemente in der Erzählkunst E.T.A. Hoffmanns. Ziel ist es, die verschiedenen Erzählstrategien des Autors systematisch auf ihre Wirkung hin zu untersuchen und zu beleuchten, wie sie die Illusion der erzählten Welt beeinflussen. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf drei exemplarische Texte: Der goldne Topf, Klein Zaches genannt Zinnober und Prinzessin Brambilla.
- Die Rolle des Erzählers in der Konstruktion der erzählten Welt
- Die Verwendung von metafiktionalen Elementen und deren Einfluss auf die Leserezeption
- Die Analyse von verschiedenen Erzählstrategien, die zur Störung der Illusion beitragen, wie z.B. direkte Leseranrede, Interferenz der Erzählebenen, multiperspektivisches Erzählen und unzuverlässiges Erzählen
- Die Bedeutung von komischem Erzählen als distanzaktualisierendes Darstellungsmittel
- Die Konsequenzen der illusionsstörenden Erzählweise für die Interpretation der Texte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der illusionsstörenden Elemente in der Erzählkunst ein und beleuchtet die Relevanz des Themas. Sie stellt den theoretischen Rahmen der Arbeit vor und definiert die zentralen Begriffe wie Erzähler, Leser und ästhetische Illusion. Die Forschungslage analysiert die bisherige Forschung zu E.T.A. Hoffmann und der illusionsstörenden Erzählweise.
Das Kapitel "Theoretischer Hintergrund" beschäftigt sich mit der ästhetischen Illusion und den verschiedenen Strategien, die in der Erzählkunst zur Förderung oder Störung der Illusion eingesetzt werden. Es werden verschiedene Ansätze zur Definition der ästhetischen Illusion vorgestellt und die Bedeutung der "Willing Suspension of Disbelief" für die Leserezeption erläutert.
Das Kapitel "Textanalyse" analysiert die drei ausgewählten Texte von E.T.A. Hoffmann auf ihre illusionsstörenden Elemente. Es werden verschiedene Strategien untersucht, wie z.B. explizite Metafiktion, die direkte Leseranrede, Interferenz der Erzählebenen, multiperspektivisches Erzählen und unzuverlässiges Erzählen.
Das Kapitel "Komisches Erzählen als distanzaktualisierendes Darstellungsmittel" befasst sich mit der Rolle von Humor, Satire und Ironie in den Texten. Es wird untersucht, wie diese Elemente die Illusion der erzählten Welt stören und die Distanz zum Leser erhöhen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die illusionsstörende Erzählweise, E.T.A. Hoffmann, Metafiktion, Leseranrede, Interferenz der Erzählebenen, multiperspektivisches Erzählen, unzuverlässiges Erzählen, komisches Erzählen, Humor, Satire, Ironie, ästhetische Illusion, "Willing Suspension of Disbelief", Der goldne Topf, Klein Zaches genannt Zinnober und Prinzessin Brambilla.
- Arbeit zitieren
- Marah Pfennigsdorf (Autor:in), 2008, Illusionsstörende Elemente in der Erzählkunst E.T.A. Hoffmanns, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114797