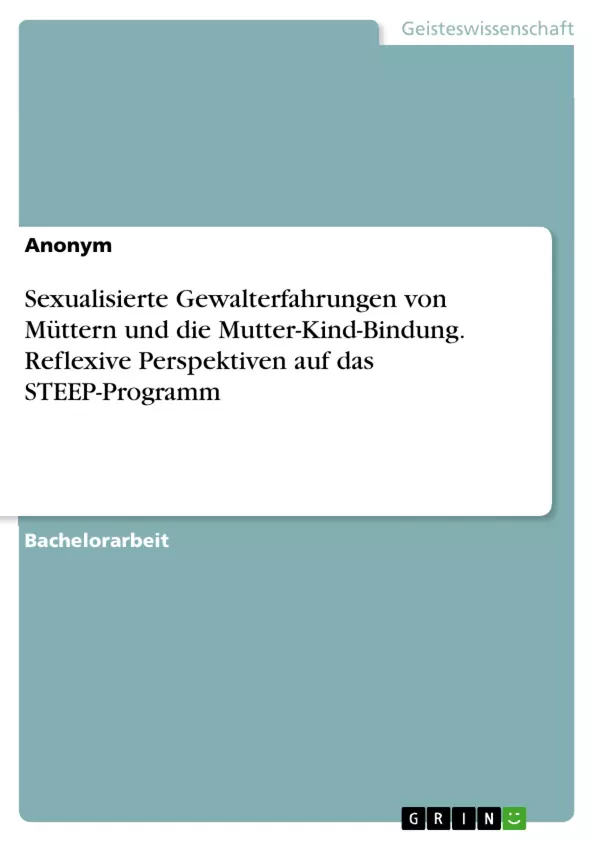In vorliegender Ausarbeitung wurde der Fragestellung nachgegangen, inwiefern grundlegende Annahmen des bindungstheoretisch fundierten Frühinterventionsprogramms STEEP (Steps Toward Effective and Enjoyable Parenting) einer idealisierten Norm entsprechen und welche dahingehenden Grenzen und Leerstellen innerhalb der Konzeption erfasst werden können.
Ziel war es, durch die Beantwortung der Fragestellung theoretische Rückschlüsse für Hilfs- und Beratungsangebote zu generieren, um Versorgungslücken im Hilfssystem für Frauen mit sexualisierten Gewalterfahrungen zu minimieren. Dafür wurde das STEEP-Programm in Anlehnung an Ergebnissen von Milena Nolls Studie "Sexualisierte Gewalt und Erziehung – Auswirkungen familialer Erfahrungen auf die Mutter-Kind-Beziehungen" und dem allgemeinen Forschungsstand zu sexualisierter Gewalt analysiert. Zudem wurden grundlegende Annahmen der klassischen Bindungstheorie nach Bolwby und Ainsworth, insbesondere das erzeugte Mutterbild, kritisch untersucht.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
2 Sexualisierte Gewalt an Frauen
2.1 Definition, Einordnung und Prävalenz
2.2 Auswirkungen sexualisierter Gewalt
2.2.1 SozialeAuswirkungen
2.2.2 Psychopathologische Auswirkungen
2.2.3Transgenerationale Auswirkungen
2.3 Bewältigung,Aufdeckung, Intervention
3 Die Mutter-Kind-Bindung nach Bowlby/Ainsworth
3.1 Grundannahmen der Bindungstheorie
3.1.1 Die FremdeSituation
3.1.2 Skalen mütterlicher(Un-)Feinfühligkeit
3.2 Das Mutterbild der Bindungstheorie
4 Das bindungstheoretische Interventionsprogramm STEEP™
4.1 Zielevon STEEP™
4.2 Methoden von STEEP™
4.2.1 Die Strategien der STEEP™-Beraterin
4.2.2 Die Seeing is Believing™-Strategie
4.2.3 Hausbesuche und Gruppentreffen
5 Reflexive Perspektiven auf das STEEP™-Programm
5.1 Sexualisierte Gewalt und die Mutter-Kind-Beziehung: Ergebnisse aus einer Fallstudie von Milena Noll (2013)
5.2 Sexualisierte Gewalt, Bindung und STEEP™: Untersuchung des Interventionskonzeptes
5.2.1 Herausarbeitung konzeptioneller Leerstellen von STEEP™
5.2.2 Theoretische Rückschlüsse für Hilfs- und Beratungsstellen
6 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Inhaltshinweise
Die nachfolgende Arbeit enthält Schilderungen über sexualisierte Gewalt und Nötigung, die belastend und retraumatisierend wirken können. Ist bekannt, dass bestimmte Begriffe triggernd wirken oder herrscht Unsicherheit hinsichtlich dessen, sollte die vorliegende Ausarbeitung zur Sicherheit von einer vertrauten Person gegengelesen werden; dies trifft insbesondere auf die Kapitel zwei und fünf zu.
Sofern der Begriff „Frau" in einem bestimmten Zusammenhang nicht explizit und gesondert definiert wird, sind nicht nur biologische, sondern auch sozial konstruierte Dimensionen von Geschlecht gemeint. In dem Zusammenhang wird innerhalb der Arbeit eine Schreibweise mit dem „Binnen-I" genutzt (z.B.: Forscherinnen). Dies soll eine geschlechtergerechte Formulierung gewährleisten, in der verschiedene Geschlechtsidentitäten, wie divers, männlich, weiblich oder andere, gleichermaßen in die Sprache miteinbezogen werden.
1 Einführung
In der Erziehungswissenschaft ist die Thematik der sexualisierten Gewalt stark umstritten und Gegenstand zahlreicher Fachdiskussionen. Die Definition eines einheitlichen Gewaltbegriffs stellt die empirische Forschung vor eine große Herausforderung, da in den einzelnen Studien sowohl Forschungsfragen, als auch Methodiken teilweise erheblich voneinander abweichen (vgl. Glammeier 2018: 102). In den Studienergebnissen um sexualisierte Gewalt sticht allerdings hervor, dass die Tatpersonen weitgehend männlichen Geschlechts sind, während Betroffene sexualisierter Gewalt häufiger weiblich sind (vgl. ebd.). Dies mag auch der Grund dafür sein, dass das Problem der sexualisierten Gewalt erst mit der Entstehung der Neuen Frauenbewegung1 in den 1970er Jahren in das Blickfeld des öffentlichen Interesses rückte und als eine Form von Gewalt akzeptiert wurde (vgl. Helfferich/Kave- mann/Kindler 2016: 1; Hagemann-White 2001: 23). Seither hat die Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt phasenweise abwechselnde Hoch- und Tiefpunkte erreicht (vgl. Bange 2018a: 32). Werke wie „Schwarze Pädagogik" (1 977) von Katharina Rutschky haben das Verständnis von Gewalt und ihrer Duldung innerhalb der Pädagogik in den Fokus der Betrachtung gerückt und damit im historischen Verlauf eine Wandlung hinsichtlich analytischer Aufarbeitungsprozesse verursacht (vgl. ebd.). Allmählich wird auch in medialen Berichten und politischen Debatten nicht mehr nur von Einzelfällen ausgegangen; zuvor wurde „sexualisierte Gewalt mit biografischen Irrläufern" (Oelkers 2018: 53) zusammengebracht und wie ein soziales Randproblem behandelt. Die Debatte flammte im Jahre 2010 erneut auf, als Fälle von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in hochetablierten Institutionen, wie dem Berliner Canisius-Kolleg oder dem Kloster Ettal, aufgedeckt wurden (vgl. Bange 2018a: 32). Seitdem werden Fragen darüber aufgeworfen, welchen Verantwortungsbereichen die Erziehungswissenschaft im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt unterliegt oder wie Aufarbeitungsprozesse vorangetrieben werden können (vgl. Andresen/Demant 2017: 39). Dazu gehört unter anderem, ungleiche Macht- und Geschlechterverhältnisse aufzudecken und sexualisierte Gewalttaten in pädagogischen Einrichtungen und Institutionen näher zu beleuchten. Doch nicht nur die allgemeine pädagogische Grundhaltung sollte Gegenstand von Reflexionsverfahren sein, sondern auch die sprachlichen Mittel, die in diesem Kontext genutzt werden.
Die Frage der Schuld geht Hand in Hand mit der An- oder Aberkennung des erlebten Unrechts. Verharmlosungen oder Relativierungsversuche führen dazu, dass bestimmte sexualisierte Gewaltformen von der Gesellschaft als „Kavaliersdelikt" abgetan und Betroffene mit ihren Gedanken und Gefühlen alleine gelassen werden. Die Frauenbewegung der 1970er Jahre hat maßgeblich dazu beigetragen, dass seit den 1980er Jahren zahlreiche Fachberatungsstellen entstanden sind, die sich auf sexualisierte Gewalthandlungen spezialisieren (Noll 2016: 678). Noll erkennt in ihrer Fallstudie (2013), dass Frauenberatungsstellen und Psychotherapien von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen zwar unterstützen, dabei aber die Mutter-Kind-Beziehung sowie das Alltagsleben oftmals nicht thematisieren. Familienhelferinnen bieten alltägliche Hilfe, berücksichtigen dabei jedoch die psychopathologischen Auswirkungen von sexualisierter Gewalt nicht. Noll verdeutlicht den dahingehenden Forschungsbedarf (vgl. ebd.: 683) und widmet sich ebenfalls der Frage, wie tradierte Geschlechterord- nungen, die betroffene Frauen in der Erziehung zu ihren eigenen Kindern teilweise reproduzieren, überwunden werden können (vgl. Noll 2013: 257). Angesichts dieser Aspekte, sei es von Bedeutung, nach neuen Ansätzen zu suchen, die sich dieser Defizite annehmen.
Kinder von Eltern, die sexualisierten Gewaltübergriffen ausgesetzt waren und sich mit einer daraus folgenden Traumatisierung kaum bis gar nicht auseinandergesetzt haben, sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, sich nicht angemessen entwickeln zu können, da die elterliche Erziehung ein entscheidendes Kriterium für das körperliche und seelische Wohlergehen eines Kindes ist (vgl. Cierpka 2005: 59; Ziegenhain 2007: 662). Dies macht sich dadurch bemerkbar, dass Eltern unter bestimmten Bedingungsfaktoren ihre traumatischen Folgesymptome unterschwellig an ihre Kinder weitergeben (vgl. Cierpka 2005: 92) und auch die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens sexualisierte Gewalt erleiden zu müssen, transgenerational überliefert werden kann (vgl. Lohaus/Heinrichs/Konrad 2018: 854). Kindheitserfahrungen sind eng mit dem Wohlbefinden im Erwachsenenalter verknüpft, weshalb es erforderlich ist, psychosoziale Belastungen und dysfunktionale Umweltbedingungen im Kindheitsalterweitgehend zu vermeiden (vgl. Cierpka 2005: 59).
Wissenschaftliche Erkenntnisse über das kindliche Gehirn und die enorme Beeinflussbarkeit von dessen Strukturen in den ersten Lebensjahren (vgl. Hüther 2007: 40), lassen darauf schließen, dass präventive Maßnahmen möglichst schon in der frühen Kindheit ansetzen sollten (vgl. ebd.: 60). Die Bindungsforschung hat inzwischen zahlreiche Belege dafür erbracht, dass eine desorganisierte Bindung im ersten Lebensjahr die zukünftige psychosoziale Entwicklung eines Kindes gefährdet (vgl. Kißgen/Suess 2005: 10). Dieses Bindungsmuster präge sich vornehmlich insbesondere bei Kindern einer Hoch-Risiko-Familie aus. Da soziale und familiäre Faktoren bedeutende Rollen für die Entwicklung eines Kindes darstellen (vgl. Ziegenhain 2007: 661), sind Eltern-Kind-Interaktionen, die sich im Bindungsverhalten, der psychischen Verfassung der Eltern und im Erziehungsverhalten zeigen können, bei präventiven Interventionsmaßnahmen eingehend zu betrachten. In den letzten Jahrzehnten haben sich verschiedene Formen der Interventionen herausgebildet, in der vorliegenden Ausarbeitung wird sich aber aufgrund der vorher genannten Aspekte exemplarisch auf das bindungstheoretisch fundierte Frühinterventionsprogramm STEEP™ („Steps Towards Effective Enjoyable Parenting") fokussiert. STEEP™ ist ein praktisch anwendbares Instrument der Bindungstheorie zur Förderung und Begleitung von Hoch-Risiko-Familien während der Schwangerschaft bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes (vgl. Erickson/Egeland 2006: 27f).
Weiterführend zu Nolls Erkenntnissen über die Defizite im Beratungs- und Hilfsangebot für gewaltbetroffene Frauen, soll in der vorliegenden Arbeit in Bezugnahme auf sexualisierte Gewalt gegen Frauen und die Mutter-Kind-Bindung untersucht werden, inwiefern grundlegende Annahmen im STEEP™-Programm einer idealisierten Norm entsprechen und welche dahingehenden Grenzen und Leerstellen innerhalb der Konzeption erfasst werden können. Dabei stellen sich die Fragen, welche Dimensionen der Auswirkungen von sexualisierter Gewalt aufgegriffen werden, ob es innerhalb der Konzeption einen normativen Blick auf die Mutterschaft gibt und welche Maßnahmen bedeutsam im Hinblick auf die Entwicklung einer stabilen Mutter-Kind-Beziehung sind. Es wird sich daher zunächst mit der Forschungslage zu sexualisierter Gewalt gegen Frauen beschäftigt, vor allem mit der Definition und Einordnung des sexualisierten Gewaltbegriffs, der Prävalenz und den Auswirkungen von sexualisierter Gewalt an Frauen sowie mit den Bewältigungs- und Aufarbeitungsprozessen, die sich daraus ergeben. Die Erkenntnisse, die sich daraus herleiten, sind notwendige Voraussetzungen zur Formulierung gelingender Interventionsmaßnahmen. Da STEEP™ auf der Bindungstheorie von Bol- wby und Ainsworth basiert, wird sich im dritten Abschnitt mit ihren wichtigsten Grundannahmen und dem erzeugten Mutterbild auseinandergesetzt. Dies soll ein tiefergehendes Verständnis und damit eine kritische Reflexion der Interventionskonzeption von STEEP™ ermöglichen. Im vierten Abschnitt wird das STEEP™-Programm betrachtet, indem die Ziele und Methoden, die von Martha Erickson und Byron Egeland formuliert wurden, vorgestellt werden. Auf Grundlage der bis dahin gesammelten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu sexualisierter Gewalt, sowie der Bindungstheorie und mithilfe der Resultate aus der Fallstudie von Milena Noll (2013) über sexualisierte Gewalt und Erziehung, soll im fünften Abschnitt das STEEP™-Programm im Hinblick auf die Forschungsfrage untersucht werden. Es wird erwartet, dass sich dadurch theoretische Rückschlüsse für Hilfs- und Beratungsangebote mit dem Beratungsschwerpunkt auf sexualisierte Gewalt treffen lassen, um die von Noll erkannten Versorgungslücken im Helfersystem für betroffene Frauen zu minimieren. Abschließend werden die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit resümiert.
2 Sexualisierte Gewalt an Frauen
In den nachfolgenden Kapiteln wird versucht, einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu sexualisierter Gewalt an Frauen zu geben. Dabei wird sich mit der Definition, Einordnung und Prävalenz von sexualisierter Gewalt innerhalb der Forschung auseinandergesetzt. Zudem werden die (un-)mittelbaren psychopathologischen und sozialen Folgen von sexualisierten Gewalterfahrungen näher betrachtet, insbesondere der Einfluss auf eine mögliche transgenerationale Weitergabe. Anschließend werden Bewältigungsstrategien von Betroffenen und die damit einhergehenden Aufdeckungsprozesse dargestellt, sowie die Relevanz von Interventionen aufgezeigt.
2.1 Definition, Einordnung und Prävalenz
Die Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland" wurde 2005 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegeben und ist die erste große repräsentative Befragung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland (vgl. Schröttle/Müller 2005: 9). Müller und Schröttle versuchten, vor dem Hintergrund strafrechtlich relevanter Kategorien, eine Definition für sexualisierte Gewalt herzuleiten. Diese umfasst „alle Formen von Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung [...], die als erzwungene sexuelle Handlungen mit körperlichem Zwang oder Drohungen gegen den Willen der Frau durchgesetzt wurden" (vgl. ebd.: 65). Das Strafgesetzbuch (StGB) vereint in § 177 die Delikte des sexuellen Übergriffs, der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung. So wird in § 177 Abs. 1 StGB unter anderem festgelegt, dass ein Mensch, der „gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, [...] bestraft [wird]". Die Orientierung an den Begrifflichkeiten des Strafgesetzbuches ermöglicht, konkrete Erfassungsinstrumente zu entwickeln und dadurch die Gewaltdefinition im gewissen Maße einzugrenzen (vgl. ebd.: 18). Als Beispiele für etwaige Zwangshandlungen wurden im mündlichen Fragebogen Festhalten, Herunterdrücken, Arm umdrehen, Erpressung und Drohung, sowie die Herbeiführung von Wehrlosigkeit oder Abhängigkeit genannt (vgl. ebd.: 67). Die Datenerhebung erfolgte zunächst mittels mündlicher Befragung und anschließend nochmal durch Abfragen über schriftliche Fragebögen (vgl. ebd.: 13ff). Hierbei fiel auf, dass die Bereitschaft über Partnerschaftsgewalt zu berichten im schriftlichen Fragebogen weitaus höher lag, als in der mündlichen Befragung. Infolgedessen gaben in 10.264 geführ- ten Interviews, die deutschlandweit von Februar bis Oktober 2003 geführt wurden, 12% der befragten Frauen im Alter von 16 bis 85 Jahren an, mindestens einen der geschilderten Formen von sexualisierter Gewalt seit dem 16. Lebensjahr erfahren zu haben, wenn der Gewaltbegriff strafrechtlich, im engeren durch Zwangshandlungen oder Drohungen, definiert wird (vgl. Schröttle/Müller 2005: 5; 65). Das betrifft demnach jede siebte Frau in Deutschland. Durch den eng gezogenen Gewaltbegriff wurden jedoch breitere Formen von sexueller Gewalt und Nötigung exkludiert, weshalb weitere Fragen zu „ungewollten sexuellen Handlungen unter psychisch-moralischen Druck" gestellt wurden; die Prävalenz stieg damit von 12% auf 16% (vgl. ebd.). Bei Einbezug verschiedener Formen sexueller Belästigung, die unfreiwilligen Geschlechtsverkehr, körperliche Gewalt oder Bedrohungs- und Angstgefühle zur Folge hatten, erhöhte sich die Anzahl der Betroffenen auf 34% (vgl. ebd.). Auch das Alter der betroffenen Frau spielt bei der Analyse der Datensammlungen eine Rolle. In den Altersgruppen unter 18 Jahren und ab 65 Jahren wird vergleichsweise meist weniger erlebte Gewalt angegeben, als in den mittleren Altersgruppen, sodass die Prävalenzen, die diese Altersgruppen beinhalten, insgesamt auch niedriger ausfallen (vgl. ebd.: 10). Anhand dessen wird deutlich, dass die Gewaltprävalenz von vielen Faktoren abhängt und es immer noch hohe Dunkelwerte gibt.
Die Untersuchung „WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women" der Weltgesundheitsorganisation WHO (World Health Organization) generierte Datenmaterial aus Befragungen verschiedener Nationen, in denen zuvor kaum Forschungen zu sexualisierter Gewalt an Frauen existierten (WHO 2005: 1). Die Betrachtung von Studien aus 35 unterschiedlichen Ländern, die vor 1999 herausgebracht wurden, zeigte, dass zwischen 10% und 30% der Frauen sexualisierte Gewalt ausgehend von einer nahestehenden Person erleiden mussten, wovon 10% bis 27% angaben, im Kindes- oder Erwachsenenalter, sexuell misshandelt worden zu sein (vgl. ebd.). Im Zuge dessen wurden Fragen danach aufgeworfen, weshalb die Prävalenzzahlen um sexualisierte Gewalt scheinbar je nach Nation und auch innerhalb einer Nation, sowie den genutzten Methoden innerhalb der Untersuchungen, dermaßen variieren (vgl. ebd.). Die Fragestellungen in den Studien differieren auch deshalb erheblich, weil übergriffige Handlungen partiell sehr unterschiedlich von Menschen wahrgenommen werden und sexualisierte Gewalt vielzähligen Bedingungsfaktoren und gesellschaftlichen Zusammenhängen unterliegt. Eine Parallele zur vorangegangenen Studie zeigt sich darin, dass die Findung einer einheitlichen Definition für Gewalt eine der Hauptschwierigkeiten darstellte (vgl. ebd.: 3). Die Ausarbeitung einer eindeutigen Definition für verschiedene Gewaltformen ist deshalb so bedeutend, weil sie damit frei von individuellen Bewertungen ist, was wiederum die Vergleichbarkeit der einzelnen Forschungsergebnisse untereinander erhöht. In der Studie der WHO wird darauf verwiesen, dass durch die Orientierung an „traditionellen"2 Definitionen von Gewalt die Realprävalenz von der generierten Prävalenz in der Studie abweicht und unterrepräsentiert wird (vgl. ebd.).
Sexualisierte Gewalt in der Partnerschaft wird in der Studie anhand von drei Verhaltensweisen definiert: 1.) Unter physischem Zwang gegen den Willen der Frau Geschlechtsverkehr zu vollziehen, 2.) unter Zwang „etwas sexuelles" zu tun, das die Frau als erniedrigend und beschämend erachtet und 3.) die Vollziehung des Geschlechtsverkehrs aufgrund derAngst vor Konsequenzen bei Ungehorsam (vgl. WHO 2005: 5). Dies ist ziemlich deckungsgleich mit den Definitionen, die in der 2005 durchgeführten Studie von Schröttle und Müller genutzt wurden. Von über 24.000 befragten Frauen, aus unterschiedlichen Nationen und kulturellem Hintergrund, gaben 6% bis 59% der Frauen an im Laufe des Lebens sexualisierte Gewalt erfahren zu haben (vgl. ebd.: 6). Japan sowie Serbien und Montenegro hatten dabei die niedrigsten Prävalenzwerte von 6%, während Äthiopien mit 59% den höchsten Werte aufwies (vgl. ebd.). Diese enorme Differenz der Prävalenzen zwischen den verschiedenen Nationen wird damit erklärt, dass ein hoher Bildungsgrad mit einer niedrigen Gewaltbetroffenheit korreliert und die Bildungschancen von den Frauen in den unterschiedlichen Ländern stark auseinander gehen (vgl. ebd.: 9). In einer weiteren Kategorie wurde nach sexualisierter Gewalt gefragt, die seit dem 15. Lebensjahr erlebt wurde und nicht von Partnerinnen ausging. Als Tatpersonen wurden Fremde, männliche (Familien-)Freunde und Familienmitglieder genannt (vgl. ebd.: 48). Die höchsten Prävalenzraten lagen zwischen 10% und 12% in Ländern wie Peru und Samoa. Bei Einbezug anderweitiger physischer Gewalt, stiegen die Zahlen in Samoa auf bis zu 65% (vgl. ebd.). Konträr dazu gaben insgesamt über 75% der befragten Frauen an, seit ihrem 15. Lebensjahr mindestens einmal von Partnerschaftsgewalt körperlicher und sexualisierter Art erfahren zu haben (vgl. ebd.). Die Erkenntnis, dass sexualisierte Gewalt zum Großteil im unmittelbaren sozialen Nahraum zu verzeichnen ist, konnte auch aus der Studie von Schröttle und Müller gezogen werden (vgl. Noll 2013: 17). Bei der Fragestellung, ob die Frauen vor Erreichung des 15. Lebensjahres jemals von jemandem auf eine sexuelle Art und Weise angefasst wurden oder dazu gezwungen wurden, etwas sexuelles zu tun, das sie nicht tun wollten, wurden zwei Herangehensweisen genutzt: Zuerst wurden die Frauen face-to- face befragt, nach dem Interview wurde ihnen anschließend die gleiche Frage nochmals gestellt, allerdings wurden sie diesmal dazu angeleitet, die Antworten „ja" oder „nein" in Form eines lächelnden oder weinenden Gesichts auf eine Karte zu zeichnen, welche dann anonym in einen Umschlag gesteckt wurde. Die Auswertungen der anonymen Antworten brachte zum Vorschein, dass die Prävalenzen in fast allen Ländern erheblich gestiegen sind; in Äthiopien war beispielsweise ein Anstieg von 0,2% auf 7% und in Namibia von 5% auf 21% zu erkennen (vgl. WHO 2005: 50). Diese breiten Unterschiede hinsichtlich der Zahlen zwischen den einzelnen Ländern und auch innerhalb einer Nation selbst, deuten darauf hin, dass es sich bei Gewalt gegen Frauen um nichts Unwillkürliches handelt, sondern überhaupt nur unter bestimmten Voraussetzungen bestehen kann (vgl. ebd.: 22). Es zeigt sich, dass das Sprechen über die erfahrene Gewalt vielen Frauen immer noch schwerfällt und tabuisiert wird. Die Schwierigkeiten in den methodischen Zugängen für die Erfassung von sexualisierter Gewalt, konnten auch in dieser Studie nicht vollständig durchbrochen werden, sodass noch von vielen Dunkelfeldern ausgegangen werden kann.
Auch die rein statistischen Auswertungen des Bundeskriminalamts (BKA) sind von diesem Problem betroffen. Laut den Zahlen des Berichtsjahres 2018, sind in den Kategorien, die in den Bezugsrahmen der sexuellen Gewalt fallen, fast ausschließlich Frauen als Geschädigte vorzufinden. Die für die vorliegende Arbeit relevanten Straftaten sind sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung (vgl. BKA 2019: 4). In den anderen Kategorien, wie Totschlag, Körperverletzung, Bedrohung, Stalking, sowie Freiheitsberaubung wird nicht ersichtlich, ob sich diese in irgendeiner Weise im Kontext von sexueller Gewalt abgespielt haben, weshalb diese in den nachfolgenden Betrachtungen nicht berücksichtigt werden. Insgesamt werden 140.755 Betroffene von vollendeten und versuchten Straftaten genannt, wovon 81,3% weiblich sind (vgl. ebd.: 6). Es wird hervorgehoben, dass die Anzahl der weiblichen Betroffenen von Partnerschaftsgewalt unteranderem bei den Straftaten der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung deutlich höher liegt, als in den anderen Strafkategorien (vgl. ebd: 7). In den Bereichen des sexuellen Übergriffs, der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung wurden 3.136 betroffene Personen gezählt - davon 98,4% weiblichen Geschlechts - was einer Prävalenzrate von 2,2% entspricht (vgl. ebd: 8). Die genannten Delikte sind allerdings nur jene, die dem Bundeskriminalamt als Straftaten bekannt sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass etliche Fälle, die nicht polizeilich gemeldet wurden, in dieser Statistik nicht auftauchen. Ebenso bietet der rechtliche Bezugsrahmen keinen Spielraum für Interpretation. Sofern die erlebte Gewalthandlung der Frauen sich nicht mit jenen deckt, die im StGB dargelegt werden, existiert diese Gewaltform im strafrechtlichen Sinne nicht. Nicht zuletzt deshalb ist auch anzunehmen, dass es eine hohe Dunkelziffer an Fällen gibt, die in den kriminalstatistischen Auswertungen nicht berücksichtigt werden. Die veröffentlichten Zahlen veranschaulichen aber, dass in Deutschland vornehmlich Frauen von Gewalthandlungen aller Art betroffen sind und damit hierarchische Geschlechterverhältnisse in der heutigen Gesellschaftsordnung nach wie vor existieren (vgl. Glammeier 2018: 103).
Es ist zu erkennen, dass es nach wie vor eine große Herausforderung ist, die Prävalenz von sexualisierter Gewalt möglichst nah an der Realität zu erfassen. Anhand der Studien kann verdeutlicht werden, dass geschlechtsspezifische Gewalt an Frauen und die Suche nach einer einheitlichen Definition sexualisierter Gewalt relevante Probleme darstellen. Diesbezüglich wird oftmals angeraten, sexualisierte Gewalt im Kontext der jeweiligen Themenschwerpunkte zu sehen. Bange (2002: 49) unterscheidet dabei zwischen normativen, klinischen und wissenschaftlichen Definitionen. Amann und Wipplinger (2005: 24) klassifizieren zwischen gesellschaftlichen, feministischen, entwicklungspsychologischen und klinischen Definitionen. Doch auch diese Einteilungen greifen nicht die gesamte Bandbreite des Phänomens auf.
Zudem ist Gewalt schließlich das, was die Betroffenen in ihrem Ermessen als gewalttätig auffassen. Das medial weit verbreitete Rollenbild, das den Mann als den aktiven und initiierenden Part und die Frau als passives Ziel der Begierde darstellt, die den Mann verführt und kokettiert, um ihn sexuell zu reizen, führt zu einem normativen Verständnis von Sexualität. Es könnte sein, dass einige Frauen dieses Rollenverständnis so weit internalisieren, dass es ein Teil ihres sexuellen Erregungssystems wird und sie dadurch übergriffige Handlungen nicht mehr klar von ihrem eigenen Wollen trennen können. Somit wäre ihnen gar nicht bewusst, dass bestimmte Verhaltensweisen unrechtmäßig sind, da sie diese damit normalisieren. Insofern wird der Begriff der sexualisierten Gewalt auch stark von dem Selbstverständnis geprägt, das Männer und Frauen von ihrer eigenen Sexualität haben. Daher spielt nicht nur die Einvernehmlichkeit eine Rolle, sondern auch die Zurechnungsfähigkeit darüber, ob der Mensch in diesem Moment eine klare Entscheidung treffen und sich über die Konsequenzen der sexuellen Handlung bewusst sein kann. Dies trifft vor allem dann zu, wenn die sexualisierten Gewalthandlungen innerhalb der Familie und in einer kindlichen Entwicklungsphase vollzogen wurden. Kinder sind den Manipulationen der Tatperson schutzlos ausgesetzt und handeln schließlich so, wie es ihnen in dieser Situation beigebracht wird (vgl. Noll 2013: 37). Die ambivalenten Gefühle, die sich einerseits durch starke Abneigung und Scham äußern und andererseits von Sympathie zu der einstigen Vertrauensperson geprägt sind, führen zu „einer langfristigen Verwirrung auf kognitiver, emotionaler und sexueller Ebene" (vgl. ebd.). Die Frage nach sexualisierter Gewalt „bleibt [...] offen und [so] muss immer wieder neu diskutiert werden, wann eine Berührung erlaubt und wann sie unerlaubt ist" (Grebenstein 2017: 26). Sexualisierte Gewalt sollte aber primär durch die Perspektiven der Betroffenen definiert werden. Anhand dessen können Rückschlüsse darüber gezogen werden, welche Dimensionen solche heteronomen Einbrüche in die eigene Selbstbestimmung erreichen können und wie sich sexualisierte Gewalt auf das Leben der betroffenen Person auswirkt. Die Folgen von sexualisierter Gewalt sind, wie der Begriff der sexualisierten Gewalt selbst, mehrdimensional und komplex, weshalb diese im Folgekapitel einer näheren Betrachtung unterzogen werden.
2.2 Auswirkungen sexualisierter Gewalt
Die vielfältigen und multifaktoriellen Folgen sexualisierter Gewalt sind inzwischen Bestandteil zahlreicher wissenschaftlicher Ausarbeitungen. In der Forschung werden diese Auswirkungen oftmals aus psychopathologischer Sichtweise analysiert, sie äußern sich aber auch durch soziale Belastungen, gesamtgesellschaftlichen Problemstellungen und anderen Faktoren, wobei generell in unmittelbare Folgen und Langzeitfolgen unterteilt wird (vgl. Mosser 2018a: 822 f). Jedoch muss darauf hingewiesen werden, dass sich in der Forschung meist auf retrospektive Studien bezogen wird, wenn von den Folgen sexualisierter Gewalt gesprochen wird. Für aussagekräftige Ursache-Wirkungszusammenhänge, wären daher prospektive Langzeitstudien von nur einer Kontrollgruppe nötig, was allerdings aufgrund moralisch-rechtlicher Gründen nicht zu verantworten ist (vgl. Moggi 2004: 323).
Aufgrund der Komplexität der Bedingungsfaktoren, kann innerhalb der vorliegenden Arbeit nicht auf die gesamte Bandbreite an möglichen Symptomen eingegangen werden. Auch die Einteilung in psychopathologische, soziale und generationenübergreifende Auswirkungen sexualisierter Gewalt ist stark heruntergebrochen und spiegelt nicht alle Bestandteile etwaiger Folgeerscheinungen wider. Es hilft jedoch, strukturell die präsentesten Nachwirkungen sexualisierter Gewalt zu erfassen, womit einer Empfehlung von Mosser gefolgt wird (vgl. Mosser 2018a: 822). Unter diesem Gesichtspunkt werden in den nächsten Kapiteln einerseits die sich gegenseitig beeinflussenden sozialen und psychopathologischen Folgen kurz beleuchtet, sowie andererseits „Mehrgenerationendynamiken" (ebd.) aufgezeigt, die sich aus ihnen ergeben. Anhand dessen kann Aufschluss darüber gegeben werden, wie sich Aufdeckungsarbeit gestalten sollte und welche wirksamen Bewältigungsstrategien betroffene Frauen mit der Zeit entwickeln. Dies sind Schlüsselinformationen für alle Interventionsund Beratungsangebote, die dadurch ein besseres Verständnis für den Umgang mit betroffenen Frauen generieren können.
2.2.1 SozialeAuswirkungen
Weit verbreitete gesellschaftliche Werte und Normen suggerieren oftmals, dass das Verhalten einer Frau, ihr Auftreten, ihre Kleidung oder gar ihr Aufenthaltsort sexualisierte Gewalthandlungen provozieren können, womit die Verantwortung für das Geschehene der Tatperson entzogen und der betroffenen Frau zugeschrieben wird. Dies kann als Erklärung dafür angesehen werden, weshalb Betroffene teilweise starke Schamgefühle oder eine Mitschuld am Geschehenen verspüren (vgl. Mück 2008: 8). Solche Schuldzuweisungen generieren zudem Stereotypen und das Bild eines „typischen Opfers" von sexualisierter Gewalt, obwohl Frauen jeden Alters, jeder Nationalität, Religion und sozialen Schicht davon im gleichen Verhältnis betroffen sind (vgl. ebd.). Diese Betrachtungen gelten im selben Maße für die Einordnung der Täter, denn es wird zumeist davon ausgegangen, dass es sich um gemeingefährliche Triebtäter handelt, obwohl die Täter mehrheitlich nicht dieser Kategorie zuzuordnen sind (vgl. ebd.). Damit wird eine Distanz zu der Thematik geschaffen, die sexualisierte Gewalttaten alltagsfern und von der „normalen" Lebenswelt ausgeschlossen erscheinen lassen.
Der soziale Rückzug ist ein weiteres Phänomen, das im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt beschrieben wird: „Während betroffene Kinder und Jugendliche vor allem durch soziale Isolation bzw. antisoziales Verhalten auffallen, verlegt sich das Konfliktfeld im Erwachsenenalter häufig auf den Bereich der Paarbeziehung" (Mosser 2018a: 825). Die Belastungen in einer Paarbeziehung können sich durch sexuelle Funktionsstörungen und „dysfunktionale Coping-Muster" (ebd.) äußern, welche einerseits das Schweigen über die sexualisierten Gewalterfahrungen und andererseits die Überlastung der Beziehung aufgrund der Auswirkungen der sexualisierten Gewalt beinhalten. In vielen Untersuchungen werden hinsichtlich dessen erhöhte Trennungs- und Scheidungsraten aufgezeigt (vgl. Lo- haus/Heinrichs/Konrad 2018:853).
Auch in Bezug auf Ausbildung und Beruf können erhebliche Einschränkungen als Folge von sexualisierten Gewalterfahrungen entstehen (vgl. Gawlich 2013: 297). „Durch die Erschöpfung von Bewältigungsstrategien besteht das Risiko einer erhöhten Vulnerabilität im Hinblick auf den Umgang mit Stress" (Mosser 2018a: 826), somit können bestimmte Symptome, wie verminderte Konzentrationsfähigkeit, die bei betroffenen Kindern gehäuft beobachtet werden können, zur Abschwächung der Leistungsfähigkeit oder gänzlich zum Schulabbruch führen (vgl. ebd.). Dies kann auch auf Berufsbiografien im Jugend- und Erwachsenenalter übertragen werden (vgl. ebd.). Die sozialen Auswirkungen stehen dabei in enger Wechselwirkung zu den psychopathologischen Auswirkungen und sind an sich nicht unabhängig voneinanderzu betrachten.
2.2.2 PsychopathologischeAuswirkungen
Es gibt zahlreiche psychopathologische3 Störungsbilder, die mit dem Erlebnis der sexualisierten Gewalt in der Kindheit korrelieren. In diesem Zusammenhang seien laut Mosser (2018a: 823) Depressionen und Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) am häufigsten anzutreffen. Es gebe darüber hinaus noch eine hohe Anzahl an Befunden zu Suchterkrankungen, Borderline-Persönlichkeitsstörun- gen (BPS), Angst-, Ess- und Sexualstörungen, sowie Suizidgefährdung. Es sei jedoch kritisch zu hinterfragen, ob die psychopathologischen Symptome als direkte Folgen von sexualisierter Gewalt zu bezeichnen sind, da sexualisierte Gewalt nicht isoliert, sondern oftmals mit anderen schwierigen Lebenslagen und Gewaltformen erlebt werde. Die Störungsbilder seien zudem komorbid, „die Symptome stehen also in einem funktionalen Zusammenhang zueinander" (ebd.). Außerdem seien die auftretenden Symptome entwicklungs- und geschlechtsabhängig, das heißt, dass Kinder andere Auswirkungen davontragen, als Erwachsene und die Diagnosen oftmals nicht geschlechtssensibel seien (vgl. ebd.: 824). Mosser sieht psychopathologische Symptome bei sexualisierter Gewalt demnach nicht als Kausalität an, sondern vielmehr als einen „empirisch fundierten Nachweis, dass bestimmte gesundheitliche Folgen bei betroffenen Menschen häufiger auftreten, als bei Menschen, die keine sexualisierte Gewalt erlebt haben" (ebd.).
Noll (vgl. 2013: 37) beschreibt unterdessen ebenfalls, dass Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, häufiger psychologische Besonderheiten aufweisen und fügt hinzu, dass die Schwere der Traumatisierung auf diverse Kriterien zurückzuführen ist, wobei eine Priorisierung dieser im Einzelnen nicht möglich sei. In den Fällen, in denen biografische Mehrbelastungen zu verzeichnen sind, wirft Noll den Begriff der kumulativen bzw. der sequenziellen Traumatisierung nach Khan (1963) bzw. Keilson (1998) ein. Davon zu unterscheiden seien die primäre und sekundäre Traumatisierung, die einerseits aus den direkten Folgen der sexualisierten Gewalterfahrungen resultieren und andererseits aus jenen, die von der Art der Aufarbeitung des Traumas im nahen sozialen Umfeld und innerhalb der Gesellschaft abhängen (vgl. ebd.: 36). Auch Noll betrachtet die Symptome einer Traumatisierung entwicklungsperspektivisch. Während sich die unmittelbaren Folgen im Kindesalter beispielsweise durch Schulprobleme, Schlaf- und Essstörungen oder unkontrollierte emotionale Ausbrüche zeigten und im Erwachsenenalter durch Verdrängung oder Amnesien geprägt seien, würden sich die Langzeitfolgen unter anderem anhand von Depressionen, Auto-Aggressivität, Isolation, hoher Schreckhaftigkeit, einem negativen Selbstbild und Substanzmissbrauch äußern (vgl. ebd.). Es werden auch physisch sichtbare Narben und Wunden, wie Entzündungen, Blutungen und vaginale Geschlechtskrankheiten, genannt (vgl. ebd.). Das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtet in dem Zusammenhang, dass etwa 44% der Betroffenen von sexualisierter Gewalt verschieden starke Blessuren aufweisen, die sich in der folgenden Aufzählung in absteigender Häufigkeit in Form von Hämatomen, Schmerzen, offenen Wunden, Verstauchungen, Verletzungen im Kopf- und Vaginalbereich, Gehirnerschütterungen, Frakturen, Fehlgeburten und inneren Verletzungen äußern (vgl. RKI 2008: 15). Erwähnt wird ebenfalls, dass es statistisch signifikante Verbindungen zwischen erfahrener Gewalt und physischen Folgesymptomen gibt, was der Aussage Mossers über fehlende empirische Befunde zu einem kausalen Zusammenhang zwischen sexualisierter Gewalt und bestimmten Folgeerscheinungen widersprechen würde (vgl. ebd.: 16). Dennoch ist es schwierig, ein bestimmtes Symptom ausschließlich auf nur eine bestimmte Ursache zurückzuführen (vgl. Lohaus et. al. 201 8: 850). Der Zusammenhang kann so beschrieben werden, dass „Gewalterfahrungen [...] einen hohen psychosozialen Belastungsfaktor [bedeuten], der eng mit dem erlittenen Gewaltausmaß assoziiert ist, über die Beendigung der Gewaltsituation bestehen bleibt und zudem psychosomatische Beschwerden (mit)verursachen kann" (RKI 2008: 15). Das heißt, dass das Auftreten psychopathologischer Symptome nicht mit Sicherheit direkt auf die sexualisierte Gewalterfahrung zurückgeführt werden kann, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Beschwerden bei Betroffenen auftreten werden, dennoch stark erhöht ist. Diese Beschwerden sind gerade dann besonders schwerwiegend, wenn die sexualisierte Gewalt im unmittelbaren sozialen Nahraum geschehen ist und der Altersunterschied zwischen der Tatperson und dem geschädigten Menschen auffällig hoch ist (vgl. Noll 2013: 17; 35). Auch die Reaktionen des nahen sozialen Umfelds sind entscheidend dafür, welche Ausmaße die Traumatisierung letztendlich einnimmt (vgl. ebd.: 35). Die Höhe des Erkrankungsrisikos hängt auch stark von der Intensität der erfahrenen sexualisierten Gewalt ab und nicht nur von den sozioökonomischen Lebensumständen oder der Qualität der Eltern-Kind-Bindung (vgl. Moggi 2004: 322).
Sexualisierte Gewalt hat schlussfolgernd eine äußerst zerstörerische Wirkung auf die Betroffenen. Nicht nur die eigene Selbstwahrnehmung wird erschüttert, sondern auch die Fremdwahrnehmung, die sich durch die oftmals nahestehende Tatperson in ihren Grundfesten verändert. Der festgefahrene Zustand der Betroffenen bewege sich laut Herman „zwischen Gedächtnisverlust oder Wiedererleben des Traumas; zwischen der Sintflut intensiver, überwältigender Gefühle und der Dürre absoluter Gefühllosigkeit; zwischen gereizter, impulsiver Aktion und totaler Blockade jeglichen Handelns" (Herman 2003: 72), was eine Unberechenbarkeit der eigenen Emotionen impliziert. In diesem Kontext muss noch der Begriff des Stresses erwähnt werden. Sexualisierte Gewalt und die Auswirkungen lösen bei betroffenen Personen Stresshormone aus, die langfristig dazu führen, dass sich das allgemeine Infektionsrisiko für Krankheiten erhöht oder sich die Strukturen des Gehirns negativ verändern (Lohaus et. al. 2018: 851). Vor allem Gewalterfahrungen in der frühen Kindheit gelten als besonders gefährdend für die zukünftige Gehirnentwicklung (vgl. ebd.).
Laut Noll haben Betroffene sexualisierter Gewalt ein Leben lang mit den Symptomen der Traumatisierung zu kämpfen, welche unabhängig von dem individuellen Bewusstsein über die erlebte Traumatisierung sei (vgl. Noll 2013: 34). Grundsätzlich seien diese Symptome als Überlebensstrategien zu verstehen, um mit den traumatischen Erfahrungen umgehen zu können (vgl. Rauwald 2013: 28). In einigen Studien werden zudem hohe Reviktimisierungszahlen festgestellt, die sich bei betroffenen Kindern unter multifaktoriellen Bedingungen durch ein um 1,5- bis 2,5-fach höheres Risiko äußern, im Jugend- oder Erwachsenenalterwiederholt sexualisierte Gewalt erleiden zu müssen (vgl. Lohaus et. al. 2018: 853). Begründet wird dies unter anderem durch fehlende familiäre Unterstützungssysteme und dem Konsum bewusstseinsverändernder Substanzen, wie Alkohol und Drogen, die den Betroffenen teilweise als Bewältigungsstrategien dienen (vgl. Heynen 2006: 125).
2.2.3 TransgenerationaleAuswirkungen
Eine Studie von McCloskey und Bailey (2000) brachte hervor, dass Mädchen, deren Mütter im Laufe ihres Lebens sexualisierte Gewalt erfahren haben, ein 3,6-fach höheres Risiko aufzeigen, selbst Betroffene sexualisierter Gewalt zu werden (vgl. Lohaus et. al. 2018: 854). Damit konnte verzeichnet werden, dass die Wahrscheinlichkeit im Laufe des Lebens sexualisierte Gewalt zu erleiden, transge- nerational weitergegeben wird. Dies wird auf die Überlieferung von bestimmten Erfahrungen und Verhaltensweisen sowie unveränderte sozioökonomische Lebensbedingungen zurückgeführt, die generationenübergreifend bestehen bleiben (vgl. ebd.; Radicke 2014: 273). Es konnten aber auch biologische Veränderungen nachgewiesen werden, die sich durch „ungünstige Eltern-Kind-Interaktionserfahrungen über epigenetische Genmethylierungen4 in die Folgegeneration" (ebd.) äußern. Die unbewusste Weitergabe von traumatischen Folgesymptomen, konnte auch in Untersuchungen von Kriegsbetroffenen festgestellt werden. Hier zeigten sich Einflüsse von der ersten Generation des ers- ten Weltkriegs, bis hinein in die vierte Generation, den Überlebenden des zweiten Weltkriegs (vgl. Noll 2013: 92). Diese Tradierung basiere auf verschiedenen Faktoren, wie vorherrschende Wertvorstellungen, normative Erziehungsmuster, gebrochene Familiengefüge und belastende, traumatische Erfahrungen (vgl. ebd.). Die Auswirkungen sexualisierter Gewalt auf die Eltern-Kind-Beziehung können sich auch schon während einer Schwangerschaft zeigen. Die Schwangerschaft kann von starken Ängsten um das Kind geprägt sein, das in einer Umgebung aufwachsen muss, in der sexualisierte Gewalt und Leid vorhanden ist (vgl. Simkin 2015: 48). Das negative Selbstbild, das viele betroffene Frauen entwickeln, kann dazu führen, dass sie sich einer Schwangerschaft nicht würdig sehen oder sie diese schädliche Selbstwahrnehmung auf ihr Kind übertragen und befürchten, dass sie eine „missliche Gestalt" zur Welt bringen - während andere Betroffene sich durch die Schwangerschaft Normalität und Überwindung der traumatischen Erfahrung beweisen möchten und ihr Kind mitunter idealisieren (vgl. ebd.: 53). Es kommt auch vor, dass schwangere Frauen sich fremdartig fühlen und ihren Körper, sowie die Bewegungen des Fötus1 nicht richtig oder gar nicht wahrnehmen (vgl. ebd.: 50). So können äußerst negative Gedanken hinsichtlich ihres ungeborenen Säuglings entstehen, „viele Frauen empfinden den Fötus wie einen 'Parasiten1, der ihnen die Energie aussaugt" (ebd.). Eine Schwangerschaft kann demnach nicht nur erlösend, sondern auch zutiefst belastend auf eine betroffene Frau wirken. Dies ist von Frau zu Frau unterschiedlich und kann nicht vorhergesehen werden. All diese Vorkommnisse wirken sich schlussfolgernd pränatal auf die Mutter-Kind-Beziehung aus, was eine weitere Erklärung für mögliche epigenetischen Veränderungen sein könnte. Es sind darüber hinaus einige Risiken bezüglich der Elternrolle von gewaltbetroffenen Männern und Frauen bekannt. Die Gefahr, dass sich als Folge der eigenen sexualisierten Gewalterfahrung eine Nachahmung des Täterlnnen-Verhaltens entwickelt, sei im Hinblick auf generationenübergreifende Dynamiken besonders erhöht (vgl. Mosser 2018a: 826). Dies setzt jedoch eine Kombination aus eher negativen Sozialisationsbedingungen voraus, „damit daraus tatsächlich ein Risikomechanismus wird, der sich in sexuell grenzverletzendem Verhalten manifestieren kann" (ebd.).
Noll setzt sich in ihrer 2013 geführten narrativen Studie mit eben solchen Tradierungsprozessen auseinander und erforscht unter anderem, wie sich die traumatischen Erlebnisse sexualisierter Gewalt auf die Mutter-Kind-Beziehung, Partnerschaft und Erziehung der eigenen Kinder auswirken. Einige bedeutende Erkenntnisse waren, dass sich die sexualisierten Gewalterfahrungen in unterschiedlicher Weise insbesondere auf „die Interaktionsstrukturen, die Kommunikation und die Beziehungen zu den eigenen Kindern" (Noll 2013: 268) auswirken. Auf diese Studie wird im fünften Abschnitt der vorliegenden Arbeit noch umfassender eingegangen.
2.3 Bewältigung, Aufdeckung, Intervention
Nachdem ein Blick auf den aktuellen Forschungsstand sexualisierter Gewalt und ausgewählten Folgeerscheinungen geworfen wurde, zeigt sich, dass diese Themenbereiche ein besonderes Maß an Sensibilität und Weitsicht erfordern. Die methodologischen Hürden in der Aufdeckungsforschung, seien vergleichbar mit denen, die in den Untersuchungen zu sexualisierter Gewalt im Allgemeinen zu verzeichnen sind. Auch hier unterscheiden sich die Ergebnisse der einzelnen Studien einerseits durch unterschiedliche Erhebungsverfahren und andererseits durch die voneinander abweichenden Empfindungen zu der sexualisierten Gewalterfahrung der befragten Personen (Scambor/Wittenzell- ner/Rieske 2018: 711). Obwohl sich einzelne Auswirkungen von sexualisierter Gewalt benennen lassen, bleibt das Ausmaß und die klare Eingrenzung dieser Folgen unbestimmt, da diverse Bedingungsfaktoren in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbunden sind und Einfluss aufeinander ausüben. Noll (2013: 38) schreibt dazu, dass „die Bewältigungsmechanismen, die in der traumatischen Situation für das psychische und soziale Überleben entwickeln werden, [...] auch Jahre nach dem Ende sexueller Missbrauchsübergriffe weiter [wirken]". Diese selbsterlernten Muster sind im Laufe des Lebens jedoch nicht mehr hilfreich, da sich die Lebensumstände der betroffenen Frauen mit den Jahren ändern, was zu weiteren Konflikten und Lebenskrisen führen kann (vgl. ebd.).
Die Dichotomie des Traumas zeigt sich in Verdrängungsverhalten und dem gleichzeitig vorhandenen Drang, über die sexualisierte Gewalterfahrung zu sprechen (vgl. Herman 2003: 9). Diese ambivalente Beziehung zwischen Schweigen und Sprechen kann zu weiteren Symptomen führen, wenn kein Ausweg aus dem Dilemma gefunden wird (vgl. ebd.). Das Sprechen „erscheint im Kontext der Aufdeckung [...] als symbolischer wie realer Kontrapunkt zu den über zum Teil Jahrzehnte aufrechterhaltenen Praktiken der Geheimhaltung" (Christmann 2018: 516). Vor dem Hintergrund von Aufdeckungsprozessen, stellt der verbale Austausch über die Gewaltbetroffenheit auch in den Erziehungswissenschaften einen etablierten Forschungsgegenstand dar (vgl. ebd.). Während Kinder überwiegend die eigene Mutter involvieren, sind es bei Jugendlichen die Freundinnen, das heißt, Fachkräfte in pädagogischen Institutionen wie Kindergärten oder Schulen sind selten die ersten Ansprechpersonen (vgl. ebd.: 517). Insbesondere bei Kindern kann das Sprechen über die sexualisierte Gewalterfahrung zu einer Herausforderung werden, da Bezugs- und Vertrauenspersonen einen hohen Einfluss auf das Erleben der Kinder haben. Fällt die Reaktion nicht wie erwartet aus oder ist diese von Ablehnung und Gleichgültigkeit geprägt, kann dies langfristige psychosoziale Auswirkungen auf das betroffene Kind haben, da diese Erwiderung wie eine Spiegelung des eigenen Selbst wahrgenommen werden könnte und das Selbstbildnis weiter verschlechtern würde (vgl. Christmann 2018: 517). In diesem Zusammenhang wird sich innerhalb der Auseinandersetzung mit dem Thema dafür ausgesprochen, dass Berichten von Kindern über sexualisierte Gewalt grundsätzlich Glauben geschenkt werden sollte ,,[...] und diese nicht mit einer objektiven und vollkommen widerspruchsfreien 'Wahrheit' ihrer Schilderungen zu konfrontieren" (ebd.: 519), da das Sexualverständnis von Kindern entsprechende Unglaubwürdigkeit ausstrahlen könnte. Dies ist im Hinblick auf die unterschiedlichen Dimensionen der Aufdeckungsprozesse von sexualisierter Gewalt, welche das Erinnern, Einordnen und Offenlegen beinhalten, besonders relevant (vgl. Rieske/Scambor/Wittenzellner 2018: 700). Die Aufdeckung oder Offenlegung der sexualisierten Gewalterfahrung geschieht dabei auf unterschiedlichen Wegen, wobei zwischen verbalen und nonverbalen Offenlegungen differenziert werden kann, die sich durch gesprochene Worte oder „Verhaltensmanifestation" (ebd.) kennzeichnen.
Auch der Frage nach der Anerkennung von sexualisierten Gewalthandlungen im Kontext von Aufdeckung muss nachgegangen werden. Viele betroffene Personen verdrängen bewusst oder unbewusst die Erinnerung an die sexualisierte Gewalttat, sodass ihre Wahrnehmung über die Tat oftmals lückenhaft ist (vgl. ebd.: 702). Rieske et. al. (2018: 701) sprechen daher von einer „inneren Aufdeckung", wenn die Erinnerungen an das verdrängte Trauma zurückgeholt werden. Daneben spielt die Einordnung der sexualisierten Gewalt auch bei Aufdeckungsprozessen eine bedeutende Rolle, da das widerfahrene Unrecht erst als solches erkannt werden muss. Wie in Abschnitt 2.1 bereits aufgezeigt wurde, gibt es häufig definitorische Unterschiede bei dem Begriff der sexualisierten Gewalt und hängt mitunter von dem Empfinden der betroffenen Person ab. Die Herstellung einer Verknüpfung zwischen bestimmten Folgeerscheinungen und der erfahrenen Lebenskrise, führt dazu, dass die Bewältigungsmechanismen innerhalb der eigenen Handlungsweisen verstanden werden können (vgl. ebd.: 703). Dies ist bei betroffenen Personen unteranderem eine Voraussetzung dafür, Hilfsangebote zu suchen und für sich selbst zu beanspruchen (vgl. ebd.: 704). Es müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit Aufdeckungsprozesse als gelungen angesehen werden können, denn eine Aufdeckung kann „auch zu einer Verschlechterung der Situation der Betroffenen beitragen, wenn sie etwa eine Verschärfung der Gewalt, den Verlust sozialer Beziehungen oder eine psychische Destabilisierung zur Folge hat" (Scambor et. al. 2018: 709). Hier wird darauf hingewiesen, dass betroffene Personen „ein Recht auf Schweigen und Vergessen" (ebd.) haben und bestimmte Voraussetzungen für gelingende Aufdeckungsprozesse zwar geschaffen, aber gleichzeitig auch Bewältigungsweisen angenommen werden müssen, die nicht mit einer Offenlegung Zusammenhängen. Scambor et. al. (2018: 710) fassen vier Ebenen der Aufdeckungsforschung zusammen: Die Ebene des Individuums (Individuelle Biografie, charakterliche und emotionale Eigenschaften, sowie Fähigkeiten und Ressourcen), die Ebene der sozialen Beziehungen und Erfahrungen (in familiären, freundschaftlichen und professionell strukturierten Kontexten), die Ebene der institutionellen Strukturen (Abläufe in der Lebensgestaltung, Handlungen, die mit den sozialen Ebenen Zusammenhängen und milieuspezifische Normen und Werte), sowie die Ebene der gesellschaftlichen Strukturen (Abläufe durch gesellschaftsspezifische Normen und Werte, Gesetze und Regeln). Auf all diesen vier Ebenen sollten Bedingungsfaktoren herrschen, die einen positiven Aufdeckungsverlauf für die betroffenen Personen begünstigen, wozu grundsätzlich Anerkennung, Schutz, Verständnis und Unterstützung gezählt werden (vgl. ebd.: 712). Es ist relevant, diese Aspekte nicht nur im nahen sozialen Umfeld, sondern auch gesellschaftlich und institutionell zu etablieren. Jugendämter, die den Schutz des Kindeswohles als Funktion haben, die Ermittlungsbehörden, welche die Strafverfolgung und Anklageerhebung bei strafrechtlichen Gewaltdelikten ausführen, sowie Fachberatungsstellen, die einen möglichst angstfreien Zugang ins Helfersystem ermöglichen sollen, spielen eine erhebliche Rolle bei der Aufdeckung sexualisierter Gewalt (vgl. Mosser 2018b: 736). Das bedeutet, dass die unterschiedlichen Institutionen im Einklang miteinanderkooperieren undfunktionieren müssen.
Laut Noll (vgl. 2016: 683) gäbe es einen kausalen Zusammenhang zwischen erfahrener Gewalt, der Bewältigung von Gewaltfolgen und der Nutzung professioneller Hilfe. Durch die Anstrengung feministischer und anderer politischer Strömungen, ließen sich prozesshaft Veränderungen in den Helfersystemen verzeichnen. Im Bericht der Bundesregierung zur Situation verschiedener Unterstützungsangebote für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder aus dem Jahr 2012 wird geschrieben, dass ,,[...] die Aufgabe, Schutz vor Gewalt sowie Hilfe und Unterstützung für gewaltbetroffene Menschen zu organisieren, als Ausprägung des Grundrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit [...] alle staatlichen Ebenen in gemeinsamer Verantwortung trifft" (BMFSFJ 2012: 257). Somit sieht die Bundesregierung es als eine Staatsaufgabe, die Unterstützungsangebote für gewaltbetroffene Frauen und Kinder zu verbessern und auszuweiten. Das Hilfsportal von Johannes-Wilhelm Rörig, dem unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, stellt eine Datenbank zur Verfügung, mit der nach Beratungsstellen, die vor Ort, online oder telefonisch zu erreichen sind, sowie Ambulanzen, medizinische Praxen und auch Anwältinnen, gesucht werden kann. Stand heute werden beispielsweise in Frankfurt am Main und im Umkreis von bis zu 50 km, mit den Einstellungen „Alle Hilfsangebote" und „Alle Zielgruppen", rund 184 Ergebnisse erzielt5. Es gäbe allerdings regionale Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit der Gewalttaten, sowie der Inanspruchnahme der Beratungsangebote in städtischen Ballungsräumen und kleineren Ortschaften (vgl. BMFSFJ 2012: 14). Je dünn besiedelter das Gebiet ist, desto weniger Hilfs- und Schutzeinrichtungen seien zu erwarten. Außerdem wurden Zugangsschwierigkeiten für gewisse Bevölkerungsgruppen und Versorgungslücken verzeichnet (vgl. ebd.). Dahingehend sei die Bedarfsdeckung als dynamischer Prozess zu verstehen, weshalb empfohlen wurde, eine Bedarfsanalyse auf Landes- und Kommunalebene zu vollziehen. Um die Barrieren zur externen Hilfesuche etwas abzubauen, wurde durch die Bundesregierung ein deutschlandweites Hilfstelefon bei Gewalt gegen Frauen aufgebaut, doch es gibt nach wie vor Weiterentwicklungsbedarf auf allen Ebenen. Laut Gawlich (vgl. 2013: 298) hänge die Qualität der Beratungsstellen maßgeblich von den finanziellen Mitteln der Länder und Kommunen ab. Viele Frauen würden sich in den Beratungsstellen nicht gut aufgehoben fühlen (vgl. ebd.).
Das Helfersystem, Beratungszugänge und die Inanspruchnahme von Beratungsangeboten für gewaltbetroffene Frauen, seien bisherstrukturell kaum erfasst worden, obwohl die Wissensvorkommen der Beratungsstellen bedeutende Erkenntnisse für die Beratungswissenschaft darstellen (vgl. Noll 2016: 683). Die Perspektiven der Nutzerinnen und Beraterinnen werden in der Beratungsforschung nur lückenhaft repräsentiert, sodass es einer verbesserten Integration ihrer Sichtweisen innerhalb der Studien bedarf. Neben der gesellschaftlichen und institutionellen Verantwortung rund um die Aufdeckung und Prävention sexualisierter Gewalt, spielen die Eltern der betroffenen Personen im selben Maße eine große Rolle. Gerade, wenn Kinder Geschädigte sexualisierter Gewalt werden, treffen die Schuldzuweisungen zumeist erst die Eltern und „insbesondere Mütter [...] werden oft [...] als 'stille Partnerin' für die sexualisierte Gewalt mitverantwortlich gemacht" (Bange 2018b: 745), wenn die Gewalthandlung innerhalb der Familie stattfindet. Es gäbe in der englischsprachigen Forschung über die Stellung der Mutter bei sexualisierter Gewalt unzählige Studien, aber keine einzige, die die Rolle der Väter in den Blick nimmt, obwohl die Täter zumeist männlichen Geschlechts sind (vgl. ebd.). Dies sei den tradierten Mutterbildern geschuldet, die sich mit der Rolle der Frauen in der westlichen Welt seit dem 19. Jahrhundert entwickelt haben (vgl. Noll 2013: 95; Bange 2018b: 746).
Gemäß Bange (vgl. 2018b: 752) seien nach einer Offenlegung der sexualisierten Gewalterfahrung stets Problematiken hinsichtlich der Eltern-Kind-Beziehung zu erwarten, welche völlig unabhängig von der Qualität der Beziehung einhergehen würden. Viele Eltern haben mit Verunsicherungen und offenen Fragen durch den biografischen Einschnitt und den daraus erfolgten Krisen (Zusammenbruch ihres bisherigen Lebenskonzeptes, Veränderungen und Verlust von sozialen Beziehungen und der Partnerschaft, etc.) zu kämpfen (vgl. Bange 2018b: 752). Die Aufdeckung der sexualisierten Gewalterfahrung des eigenen Kindes kann auch Überforderung auslösen, beispielsweise wenn die Eltern nicht genau wissen, ob und wie sie darüber sprechen sollen, welche Grenzen sie in der zukünftigen Erziehung setzen sollen oder welchen adäquaten Umgang der daraus resultierende Stress und die neuartigen Ängste benötigen. Dabei kann es zum Vertrauensverlust zwischen Eltern und Kind kommen, wenn dem Kind nicht geglaubt wird oder Schuldzuweisungen ausgesprochen werden (vgl. ebd.: 752). Generell ist es von hoher Wichtigkeit, den Eltern, von denen die sexualisierte Gewalt nicht ausgeht, ein individuell angepasstes Hilfsangebot zur Verfügung zu stellen, da Beratungen, Therapien und Interventionen, die die Eltern in den Prozess inkludieren, wirksamer sind, als solche, die sich nur an die Kinder richten (vgl. Bange 2018c: 579). So würde ein hoher Anteil von Kindern keine dauerhaft angemessene Unterstützung erhalten, wenn keine äußeren Interventionsmaßnahmen getroffen werde. Bange beschreibt, dass die Analyse der familiären Lebensumstände vor Planung des Hilfsprozesses unabdingbar sei (vgl. ebd.: 582).
Für die Analyse sollten zahlreiche Fragen zum Verdacht auf sexualisierte Gewalt, der Eltern-Kind-Beziehung, dem sozialen Umfeld und den Lebensbedingungen der Familie, sowie den bisherigen Maßnahmen gestellt werden. Primär gehe es darum, den elterlichen Umgang mit Folgesymptomen der sexualisierten Gewalt an ihren Kindern zu schulen, im Fokus steht dabei die Stärkung der ElternKind-Beziehung und die Art und Weise, wie sie selbst mit der Krise umgehen können (vgl. ebd.). Die Relevanz der Weiterentwicklung dieser Interventions- und Beratungsansätze zeigt sich darin, dass solche Angebote für Mütter und Väter kaum vorhanden sind, obwohl diese maßgeblich in den Bewältigungsprozess ihrer Kinder involviert seien (vgl. ebd.: 588). Dies gilt im gleichen Maß auch für Eltern, die im Laufe des Lebens selbst sexualisierte Gewalt erfahren mussten und sich dann dem Risiko einer sekundären Traumatisierung stellen müssen. Die Art und Weise, wie sexualisierte Gewalt auf das Leben von direkt oder indirekt betroffenen Personen wirken kann und die verschiedenen Ebenen, die diese Folgeerscheinungen berühren, scheinen grenzenlos und nicht vorhersehbar. Jeder Fall von sexualisierter Gewalt muss daher individuell und wie etwas Unbekanntes betrachtet werden; genau darin mag die Komplexität in der Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt liegen. Aufgrund dessen stellen weiterführende Forschungen, politische Diskurse, Aufklärungsarbeit und der Ausbau von Qualitätskriterien für pädagogische Institutionen und Beratungsangebote immer noch fundamentale Elemente in Aufarbeitungsprozessen von sexualisierter Gewalt und der Entwicklung von geeigneten Interventionsmaßnahmen dar.
3 Die Mutter-Kind-Bindung nach Bowlby/Ainsworth
Mit Beginn der Bindungsforschung Mitte des 20. Jahrhunderts, etablierte sich eine neue Sichtweise innerhalb der Wissenschaft. Die in der Psychoanalytik bis dahin verbreitete Untersuchungsweise, nur einzelne Verhaltensvariablen zu betrachten, wurde durch die Beobachtung ganzer Verhaltenssysteme abgelöst (vgl. Grossmann 2000: 225). Um diese komplexen Verhaltensgefüge zu erfassen, war eine interdisziplinär angesetzte Forschungsweise nötig,,,[...] die sich das Ziel setzt, die Bedingungen der Entwicklung individueller psychischer Sicherheit und die damit verbundenen beobachtbaren und theoretisch verstehbaren Risiken offenzulegen" (Grossmann/Grossmann 2015: 15). Vor allem Erkenntnisse aus der Verhaltensbiologie und Entwicklungspsychologie, die das menschliche Verhalten und umweltbedingte Einflüsse auf diese fokussierten, ersetzten die damals vorherrschenden Theorien über Triebe und Objektbeziehungen und ermöglichten damit neue Erklärungsmodelle für menschliches Bindungsverhalten.
Das Ziel dieses Kapitels ist es, zunächst einen Überblick über die wichtigsten Grundannahmen der Bindungstheorie zu geben, die von John Bolwby und Mary Ainsworth etabliert wurde. Dabei wird ein näherer Blick auf das Konzept der (mütterlichen) Feinfühligkeit geworfen, welche als Basis für die Entwicklung einer sicheren Emotionsregulation und Bindungserfahrung seitens des Säuglings gilt. Die empirische Grundlage für die Bindungstheorie lieferte primär die „Fremde Situation", in der das Bindungsverhalten von Kindern analysiert wurde, wodurch anschließend eine Klassifizierung des Bindungsverhaltens von Kindern erfolgen konnte, was in einem weiteren Abschnitt näher erläutert wird (vgl. ebd.: 137).
Das Hauptaugenmerk dieses Kapitels liegt auf der Mutter-Kind-Bindung und es wird sich im Rahmen dieser Arbeit mit den Auswirkungen sexualisierter Gewalterfahrungen bei Müttern beschäftigt; dies soll allerdings nicht implizieren, dass das Geschlecht der Bindungsperson einen unbedingten Einfluss auf die Qualität der Bindung zu einem Kind hat, sondern ist lediglich der Forschungsschwerpunkt vorliegender Ausarbeitung. In Abschnitt 2.2 hat sich zudem gezeigt, dass sexualisierte Gewalterfahrungen weitreichende Auswirkungen auf das Gefühlsleben einer Frau, gleichartig auf die Erziehung ihrer Kinder, haben kann. Daher wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels auf die gesellschaftliche Rolle der Mutter und den normativen Erwartungen an eine gelungene Erziehung in der Theoriebildung zur Mutter-Kind-Bindung umfassender eingegangen.
3.1 Grundannahmen der Bindungstheorie
„Bindungen gehören zu den Ursprüngen der Menschwerdung mit der verlängerten Kindheit des Menschen im Vergleich zu anderen Primaten. Erforderlich ist die individuelle Zuneigung besonderer Erwachsener, die das Kind beschützen, versorgen und in die Kultur einführen. Bindungen gehören zur Natur des Menschen" (Grossmann/Grossmann 2012: 19).
Die Bindung sei laut Bowlby, einem britischen Psychiater und Psychoanalytiker, das menschliche Bedürfnis nach engen, emotionalen Beziehungen und existiere ab derGeburt bis ins hohe Lebensalter. Sie sei eine evolutionsbedingte Uberlebensstrategie, die sich durch das Bedürfnis nach Fürsorge, Zuneigung, sowie Schutz äußere und zwischen einem Menschen und seinen Bindungspersonen bestehe (Ahnert/Spangler 2014: 405). Diese Theorie hob sich von der Lehrmeinung der damaligen Gesellschaft britischer Psychoanalytiker erheblich ab. Bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Ansicht vertreten, dass primär menschliche Grundbedürfnisse, wie der Sexual- oder Nahrungstrieb, für das Bedürfnis einer Kontaktaufnahme zu anderen Menschen verantwortlich seien (vgl. Rauthmann 2017: 87). Bowlby erkannte, dass die Lehren von Sigmund Freud und Melanie Klein, die verschiedene menschliche Verhaltensphänomene, wie beispielsweise Trennungsangst, Liebesbeziehungen, Wut und Trauer bis dahin nur mit Begriffen wie „dependency need" (Abhängigkeitsbedürfnis) und „object relations" (Objektbeziehungen) beschrieben, einer Erneuerung bedürfen (Bowlby 2008: 20; Grossmann/Grossmann 2015: 23). So beschäftigte er sich nach dem zweiten Weltkrieg, unter anderem im Auftrag der WHO, mit den Folgeerscheinungen mangelhafter, unterbrochener oder nicht vorhandener Eltern-Kind-Beziehungen auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern (vgl. Grossmann/Grossmann 2012: 38). Dafür war eine neue theoretische Einordnung nötig, um das Ausmaß der Auswirkungen, die durch Trennungserfahrungen bei heimatlosen Kindern der Nachkriegszeit ausgelöst wurden, begreifen zu können (vgl. Bretherton 2011: 33). Zu der Zeit wurde Bowlbys Interesse für die Ethologie geweckt, unteranderem durch Konrad Lorenz' Forschungsarbeiten, der darstellen konnte, dass bestimmte Vogelarten in den frühen Lebenstagen, auch ohne Einbezug von Nahrung, eine starke Bindung zu dem Muttertier entwickeln können (vgl. Grossmann/Grossmann 2015: 23). Im Rahmen seiner Untersuchungen zu Trennungen von Eltern und Kind, bezog Bowlby auch die Arbeiten von James Robertson mit ein, der das Verhalten von Kleinkindern in Krankenhäusern und Kinderheimen beobachtete (vgl. Rauh 2012: 35). Die Kinder durften von den Eltern kaum bis gar nicht besucht werden und verkümmerten darauffolgend psychisch und physisch (vgl. ebd.). Diese Entwicklung beschreibt Meinhard von Pfaundler mit dem Begriff des Hospitalismus, welche sich phasenweise zunächst in Form von Unruhe, dann in Resignation und abschließend im Verfall äußere (vgl. Hellbrügge 2012: 40). Diese Einflüsse führten dazu, dass „an die Stelle von psychoanalytischen Begriffen über psychische Energie in Form von 'Trieben' und ihrer Entladung [...] bei Bowlby das Konzept der Verhaltenssysteme und ihrer Steuerung [trat]" (Grossmann/Grossmann 2012: 37). Das Bindungsverhalten werde durch die Aktivierung dieser Verhaltenssysteme entwickelt. Die Bindungstheorie befasst sich demnach nicht mit Vorstellungen und Bewertungen von geistigen Zuständen, sondern ganz gegenteilig, mit der Verflochtenheit mentaler Prozesse und der Realität (vgl. ebd.). Das bedeutet, dass sich innere Verhaltensregeln an äußere Gegebenheiten anpassen, hauptsächlich dann, wenn dieses Zusammenspiel mit der Mutter stattfindet, laut Bowlby der bedeutendsten Person dieser Umwelt (vgl. Bowlby 1975: 173).
Inspiriert von Bowlbys Bindungstheorie, führte Harry Harlow verschiedene Experimente mit jungen Rhesusaffen durch (vgl. Suomi/Van der Horst/Van der Veer 2008: 358). Bei einer der vier Vergleichsgruppen des Experiments, wurden die jungen Affen früh von ihren biologischen Müttern getrennt und anschließend von Attrappen, die als Mutterersatz dienen sollten, großgezogen. Eine Attrappe war aus Draht geformt und konnte Milch spenden; die andere Attrappe war mit Stoff überzogen und bot Wärme und Bequemlichkeit, aber keine Milch. Die jungen Affen gingen für die Nahrungsaufnahme zu der Mutter-Attrappe aus Draht, verbrachten jedoch fast den gesamten restlichen Tag bei der mit Stoff überzogenen Mutter-Attrappe und klammerten sich an diese, vor allem, wenn sie Angst verspürten (vgl. ebd.). Auch hier zeigte sich, dass der Nahrungstrieb nicht der Grund für etwaige Bindungsverhaltensmuster der Jungtiere war.
Die körperlichen Effekte, die bei einer Trennung von der Kindesmutter und dem Kind entstehen können, sind laut Grossmann und Grossmann (vgl. 2012: 46) besonders ausführlich bei Ratten und Rhesusaffen erforscht worden. Einige Rhesusaffen zeigten in Untersuchungen bei einer Trennung von der Mutter am ersten Tag Unruhe, erhöhte Aktivität und Versuche, ihre Mutter ausfindig zu machen. Am zweiten Tag sank ihre Aktivität, bis sie am dritten Tag der Trennung gänzlich inaktiv wurden. Diese Passivität ließ den Cortisolspiegel der kleinen Affen erheblich ansteigen, was ein Indiz dafür ist, dass sie unter starkem Stress litten (vgl. ebd.). Der erhöhte Ausstoß des Cortisols mache den Organismus außerdem empfänglicher für Infektionskrankheiten. Reite und Field (1985) gehen davon aus, dass sich die Passivität deshalb einstellt, um Energiereserven zu sparen und bis zur Wiederkehr der Mutter am Leben zu bleiben (vgl. ebd.: 47). Auch wurden Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung der Enzyme im Körper der kleinen Rhesusaffen verzeichnet, was zu funktionellen Störungen ihrer inneren Organe führte, auch, weil das Hormon Noradrenalin, das für die Regulierung der Verhaltenssysteme gebraucht wird, bei der Aufzucht ohne Mutter vermindert produziert wurde (vgl. Gross- mann/Grossmann 2012: 49). In diesem Zusammenhang sind die Erkenntnisse aus der Hirnforschung bei den Rhesusaffen besonders interessant: Die neuronalen Vernetzungen im Gehirn, die planmäßige Verhaltensweisen möglich machen, seien an die sozialen Bindungen gekoppelt (vgl. ebd.). Das bedeutet, dass ohne Bindung zur Mutter, ein hormonelles Ungleichgewicht herrsche und die Fähigkeit soziale Verhaltensregeln zu befolgen, eingeschränkt sei (vgl. ebd.). Bowlbys Ansicht nach, seien Erkenntnisgewinne im Bindungsverhalten von höheren Säugetierarten durchaus auf den modernen Menschen übertragbar (vgl. Bowlby 1975: 190). Schlussfolgernd habe die Mutter ,,[...] bei allen sozial lebenden Saugetieren eine starke, organisierende Wirkung auf das Verhalten und das körperliche Funktionieren des Jungtieres. [...] Die stammesgeschichtliche Entwicklung des Menschen als sozial lebendem Primaten enthält ebenfalls das komplexe Gefüge seiner biologischen Vergangenheit." (Gross- mann/Grossmann 2012: 51).
Bowlby suchte nach deutlichen Zeichen von Bindungsverhalten beim Menschen, die zur Bewahrung von Nähe förderlich sind (vgl. ebd.). In dieser Untersuchungsphase wird Bolwby auf Forschungsarbeiten von Mary Ainsworth aufmerksam. Diese untersuchte die Reaktionen von Müttern auf kindliche Signale und die Auswirkungen dieser Erwiderung auf die Mutter-Kind-Beziehung innerhalb des Volksstammes Ganda in Uganda (vgl. ebd.: 84). Als Ergebnis der Beobachtunge wurde eine Relation zwischen der Bindungsqualität des Kindes und dem Kommunikationsverhalten der Mutter festgestellt. Bindungsverhalten machte sich bei Abwesenheit der Mutter einerseits durch Schreien seitens der sechs Monate alten Kleinkinder bemerkbar und andererseits auch durch Lächeln, Ausstrecken der Arme und Freudentöne, wenn die Mutter wieder in den Raum zurückkehrte (vgl. Bowlby 1975: 191). Jene Verhaltensweisen verstärkten sich in den nächsten drei Lebensmonaten und hielten bis in das zweite Lebensjahr hinein an, woraus Ainsworth schloss, dass sich die Bindungen der Kinder zu ihren Müttern intensiviert und gefestigt habe (vgl. ebd.). Das Schreien kam weniger häufig vor, sobald das Kleinkind fähig dazu war, der Mutter einfacher nachzufolgen, wenn diese aus dem Raum ging. Das Klammern an der Mutter sei besonders nach den ersten neun Lebensmonaten des Kleinkindes sichtbar. Auffallend sei, dass die Kleinkinder zwar Bindungsverhalten auch bei anderen bekannten Personen zeigten, sich dieses Verhalten bei der Mutter jedoch früher, intensiver und kontinuierlicher zeigte. Die Form der mütterlichen Fürsorge habe einen enormen Einfluss auf das Bindungsverhalten des Kindes, aber es sei dahingehend zu beachten, ,,[...] daß das Kind im großen Umfang selbst die Initiative zur Interaktion ergreift und deren Form beeinflusst" (ebd.: 193). Grossmann und Grossmann (vgl. 2012: 37) schreiben hinsichtlich dessen, dass Säuglinge und Kinder auf die Fürsorge und Liebe, sowie dem Schutz ihrer Eltern angewiesen seien und sich deshalb an diese binden müssen, auch wenn die Eltern diesen Aufgaben nur eingeschränkt nachgehen. Säuglinge hätten von Geburt an Fähigkeiten zur Kommunikation, Orientierung und Neugierde, welche an das Fürsorgesystem der Mutter angeglichen sei, was die Basis für die Entwicklung einer sozial-emotionalen Beziehung sei (vgl. Grossmann/Grossmann 2012: 39).
Die Forschungen von Mary Ainsworth in Uganda über die Entwicklung von Bindungsverhaltensweisen von Kleinkindern, glichen in der Art den Vorgehensweisen der biologischen Verhaltensforschung (vgl. ebd.: 84). Ainsworth wiederholte diese Untersuchungen einige Zeit später innerhalb der US-amerikanischen, weißen Mittelschicht von Baltimore und verzeichnete die gleichen Bindungsverhaltensweisen, im selben Entwicklungsablauf, wie bei den Ganda-Kindern aus Uganda (vgl. ebd.). Sie fokussierte sich bei den Beobachtungen nur auf zentrale Kommunikationsversuche, die den Bindungsprozess vorantreiben könnten. Diese Interaktionen waren in Pflegesituationen, wie dem Windelwechseln oder Baden, zu verzeichnen, aber auch in Momenten der alltäglichen Fürsorge, wie dem Füttern, der Herstellung von Körperkontakt, sowie dem Austausch der eigenen Emotionen und Gedanken durch gegenseitiges anschauen oder Weinen seitens der Säuglinge (vgl. ebd.: 85). Anhand der Protokolle, die Ainsworth während dieser Untersuchungen erstellt hatte, konnten bestimmte Interaktionsmuster hergeleitet werden, die förderlich für die Qualität der Mutter-Kind-Bindung waren. So machte es schon einen Unterschied, ob die Mutter beim Verlassen des Raumes das Kind darüber informiert, dass sie geht, wann sie wiederkommt und ob sie beim Wiedersehen das Kind begrüßt (vgl. ebd.). Sie arbeitete daher zwei Methoden zur Feststellung der Bindungsqualität von Mutter und Kind aus: Einerseits die Herbeiführung der „Fremden Situation", womit sie verschiedene, kindliche Bindungsverhaltensmuster voneinander abgrenzte und klassifizierte, sowie andererseits die Skala zur Erfassung der mütterlichen Feinfühligkeit bzw. Unfeinfühligkeit.
3.1.1 Die Fremde Situation
Bowlby und Ainsworth gingen davon aus, dass die Mutter als sicherer Ausgangspunkt für Explorationen von Kindern, eine Hauptvoraussetzung für die Bildung einer gesunden Bindung sei (vgl. Grossmann/Grossmann 2015: 113). In den ethologischen Untersuchungen von Ainsworth wurde sichtbar, dass Kinder in der bekannten, häuslichen Umgebung eher selten Bindungsverhalten und dafür öfter autonomes Explorationsverhalten zeigten (vgl. Grossmann/Grossmann 2012: 136). Diese unbeschwerten Verhaltensmuster änderten sich jedoch, wenn die Kinder in eine fremde Umgebung gebracht wurden, in der sie keinen Schutz erwarten konnten. Jene Erkenntnisse verleiteten Ainsworth dazu, die „Fremde Situation" zu konzipieren, um Bindungsverhaltensmuster von Kindern näher untersuchen zu können, wenn ihr Gefühl von Sicherheit ausgesetzt wird (vgl. Grossmann/Grossmann 2012: 136).
Die Fremde Situation wurde in zwei benachbarten Büroräumen einer Universität an sieben weiblichen und sieben männlichen Kindern (51 bis 58 Wochen alt) in insgesamt acht Untersuchungsepisoden mit maximal drei Minuten langen Sequenzen durchgeführt (vgl. Kirschke/Hörmann 2014: 6f). Der standardisierte Ablauf war wie folgt (vgl. ebd.): Die Kinder wurden in einen für sie fremden Raum gebracht, in dem sich ein Spielzeug befand (Phase 1). Während diese selbstständig den Raum erkunden konnten, sollten ihre Mütter lesen (Phase 2). Dann betrat eine unbekannte Person den Raum, die sich dem Kind näherte (Phase 3). Die Mutter verließ daraufhin den Raum (Phase 4). Nach kurzer Zeit kehrte die Mutter in den Raum zurück und die fremde Person verließ den Raum (5. Phase). Anschließend ging die Mutter wieder aus dem Raum und das Kind blieb alleine (6. Phase). Wenig später betrat die fremde Person erneut den Raum (7. Phase). Zuletzt kam es zu einer zweiten Wiedervereinigung zwischen Mutter und Kind (8. Phase). Die bedeutendsten Ergebnisse aus diesem standardisierten Verfahren waren, dass die Kinder ihre Mütter als sicheren Ausgangspunkt zur Exploration der Fremden Situation nutzen konnten und die Kinder durch die fremde Person in relativ geringem Maße irritiert wurden, auch wenn ihre Mütter abwesend waren (vgl. Kirschke/Hörmann 2014: 8; Grossmann/Grossmann 2015: 141). Die Exploration der Kinder reduzierte sich bei einer vorübergehenden Trennung von der Mutter, sie weinten öfter und versuchten, die Mutter zurückzuholen. Die wiederholte Trennung verstärkte diese Reaktion der Kinder. Bei dem Wiedersehen mit der Mutter waren die gängigsten Erwiderungen nach der ersten Trennung, sich der Mutter anzunähern und nach der zweiten Trennung, sich an sie zu klammern. Außerdem war bei den Kindern eine Veränderung hinsichtlich ihres Bindungsverhaltens vor und nach der Abschottung von der Mutter zu verzeichnen. Während die Kinder vor der ersten Trennung den Körperkontakt zu der Mutter ohne Widerstand beenden ließen, versuchten sie diesen nach der zweiten Trennung zu bewahren (vgl. ebd.).
Laut Grossmann und Grossmann sei die Fremde Situation methodologisch weder Test, noch Experiment, ,,[...] sondern eher [...] eine kontrollierte, systematisierte Situation für ethologische Beobachtungen, die eine kundige Diagnose von Bindungsverhaltensstrategien unter standardisierten Spiel- und Trennungssituationen erlaubt" (Grossmann/Grossmann 2012: 141).
Ainsworth versuchte mithilfe der Resultate aus den Beobachtungen der Fremden Situation wiederkehrende und sich gleichende Bindungs- sowie Explorationsverhaltensmuster bei den Kindern ausfindig zu machen (vgl. Grossmann/Grossmann 2012: 141). Sie klassifizierte die unterschiedlichen Verhaltensformen anhand der Emotionsregulation der Kinder und teilte sie dann in drei sogenannte „organisierte" Bindungsqualitäten auf (vgl. Kirschke/Hörmann 2014: 9): Die unsicher-vermeidende Bindung (Bindungstyp A), die sichere Bindung (Bindungstyp B) und die unsicher-ambivalente Bindung (Bindungstyp C). Später erweiterte die Psychologin Mary Main die Klassifizierungen um einen weiteren Bindungstyp, indem sie die unsicher-desorganisierte Bindung (Bindungstyp D) hinzufügte, die als „desorganisiertes" Bindungsmuster gilt (vgl. ebd.: 11).
Bei der sicheren Bindung reagiere das Kind auf eine Trennung von der Mutter mit starken Zeichen der Unmut (zum Beispiel durch Weinen und Schreien). Das Kind sei durch die unbekannte Person nicht zu beruhigen und zeige erst bei Wiedervereinigung mit der Mutter Signale der Freude, indem es die Nähe zur Mutter sucht, diese anlächelt oder anderweitige Aufmerksamkeit schenkt. Sicher gebundene Kinderzeigen somit ihre Emotionen offen. Die unsicher-vermeidende Bindung zeige sich bei Kindern, die in der Fremden Situation durch Autonomiebedürfnisse und ausgeprägter Exploration auffallen. Das Interesse daran, Nähe zu ihrer Mutter zu haben, sei tendenziell gering, was sich insbesondere im Moment der Trennung und des Wiedersehens bemerkbar mache. Auch sei das Verhalten des Kindes bei der fremden Person nicht bemerkenswert anders, als bei der Mutter. Diese Kinder tendieren dazu, ihre Gefühle zu unterdrücken. Bei der dritten Variante, der unsicher-ambivalenten Bindung, würden die Kinder in der Trennungssituation angsterfüllte, unbeholfene und klammernde Verhaltensweisen zeigen. Weder die fremde Person, noch die Mutter bei ihrer Rückkehr, seien in der Lage, das Kind zu beruhigen. Oft würde die wiedererlangte Nähe zur Mutter eher Misstrauen und Verärgerung bei dem Kind auslösen. Die unsicher-desorganisierte Bindung, welche erst Jahre später von Mary Main klassifiziert wurde, äußere sich durch konfuse Verhaltensweisen des Kindes nach der Trennung von der Mutter und der anschließenden Zusammenführung. Die Kinder würden sich impulsiv und paradox benehmen, teilweise auch mit leichter Wut gegen die Mutter selbst (Kirschke/Hörmann 2014: 12; Otto/Keller 2012: 5).
Die Bindungsklassifikationen unterliegen keinen quantitativen Bezeichnungen, da davon ausgegangen wird, dass alle Kinder Bindungen entwickeln. Somit existiere keine Bindung, die sich vermehren oder vermindern kann. Lediglich das Bindungsmuster - und damit die Bindungsqualität - könne verändern werden (vgl. Main 2012: 7).
Bowlbys Theorien zur Bindung wurden erst durch die von Ainsworth entwickelte Fremde Situation auch praktisch beobachtbar. Zwar sei die Fremde Situation für die Qualitätserfassung der Mutter-Kind-Bindung nur bei Kindern im Alter von elf bis zwanzig Monaten anwendbar, da die herbeigeführte Fremde Situation in einem höheren Alter womöglich nicht mehr das Bindungsverhalten aktiviere, jedoch sei es damit zumindest altersspezifisch möglich gewesen, den Prozess der Bindungsentwicklung und die dafür notwendigen Verhaltensmuster der Kinder und Mütter empirisch basiert zu untersuchen (vgl. Grossmann/Grossmann 2015: 113). Die endgültige Etablierung der Bindungstheorie innerhalb der Wissenschaft war laut Bowlby demnach erst durch Folgendes möglich: Dem Einsatz eben dieser Forschungsmethoden und der damit verbundenen Veränderung damaliger psychoanalytischer Denkmuster, die zunehmende Relevanz der Verhaltensbiologie, sowie die Zusammenarbeit mit Mary Ainsworth (vgl. Grossmann und Grossmann 2015: 14).
Die Grundannahmen der Bindungstheorie lassen sich zusammenfassend in drei wichtige Bezugspunkte unterteilen. Das evolutionsbedingte Grundbedürfnis nach Bindung, drücke sich bei einem gesunden Kind in erster Linie durch Emotionen aus und bilde die erste Basis der Bindungstheorie (vgl. Grossmann/Grossmann 2012: 53). Emotionen würden sich in der Regel nicht im Verborgenen abspielen, sondern seien seh- und hörbar. Die Kommunikation durch die Emotionen sei deshalb die zweite Basis der Bindungstheorie (vgl. ebd.). Die dritte Basis der Bindungstheorie sei die Sprachfähigkeit, oder vielmehr die Fähigkeit, Denkprozessen eine gewisse Bedeutung beizumessen und die Erfahrungen mit der Bindungsperson emotional einzuordnen (vgl. ebd.: 56). Die elterliche Bindungsperson habe in der Regel die notwendigen Ressourcen dafür, um die Informationen, die sie vom Kind durch kommunikative Interaktionen erhält, verstehen zu können. Die kindlichen Bedürfnisse nach Schutz und Nähe, die sich durch unterschiedliche Signale äußern, seien durch eine feinfühlige Verhaltensweise seitens der Bindungsperson zu erwidern (vgl. ebd.: 57). Bowlby und Ainsworth waren also der Ansicht, dass es „bei der [...] Begründung der Bindungstheorie [...] um die Entwicklung grundlegender Qualitäten des formenden Umgangs mit zentralen Lebensaufgaben in einer Welt evolutionärer Angepaßtheit [gehe]" (Grossmann/Grossmann 2015: 17).
In der überwiegenden Mehrheit der Beobachtungen aus der Fremden Situation, aber auch aus Abhandlungen anderer Forscher, konnte ein sicheres Bindungs- und Explorationsmuster des Kindes festgestellt werden, insofern die Mutter ein hohes Maß an Feinfühligkeit zeigte (vgl. ebd.). Infolgedessen entwickelte Ainsworth Skalen zur Erfassung mütterlicher Feinfühligkeit bzw. Unfeinfühligkeit gegenüber kindlichen Signalen, welche im nachfolgenden Abschnitt näher betrachtet werden.
3.1.2 Skalen mütterlicher (Un-)Feinfühligkeit
Die mütterliche Feinfühligkeit besteht nach Ainsworth aus vier wichtigen Elementen, die sich aus der Wahrnehmung von Signalen, der korrekten Interpretation dieser Signale und geeigneten Erwiderung, sowie der unmittelbaren Reaktion auf die Signale zusammensetzen (vgl. Grossmann/Grossmann 2015: 415).
Dabei wird zwischen hochgradig feinfühlig, feinfühlig, unbeständig feinfühlig, unfeinfühlig und hochgradig unfeinfühlig unterschieden. Grossmann und Grossmann führen folgende Beschreibungen zu den einzelnen Bewertungsskalen aus (vgl. 2015: 418ff):
Als hochgradig feinfühlig werden die Fähigkeiten einer Mutter genannt, auf die Signale ihres Kindes umgehend und adäquat reagieren zu können. Die Interaktionen zwischen der Mutter und dem Kind harmonieren und sie ist sich den Bedürfnissen ihres Kindes genau bewusst. Sie stellt ihre eigenen Wünsche nach hinten und achtet detailreich auf nonverbale und verbale Zeichen ihres Kindes und ermöglicht dem Kind fast jeden seiner Wünsche. Wenn dies nicht möglich ist, kommuniziert sie das auf eine einfühlsame Weise und zeigt andere Alternativen auf. Die Interaktionen zwischen Mutter und Kind sind aufeinander abgestimmt und so ausgeführt, dass beide Zufriedenheit verspüren.
Eine als feinfühlig bewertete Mutter kann die Signale ihres Kindes ebenfalls korrekt wahrnehmen und angemessen erwidern, allerdings mit einer geringeren Feinfühligkeit. Damit ist gemeint, dass sie den unterschwelligen Kommunikationsversuchen ihres Kindes unter Umständen weniger Beachtung schenkt und nicht unmittelbar auf diese reagiert. Dennoch kann sie das Verhalten ihres Kindes korrekt deuten und sich an dessen Stimmung anpassen. Unmissverständliche Signale ihres Kindes nimmt sie dennoch immer wahr und kann diese auch angemessen erwidern.
Die unbeständig feinfühlige Mutter kann zwar feinfühlig sein, allerdings gibt es Momente, in denen sie die Signale ihres Kindes nicht richtig deuten kann. Ihre Feinfühligkeit ist damit nur teilweise vorhanden. Es gibt Situationen, in denen sie die Kommunikationsversuche ihres Kindes wahrnimmt und angemessen darauf reagiert, jedoch gibt es auch Umstände, unter denen sie kein Interesse an den Signalen ihres Kindes zeigt. Das führt dazu, dass auch ihre unmittelbaren Reaktionen auf die Signale des Kindes nur unregelmäßig auftauchen. Wird das Verhalten der Mutter im Gesamtbild betrachtet, so ist diese Mutter mehrheitlich feinfühlig als nicht feinfühlig gegenüber ihrem Kind.
Unfeinfühlig ist eine Mutter dann, wenn sie zumeist nicht angemessen oder unmittelbar auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingeht, auch wenn sie in einigen Situationen Feinfühligkeit gegenüber ihrem Kind zeigen kann. Sie ist nicht in der Lage, einen Perspektivwechsel zugunsten ihres Kindes zu unternehmen, weshalb sie dessen Signale und Kommunikationsversuche nicht deuten kann. Auch stellt sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht hinter denen ihres Kindes und unterbricht Interaktionen zu ihrem Kind so, dass Unzufriedenheit aufkommt. Trotz einer klaren Unfeinfühligkeit der Mutter, sind ihre Verhaltensweisen nicht durchgängig nur unfeinfühlig. Sie ist in der Lage, ihre eigenen Ambitionen zu ändern, wenn die Signale des Kindes auf sehr ausdrückliche Weise wahrzunehmen sind und dann relativ feinfühlig mit ihrem Kind umzugehen.
Unter hochgradig unfeinfühlig werden die Verhaltensweisen einer Mutter dann verstanden, wenn diese fast ausnahmslos nach ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen gerichtet sind. Sie interagiert nur dann mit ihrem Kind, wenn sie das selbst möchte und nimmt die Signale ihres Kindes erst dann richtig wahr, wenn diese ausdrucksstark und repetitiv sind. Doch die verspätete Erwiderung auf die Signale allein, ist schon unfeinfühlig. Ferner ignoriert oder missversteht sie die Kommunikationsversuche ihres Kindes und gibt dadurch keine angemessene Antwort auf diese.
Diese Ausführungen über die mütterliche Feinfühligkeit in Anlehnung an Grossmann und Grossmann sind hier zwar heruntergebrochen dargestellt, in der Sinnhaftigkeit jedoch adäquat. Durch das Konzept der Feinfühligkeit wurden gängige Denkmuster der westlichen Welt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kontrovers diskutiert. Es gab erstmalig empirisch fundierte Evidenzen für die Annahme, dass das Bedürfnis eines menschlichen Säuglings oder Kindes nach Bindung zu einer primären Bezugsperson, evolutionär bedingt, sowie erblich veranlagt ist (vgl. Otto/Keller 2012: 4). Unter anderem wird psychische Sicherheit durch das Prinzip der Feinfühligkeit von Grossmann und Grossmann als das ,,[...] Vertrauen in die schützende Nahe zur Bindungsperson, gekoppelt mit dem Vertrauen in ihren emotional unterstützenden Beistand beim Umgang mit eigenen psychischen Belastungen und auch bei risikoreicher, trotzdem aber spielerischer, gemeinsamer Exploration [beschrieben]" (Grossmann/Grossmann 2012: 186).
Auch wenn es bei der Betrachtung der Feinfühligkeit eher um die Mutter-Kind-Bindung geht, als ausschließlich um mütterliche Verhaltensweisen (vgl. Künster/Ziegenhain 2014: 22), ist an dieser Stelle die Rolle der Mutter innerhalb der Bindungstheorie kritisch zu hinterfragen, da zahlreiche Interventionsprogramme auf der Bindungstheorie und somit auch auf dem Konzept der mütterlichen Feinfühligkeit basieren (vgl. Grossmann/Grossmann 2012: 165; Denker 2012: 26). Im nachfolgenden Kapitel wird ausgehend davon diskutiert, welches normative Mutterbild den bindungstheoretischen Grundannahmen von Bowlby und Ainsworth zugrunde liegt.
3.2 Das Mutterbild der Bindungstheorie
Im Hinblick auf die Relevanz der bindungstheoretischen Annahmen für die Intervention, Prävention, Beratung und Psychotherapie, ist ein kritischer Blick auf das dahingehend erzeugte Mutterbild unerlässlich, denn diese Unterstützungsangebote spielen wiederum eine bedeutende Rolle bei Aufarbei- tungs- und Bewältigungsprozessen von Frauen und Müttern mit sexualisierten Gewalterfahrungen.
Es mag aufgefallen sein, dass der Mutter innerhalb der Bindungstheorie in der Vergangenheit - und auch in der gegenwärtigen Bindungsforschung - ein äußerst hoher Stellenwert beigemessen wird. Die Mutter wird in der Bindungsforschung überwiegend als die primäre Bezugsperson eines Kindes dargestellt und Grossmann und Grossmann behaupten gar, dass deshalb ,,[...] eine Hilfe für den Säugling langfristig im Wesentlichen nur über die Mutter möglich [sei]" (Grossmann/Grossmann 2012: 165). Daraus wird ersichtlich, dass es zwei Faktoren gibt, die in der Bindungsforschung bevorzugt betrachtet werden: Die Mutter-Kind-Bindung aus Sicht des Kindes und die Verhaltensweisen der Mutter. Zwar thematisieren beispielsweise Grossmann und Grossmann (2012: Kapitel III.4) auch den Vater als mögliche Bindungsperson des Kindes, dies in Relation allerdings eher am Rande und deklariert als „Helfer beim Explorieren und Herausforderer". Solche Formulierungen führen dazu, dass der Vater theoretisch nur eine untergeordnete Rolle innerhalb des familiären Beziehungsgefüges einnimmt. Er ist Unterstützer und „zweite Bindungsperson" (ebd.: 229), doch kein Hauptakteur, solange die Mutter anwesend ist. Es wird das Bild des „vertrauten, starken und weisen Gefährten" (ebd.: 231) gezeichnet, während die Mutter die zuverlässige, feinfühlige Seite einnimmt, in der Verantwortung, kindliche Ängste abzuwehren (vgl. ebd.). Dies deutet an, dass in einer normtypischen Familie des Westens mit Vater, Mutter und Kind, die Eltern jeweils voneinander abweichende - und für ihre Rollen als Mutter und Vater entsprechend zugeschnittene - Kompetenzen und Verantwortungsbereiche gegenüber ihrem Kind haben, die von Natur aus auf eine bestimmte Weise bereit gestellt werden. Sicherlich werden auch Umstände angesprochen, die nicht in dieses Muster fallen, doch die Kernaussage bleibt grundsätzlich bestehen: Die Mutter sei die primäre Bezugsperson eines Kindes und damit hauptverantwortlich für das kindliche Wohlbefinden. Auch wenn sich die Bindungstheorie von den gängigen Leitvorstellungen der Psychoanalytik des 19. Jahrhunderts größtenteils abhob, scheinen einige Aspekte dennoch Einfluss gehabt zu haben. Freud vertrat beispielsweise die Ansicht, dass die Mutter für den Erfolg ihrer Kinder zuständig sei und diese Aufgabe idealerweise mit Liebe, Zärtlichkeit und Freude ausführen solle; gegenteilige Verhaltensweisen wurden pa- thologisiert (vgl. Noll 2013: 103). Eickhorst et. al. (2010) konnten in einer Studie aufzeigen, dass keine signifikanten Differenzen zwischen Müttern und Vätern in der Feinfühligkeit gegenüber ihren Kindern existieren. Es wurde lediglich ein Unterschied dahingehend verzeichnet, dass innerfamiliäre Belastungen die mütterliche Interaktion, aber nicht die der Väter beeinflussen, was auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden könnte (vgl. Eickhorst et. al. 2010: 1131)
Das heutige, normative Mutterbild der westlichen Welt ist weiterhin stark von der Annahme einer natürlich vorhandenen Mutterliebe und dem Idealbild einer fürsorglichen, zärtlichen und aufopfernden Mutter geprägt (vgl. Noll 2013: 97). Die geschlechtsspezifischen Normvorstellungen über eine naturgegebene Berufung, zeigen ihre partiell verdeckten Widersprüche, wenn kontextuell ein Blick auf den historischen Verlauf gesellschaftlicher Macht- und Denkstrukturen geworfen wird. Denn viele Zuschreibungen, die in Verbindung mit Geschlechterrollen getätigt werden, haben ihren Ursprung vielmehr in soziokulturellen Denkmustern als in biologischen Gegebenheiten. Folgendes Zitat von Hahn (2020: 1) in Anlehnung an Kate Manne fast diesen Punkt einleuchtend zusammen:
„Viel problematischer für Frauen, auch weil latent übersehbar, sei, dass patriarchalische Ideologien und misogyne Normativitäten institutionell in Gesellschaften, ihre Teilbereiche und in Organisationen eingespielt werden [...] [und] [...] ein Klima [reproduzieren], das Frauen diszipliniert, ohne sie frontal anzugreifen".
Die Gründe der sozialen Zwänge, die mit einer Mutterschaft einhergehen, werden also vielfach als das Ergebnis vorherrschender Denkmuster gesehen, die von hegemonialer Männlichkeit in westlichen Kulturen geprägt sind (vgl. Noll 2013: 104; Geier 2020: 9). Dies beinhaltet die Einteilung von Frauen in „gut" und „böse" aufgrund typisierter Eigenschaftszuschreibungen, sowie die gesellschaftliche Bewertung der „naturgegebenen" Mutterschaft (vgl. Geier 2020: 14). Solche sozialen Wertungen seien Teilstrategien zur Machterhaltung des Patriarchats. Auch wenn der gesellschaftliche Diskurs gegenwärtig auf Geschlechtergleichberechtigung zugeht, sind es doch subtilere Ausprägungen der Geringschätzung von Frauen, die oft übersehen werden. Es scheint, als seien solche etablierten Rollenbilder und traditionellen Familienmodelle nur schwer aus dem gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein zu löschen. Laut Büchele (2010: 76) fehle „die öffentliche Empörung, die Voraussetzung wäre, um grundlegende Veränderungen zu erreichen, [denn] das Problem ist gesellschaftlich an die Frauen und Helfersysteme delegiert". Das kollektive Verständnis von der Familie als ein Ort des Schutzes, des harmonischen Zusammenlebens und der Mutter als die Inkarnation des Guten, habe sich fest in die Köpfe gebrannt, sodass davon abweichende Darstellungen kaum akzeptiert werden würden. Die Lebenswirklichkeit von vielen Frauen ist daher oftmals geprägt von ambivalenten Gefühlen hinsichtlich des Mutterseins, zumal sie sich dem Druck ausgesetzt fühlen, gesellschaftlichen Zwängen und Erwartungen folgen zu müssen (vgl. Noll 2013: 105). Auch Schütze (vgl. 2000: 95f) sieht den Einfluss der Bindungstheorie auf das Mutterbild ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert als sehr stark an und bekräftigt, dass kindliche Entwicklungsdefizite gehäuft auf (un-)bewusste Verhaltensweisen der Mutter zurückgeführt werden, womit sich gesellschaftlich erzeugte Rollenzwänge weiter verstärken. Dies sei besonders erkennbar im Hinblick auf die gesellschaftlich mitverursachte und weit verbreitete Unverträglichkeit von Berufsleben und Mutterschaft in vielen europäischen Ländern (vgl. Noll 2013: 105).
In der frühen Entwicklungsphase der Bindungstheorie war bereits bekannt, dass es kulturelle Unterschiede in den Verhaltensmustern von Männern und Frauen gibt, die sich vom westlichen Ge- schlechterrollenbild abheben. Trotzdem porträtieren laut Otto und Keller (2014: 7) die Grundlagen der Bindungstheorie überwiegend „Erziehungsziele und Erziehungspraktiken in westlichen Mittelschichtfamilien". Diese westlichen Wertvorstellungen seien von dem Wunsch nach psychologischer Autonomie und Individualität geprägt, in der das Kind und seine Bedürfnisse zentriert werden. Otto und Keller sehen die Bindungstheorie umgeben von einer Art „kulturellen Blindheit" (2012: 6) und auch Kärtner (2018: o.A.) spricht davon, dass der „Blick durch die eigene kulturelle Brille im Kontext allen pädagogischen, erzieherischen und therapeutischen Handelns die Gefahr der normativen Bewertungsmaßstäbe [birgt und], [...] mögliche Folgen [...] defizitäre Interpretationen und die Pathologisierung alternativer Sichtweisen [sind]".
Obwohl sich Mary Ainsworth durchaus mit verschiedenen Kulturen auseinandergesetzt hat (siehe die Feldbeobachtungen zu Ganda-Müttern aus Uganda) und sich daher des induktiven Charakters von Beobachtungen als Erfassungsinstrument in Untersuchungen bewusst gewesen sein muss, dominieren bei der Formulierung ihrer Hypothesen dennoch die von Otto und Keller angesprochenen Wertvorstellungen der westlichen Welt. Das zeigt sich dadurch, dass die Bindungstheorie die kontextbezogenen, kulturellen Einflüsse nie verleugnete (vgl. Keller 2014: 111), gleichzeitig aber das sichere Bindungsmuster als universelle Bedingung für die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit erklärt. Die unmittelbare Reaktion auf kindliche Signale, gepaart mit sanften und wohlwollenden Verhaltensweisen, stünden laut Keller (vgl. 2014: 114) nicht unbedingt in einer Wechselbeziehung zueinander und würden sich in unterschiedlichen Kulturen stets anders zeigen. Als Beispiel für die gesellschaftsspezifischen Unterschiede, die dem individuellen Blick auf das Kind unterliegen, führen Otto und Keller einen Vergleich an. Das Lächeln eines Säuglings würden deutsche Mütter als Ausdruck von Freude und Spaß verstehen und infolgedessen mit hoher Wahrscheinlichkeit anfangen, mit dem Säugling zu interagieren (Otto/Keller 2012: 4). Kamerunische Mütter hingegen würden das Lächeln eher als Zeichen von Gesundheit werten, weshalb sie in dieser Situation keinen Handlungsbedarf se- hen würden. Beide Interpretationen des Lächelns sind positiv konnotiert, zeigen aber dennoch jeweils unterschiedliche Verhaltenswahrnehmungen und rufen daher auch voneinander abweichende Reaktionsmuster seitens der Mütter hervor. Generell sei es global betrachtet nicht üblich, dass ein Kind nur ein oder zwei enge Bindungspersonen in dem ersten Lebensjahr habe, sondern es gäbe auch Volksgruppen, in denen das gesamte Dorf die erzieherische Verantwortung für ein Kind traget und dort dementsprechend andere Umgangsformen üblich seien (vgl. Otto/Keller 2012: 7). In diesen Gesellschaftsgefügen stehe das soziale Miteinander im Mittelpunkt und nicht die Individualität. Während in der westlichen Welt die Erziehung also eher Privatsache ist, wird in anderen Teilen der Erde gemeinschaftlich gedacht. Aus kulturvergleichender Sicht könne demnach nicht davon ausgegangen werden, dass sich Bindung weltweit auf dieselbe Weise entwickele, sondern unterschiedlich wahrgenommen werde. Keller (vgl. 2014: 123) wünscht sich in der Weiterentwicklung der Bindungsforschung daher eine Integration von unterschiedlichen, kulturellen Werten und Normen, was angesichts der aufgeführten Argumentationen durchaus anzustreben ist.
Zusammenfassend ist die Bindungstheorie Grundlage und Wegbereiter der heutigen Bindungsforschung. Der disziplinübergreifende Blickwechsel auf die Beziehung zwischen Mutter und Kind hat zu der vielfach empirisch belegten Erkenntnis geführt, dass den frühkindlichen Bindungserfahrungen eine besondere Bedeutung beigemessen werden kann. Bindungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, psychische Sicherheit zu erlangen und emotional stabil zu bleiben. Auch wenn es innerhalb der Bindungsforschung schon seit den Anfängen der Bindungstheorie Kontroversen bezüglich der methodischen Vorgehensweisen, theoretischen Eingrenzung und Begriffsdefinitionen gibt (vgl. Mead 1962; Berghaus 2011; Fitzgerald 2020), haben sich die zuvor aufgeführten Grundannahmen weitgehend durchsetzen können. Obwohl sich das Mutterbild stets in einem gesellschaftlichen und individuellen Wandel befindet und in öffentlichen Diskursen immer wieder neu erfunden wird, ist die Betrachtung des realen Alltags von Müttern innerhalb der Forschung eher rar (vgl. Noll 2013:104). Doch auch innerhalb der professionellen Beratungsangebote für Frauen mit sexualisierten Gewalterfahrungen gäbe es einige Mängel. Dazu gehöre, dass etwaige Lebensbereiche, die von dem krisenhaften Ereignis auf (un-)bewusste Weise beeinflusst werden, in einer professionellen Therapie oder der Familienhilfe nicht beleuchtet werden (vgl. ebd.). Daher wird im nächsten Abschnitt das bindungstheoretische Frühinterventionsprogramm STEEP™vorgestellt, dessen Implementierung in die Angebotslandschaft für Mütter mit sexualisierten Gewalterfahrungen einerseits eine Ergänzung für Fachberatungsstellen sein könnte und andererseits eine Alternative zu familientherapeutischen Angeboten oder der gesetzlich verankerten Sozialpädagogischen Familienhilfe bieten könnte.
4 Das bindungstheoretische Interventionsprogramm STEEP™
Das STEEP™-Programm wurde 1987 von Martha Erickson und Byron Egeland entwickelt und vom National Institute of Mental Health der University of Minnesota in den USA als Teil des Minnesota Parent-Child-Projects finanziell gefördert (vgl. Erickson/Egeland 2006: 29). In der Forschung sei auf unterschiedliche Weise bereits nachgewiesen worden, dass Kinder, die in einkommensschwachen Haushalten aufwachsen oder deren Mütter jung und alleinerziehend sind, stärkere Entwicklungsprobleme aufweisen würden als Kinder, die von zwei Elternteilen und unter finanzieller Sicherheit aufgezogen werden. Dennoch seien innerhalb der unterschiedlichen familiären Situationen große Unterschiede festzustellen, sodass auch Kinder, die unter erschwerten Bedingungen aufwachsen, einen problemlosen Entwicklungsverlauf aufzeigen können. Um diesen Prozess nachvollziehen zu können, wurde das Minnesota Parent-Child-Project gestartet. Dieses ist eine seit 1975 geführte Längsschnittstudie, die sich primär mit der Frage beschäftigt, woran es liegt, dass einige Kinder im Erwachsenenalter kompetent und stabil wurden, obwohl sie unter besonders psychisch belastenden Umständen aufgewachsen sind (vgl. ebd.: 27).
Unter anderem ist ein generiertes Ergebnis der Studie, dass Misshandlungszyklen durch eine bewusste Aufarbeitung des Geschehenen durchbrochen werden können. Das bedeutet, dass Eltern, die eigene psychosoziale Belastungen nicht auf ihre Kinder übertragen, sich mit ihren Lebenskrisen auseinandergesetzt und teilweise aufgearbeitet haben, gehäuft mithilfe einer professionellen Therapie, die sich über mindestens sechs Monate erstreckt hat (vgl. Erickson/Egeland 2006: 36). Somit sind internale Arbeitsmodelle nicht statisch, sondern wandelbar, wodurch generationenübergreifende Negativ-Kreisläufe unterbrochen werden können (vgl. Kißgen/Suess 2005: 14). Die Feststellung, dass bei der Umgangsqualität mit dem eigenen Kind die gegenwärtige Lebenseinstellung einer Mutter bedeutsamer ist, als ihre vergangenen Erfahrungen in der Kindheit, „legitimiert eindrucksvoll jedwede Form präventiver Arbeit mit den Eltern im Hinblick auf das Wohlergehen des Kindes" (ebd.).
Eine weitere Erkenntnis ist, dass sicher gebundene Kinder kompetentere Umgangsformen innerhalb ihrer Altersgruppe und im Spiel konstruktivere Lösungen aufzeigten, selbstbewusster und emphatischer seien sowie ein höheres Selbstwertgefühl haben würden, als die unsicher gebundenen Kinder (vgl. ebd.: 16f). Die unsicher gebundenen Kinder würden durch stärkere Abhängigkeit oder ein höheres Bedürfnis nach Anlehnung auffalen und allgemein eine eher indirekte Annäherung präferie- ren. Außerdem wurde ersichtlich, dass Erzieherinnen unterschiedliche Interaktionsmuster gegenüber den Kindern aufzeigen würden, die direkt mit den Bindungsklassifikationen verknüpft werden könnten. Dies könne als Beweis dafür gesehen werden, dass Kinder ihre Umwelt aktiv im Sinne ihrer gemachten Bindungserfahrungen gestalten und dazu tendieren, Reaktionsmuster ihrer Bindungsperson zu erzeugen, die ihre vergangenen Erfahrungen spiegeln (vgl. ebd.: 17).
Erickson und Byron haben sich diese bindungswissenschaftlichen Betrachtungsweisen zu nutze gemacht und daraus ein Instrument für die Praxis entwickelt. Die Bedeutung der Bindungsqualität zwischen Eltern und Kind, sowie die Wichtigkeit generationenübergreifender Kreisläufe elterlicher Verhaltensweisen, bilden die Kernthemen des hiervorgestellten Interventionsprogramms. Daraus lässt sich die Philosophie von STEEP™ herleiten: Dazu gehören 1.) die Unterschiede in den Bindungsmustern zu erkennen und dadurch eine sichere Eltern-Kind-Bindung zu fördern, 2.) die Feinfühligkeit als entscheidende Bedingung für den Aufbau einer sicheren Bindung anzusehen und der Mutter damit zu helfen, die Signale ihres Kindes besser zu deuten und zu beantworten, 3.) anzuerkennen, dass auch die Mutter Unterstützung und Zuwendung braucht sowie 4.) Bewältigungsmuster zu erkennen, welche die Entwicklung einer sicheren Eltern-Kind-Bindung verhindern, um die Eltern anschließend dahingehend zu unterstützen (vgl. Erickson/Egeland 2006: 36f). Hierbei sollten sich die Grundsätze von STEEP™, dass die Mutter-Kind-Beziehung in die Familie und Gesellschaft integriert ist, jede Familie und Person einen individuellen Beratungsansatz benötigt und jede Person innerhalb eines familiären Gefüges Stärken hat, die aufgebaut werden können, stets vor Augen gehalten werden (vgl. ebd.: 38f).
Auf Basis all dieser Aspekte, versteht sich das Programm als forschungsgestützt und familienfokussiert (vgl. ebd.: 29f). In den nachfolgenden Seiten werden die Ziele und einzelnen Methoden von STEEP™, die auf verschiedenartigen Interventionsebenen stattfinden, näher beschrieben.
4.1 Ziele von STEEP™
Unter anderem inspiriert durch die Ergebnisse der zuvor vorgestellten Studie, wurden zunächst Faktoren herausgearbeitet, die sich vorteilhaft auf die „Risikoumwelt" (Erickson/Egeland 2006: 29) auswirken und anschließend zu folgenden acht allgemeinen Zielen des STEEP™-Programms formuliert:
1. „Wir wollen gesunde, realistische Einstellungen und Erwartungen hinsichtlich Schwangerschaft, Geburt und Kindererziehung fördern" (Erickson/Egeland 2006: 39).
Schwierigkeiten bei der Erziehung entstehen oftmals durch starke Idealisierung oder Negativität hinsichtlich der bevorstehenden Elternrolle. Beide Extreme führen letztendlich zu Enttäuschungen, wenn die Erwartungen an den neuen Lebensabschnitt nicht erfüllt werden. Dieser Schritt soll dazu beitragen, eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung aufzubauen, indem ein realistisches und möglichst objektives Bild des bevorstehenden Elternalltags vermittelt wird (vgl. ebd.).
2. „Wir wollen ein besseres Verständnis von der kindlichen Entwicklung und realistische Erwartungen in Bezug auf das kindliche Verhalten fördern" (Erickson/Egeland 2006: 40).
Dieses Etappenziel soll dabei helfen, eine Betreuung und Versorgung des Kindes gewährleisten zu können, was Kenntnisse über altersspezifische Verhaltensweisen und kindliche Entwicklungsstufen voraussetze. Darüber hinaus sollte die Bedeutung dieser Verhaltensweisen verstanden werden, so sei beispielsweise die Trennungsangst bei Kindern ein Ausdruck dafür, dass die Bindungsperson für das Kind eine sichere Basis darstelle, die sie nicht verlieren möchten (vgl. ebd.).
3. „Wir wollen eine feinfühlige, vorhersehbare Reaktion auf die Zeichen und Signale des Kindes fördern" (Erickson/Egeland 2006: 41).
Kinder können ihren Bedürfnissen auf verschiedene Weise Ausdruck verleihen. Die Vermittlung von Signalen erfolgt vor Erlangung der Sprechfähigkeit beispielsweise über Mimik, Gestik, die Körperhaltung oder Vokalisierungen. Um darauf angemessen antworten zu können, sollen die Eltern mit der Aneignung von feinfühligen Verhaltensweisen für diese kindlichen Signale sensibilisiert werden. Die Feinfühligkeit gleiche einem „langsamen Tanz [...], bei dem man dem Kind die Führung überlässt" und solle die Eltern-Kind-Bindung stärken (ebd.).
4. „Wir wollen die elterliche Fähigkeit stärken, die Welt mit den Augen des Kindes zu sehen" (Erickson/Egeland 2006: 41).
Um feinfühlig zu reagieren, müssen die Eltern Einfühlungsvermögen besitzen. Sie sollten die Welt aus den Augen ihrer Kinder sehen und sich in ihre Gefühlslage hineinversetzen können. Fehlende Empathie könne dazu führen, dass die Bedürfnisse des Kindes nicht erkannt oder diese fehlerhaft gestillt werden (vgl. ebd.).
5. „Wir wollen eine sichere häusliche Umgebung fördern, die dem Kind optimale Entwicklungsmöglichkeiten bietet" (Erickson/Egeland 2006: 42).
Das Explorations- und Spielbedürfnis der Kinder wird besonders bei einer dafür einladenden häuslichen Umgebung angeregt. Dies ist der Fall, wenn die Wohnung geordnet und kindersicher ist, sowie unterschiedliche Spielmaterialien (Spielzeug, ungefährliche Haushaltsgegenstände, etc.) zur Verfügung stehen. Die Eltern sollten dafür sorgen, dass ein relativ stabiler Routineablauf herrscht und die Kinder beim Erkunden und Spielen stets von mindestens einer erwachsenen Person unterstützt werden. Die Lebensverhältnisse sollten daher berechenbar und beständig sein (vgl. ebd.).
6. „Wir wollen den Eltern helfen, soziale Unterstützungsnetze für sich selbst und ihre Kinder zu erkennen und zu stärken" (Erickson/Egeland 2006: 43).
Die soziale Unterstützung hat einen bedeutenden Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung und die Entwicklung des Kindes. Auch nach Beendigung der Teilnahme am Programm sollen regelmäßig Unterstützungsangebote wahrgenommen werden. Die Grenzsetzung bei Familien und Freunden spielt dabei ebenfalls eine Rolle, denn oftmals weichen deren Interessen von den eigenen ab, weshalb es wichtig ist, dass Eltern hier eine klare Position einnehmen (vgl. ebd.).
7. „Wir wollen den Eltern helfen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und verfügbare Ressourcen erfolgreich zu nutzen" (Erickson/Egeland 2006: 43).
Dieses Ziel soll dazu beitragen, die allgemeinen Lebensumstände der Eltern stabil zu halten. Auch wenn manche Schicksalsschläge nicht absehbar sind, seien belastende Vorfälle oftmals das Ergebnis von eher undurchdachten und einseitigen Entscheidungen. Um dies zu vermeiden, wird gemeinsam mit den Eltern über Ambitionen gesprochen, die sie persönlich undfamiliär weiterbringen.
8. „Wir wollen den Eltern helfen, Optionen zu erkennen, Machtansprüche zu stellen und tragfähige Entscheidungen zu treffen" (Erickson/Egeland 2006: 44).
Sehr viele teilnehmende Eltern haben von Beginn ihrer Kindheit bis ins Erwachsenenalter hinein das Gefühl der Machtlosigkeit durchleben müssen. Sie haben Angst davor, eigene belastende Erfahrungen an ihre Kinder zu übertragen und fühlen sich nicht in der Lage geeignete Schritte zu unternehmen, um ihre Ziele erreichen zu können. Dieses Etappenziel soll den Eltern helfen, eigene konstruktive Entscheidungen zu treffen, wie beispielsweise die negativen Erfahrungen der Kindheit von den positiven aufzutrennen um bewusst auszuwählen, welche Aspekte davon an die eigenen Kinder weitergegeben werden sollen (vgl. ebd.).
Zur Erreichung der vorangegangenen Ziele, seien besondere Methoden nötig, wie dem Einsatz einer STEEP™-Beraterin und ihre unterstützende Begleitung, die Seeing is Believing™-Strategie, sowie Hausbesuche und Gruppentreffen. Diese Strategien werden im nachkommenden Abschnitt detaillierter beschrieben.
4.2 Methoden von STEEP™
Die notwendigen Strategien und Methoden zur Zielerreichung finden auf unterschiedlichen Interventionsebenen (Verhaltensebene, Repräsentationsebene, Beziehungsebene und soziale Ebene) statt. Zwar seien die Veränderungsstrategien individuell auf die einzelnen Familien zugeschnitten, dennoch gebe es allgemeine Methoden, die in jedem Fall angewendet werden und zur Zielerreichung führen sollen (vgl. Erickson/Egeland 2006: 45). Diese beinhalten die Zusammenarbeit mit einer STEEP™-Beraterin, die ihrerseits verschiedene Techniken anwendet, Hausbesuche und Gruppentreffen, sowie die sogenannte Seeing is Believing™-Strategie. Diese Methoden werden im Folgenden näher betrachtet.
4.2.1 Die Strategien der STEEP™-Beraterin
Die STEEP™-Beraterin begleitet die Familien innerhalb des gesamten Teilnahmezeitraums und bespricht gemeinsam mit den Eltern alle einflussreichen Elemente des Familienlebens. Dies geschieht vor dem Hintergrund, die Beziehung zwischen der STEEP™-Beraterin und Mutter systematisch zur Förderung von Veränderungsprozessen zu nutzen (vgl. Erickson/Egeland 2006: 45). Dafür stehen der STEEP™-Beraterin fünf verschiedene Strategien zur Verfügung, die sie in der Arbeit mit den Familien einsetzt.
1. Die Konfrontation mitder Vergangenheit und einem zukunftsorientierten Blick
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit, Beziehungsproblemen und anderweitigen Lebenskrisen, ist elementar um sich davon loszulösen. Die STEEP™-Beraterin soll die Mutter in ihrem Bewältigungsbestreben unterstützen und ihr dabei helfen, zu erkennen, welche Abwehrmechanismen hilfreich und welche eher schädigend sind (vgl. ebd.). Dazu gehört auch, den Einfluss der eigenen Eltern auf die Persönlichkeitsbildung zu reflektieren. Auch negative Gedankengänge nach der Geburt des Kindes, die sich bei Müttern aus unterschiedlichen Gründen entwickeln und in vielfältiger Weise äußern können, sollten angenommen und nicht verurteilt werden. Die Wahrnehmung dieser Emotionen sei meist schon der erste Schritt, um sich von ihnen befreien zu können (vgl. ebd.: 46). Durch den Prozess der bewussten Aufarbeitung eigener Kindheitserfahrungen und dessen nachhaltigen Effekte auf andere Lebensbereiche, könne die Mutter-Kind-Beziehung durch die STEEP™-Beraterin auf direktem oder indirektem Wege beeinflusst werden.
2. Das Erkennen von Bewältigungsstrategien und Abwehrmechanismen
Durch die Anerkennung von Abwehrmechanismen, die jeder Mensch individuell einsetzt, um sich selbst vor emotionalem Schmerz und bestimmten Ängsten zu schützen, wird der Mutter bewusst gemacht, dass diese Strategien zwar eine Zweckmäßigkeit besitzen, aber auch dazu führen können, andere Lebensbereiche zu beeinträchtigen (vgl. Erickson/Egeland 2006: 47). Dafür werden die Abwehrmechanismen „im Kontext früher Kindheitsbeziehungen" (ebd.) erforscht.
3. Die Infragestellung einer„Alles-oder-nichts-Haltung"
Der Mensch neige dazu, Erfahrungen und menschliche Verhaltensweisen in absolute Kategorien einzuordnen, vor allem dann, wenn diese wiederholt erlebt wurden oder gewisse emotionale Belastungen zur Folge hatten. Die STEEP™-Beraterin gibt Anregungen dafür, dass sich dazwischen noch ein Spektrum befindet, das wahrgenommen werden muss und das Verhaltensweisen kontextbezogen betrachtet werden sollen (vgl. ebd.: 48). Diese Strategie erfordere ein hohes Maß an Vertrauen zu der STEEP™-Beraterin, weshalb es äußerst wichtig sei, dass sich auch die Beraterin eigene Schwächen in der Zusammenarbeit eingestehen und offen darlegen sollte (vgl. ebd.).
4. Die Strategie des Reframings und Perspektivenwechsels
Wenn die STEEP™-Beraterin der Mutter dabei hilft, „die Verhaltensweisen des Kindes als Ausdruck seines Wachstums und seiner Entwicklung zu betrachten, stellen wir das Verhalten des Kindes in einen anderen Rahmen" (ebd.: 50). Das Verständnis der Mutter für die Sichtweise des Kindes soll hier durch verschiedene Strategien, zum Beispiel durch Briefeschreiben aus der Kinderperspektive, gefördert werden. Dieses „Reframing" kann auch auf andere Lebenssituationen angewendet werden, beispielsweise für Beziehungen bei derArbeit oder mit Familienmitgliedern.
5. Das Problemlöseverfahren
In manchen problematischen Situationen oder im Falle besonders schwer zu treffender Entscheidungen, brauchen manche Mütter Unterstützung für eine konstruktive Herangehensweise. Die STEEP™- Beraterin setzt dann ein speziell ausgearbeitetes Problemlöseverfahren ein, das zuerst die Frage nach dem Kern des Problems stellt, anschließend mehrere Lösungsansätze für das Problem durch Brainstorming sammelt und nach den möglichen Konsequenzen erörtert, worüber danach die Alternative gewählt werden soll, die am ehesten zur Zielführung beiträgt. Abschließend solle diese Entscheidung evaluiert werden (vgl. ebd.: 51). Manche Eltern haben dieses Verfahren aber bereits eigenständig herausgearbeitet.
4.2.2 Die Seeing is Believing™-Strategie
Die Strategie der Videoaufnahmen von den Eltern und ihren Kindern zählt zu den wirksamsten im STEEP™-Programm (vgl. Erickson/Egeland 2006: 99). Die Bezeichnung „Seeing is Believing" stützt sich darauf, dass visuell festgehaltenen Eindrücken Glauben geschenkt werden kann. Das Filmen habe einen positiven Lerneffekt auf die Eltern und lenken die Aufmerksamkeit auf die Eltern-Kind-Beziehung. So werden die Kompetenzen der Eltern in den Vordergrund gerückt, die im schnelllebigen Alltag oft anders wahrgenommen werden würden. Zudem würden die Filmaufnahmen neue Perspektiven eröffnen, vor allem hinsichtlich der Verhaltensweisen und Emotionen ihrer Kinder (vgl. ebd.: 100). Die Videos sollen außerdem die eigene Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung positiv beeinflussen, indem auf Stärken eingegangen und das Verständnis eines feinfühligen Umgangs mit dem Kind erörtert wird. Zudem dienen sie den Familien auch als Beleg, da die Entwicklung des Kindes und die familiären Beziehungsgefüge sichtbar festgehalten werden. Sie erhalten die Aufnahmen nach Beendigung des Programms und die STEEP™-Beraterin kann diese mit dem Einverständnis der Familien zur Supervision nutzen (vgl. ebd.: 99). Auch hier ist eine vertrauensvolle Beziehung zur STEEP™-Beraterin treibende Kraft für die Wirksamkeit der Strategie. Die Beraterin fokussiert die Stärken der Familie und stellt offene Fragen, die dazu führen, dass die Eltern quasi selbstständig die Beziehung zu ihrem Kind analysieren. Hierbei werden die Fragen individuell auf jede Familie und ihre Situation zugeschnitten, das heißt, dass kontextbezogene Arbeit von hoher Wichtigkeit ist. Die Familie wird in Bezug auf ihre Umwelt und den Einflüssen kultureller, ethnischer und gesamtgesellschaftlicher Hintergründe betrachtet (vgl. ebd.: 101f). Die Seeing is Belie- ving™-Strategie wird in den Hausbesuchen und Gruppentreffen im Rahmen des STEEP™-Pro- gramms angewandt, welche im nächsten Abschnitt weiter beschrieben werden.
4.2.3 Hausbesuche und Gruppentreffen
Sowohl die Hausbesuche, als auch die Gruppentreffen, werden idealerweise von derselben STEEP™- Beraterin durchgeführt, da dadurch die Entwicklung einer Beziehung die Zusammenarbeit vereinfacht (vgl. ebd.: 442). Das STEEP™-Programm startet üblicherweise mit einem Hausbesuch, um den Bedarf der Familie abzuklären und die Eignung für die Teilnahme am Programm zu bestätigen. Die Familien werden auf unterschiedliche Weise vermittelt, meist über Zentren Früher Hilfen oder Jugend- und Familienbildungsstätten. Je nach Bedarf, haben die Treffen eine Dauer von einer bis anderthalb Stunden, wobei die Mutter das angestrebte Ziel des Treffens mitgestaltet. Das nächste Tref- fen findet dann in Form von etwa dreistündigen Gruppensitzungen statt. Die Zusammensetzung der Teilnehmenden einer Gruppe richtet sich nach dem Alter der Kinder, sodass die Eltern möglichst gleichwertige Erfahrungen miteinander teilen können. In dem Treffen gibt es drei Phasen: Zu Beginn beschäftigen sich alle Eltern mit ihren Kindern, beispielsweise durch gemeinsames Spielen. Dann gibt es eine gemeinsame Mahlzeit ohne festen Ablaufplan, da sich die Eltern in einer ungezwungenen Atmosphäre unterhalten sollen. Anschließend werden die Kinder in einem gesonderten Raum getrennt von den Eltern betreut, damit diese sich wieder austauschen können (vgl. Erickson/Egeland 2006: 80ff).
5 Reflexive Perspektiven auf das STEEP™-Programm
Nachdem das Interventionsprogramm STEEP™ vorgestellt wurde, sollen nun im nächsten Abschnitt zunächst ausgewählte Folgeerscheinungen sexualisierter Gewalt auf die Mutter-Kind-Beziehung betrachtet werden, die als Ergebnisse in der Studie „Sexualisierte Gewalt und Erziehung - Auswirkungen familialer Erfahrungen auf die Mutter-Kind-Beziehungen" (2013) von Milena Noll verzeichnet wurden. Mithilfe der Ergebnisse aus der Studie und unter Berücksichtigung bestehender Literatur, sowie des bereits dargestellten Forschungsstandes zu sexualisierter Gewalt an Frauen und der Mutter-Kind-Bindung, sollen reflexive Perspektiven auf das Interventionskonzept von STEEP™ erstellt werden. Es wird erwartet, dass sich dadurch herausfiltern lässt, inwiefern konzeptionelle Leerstellen und Grenzen verzeichnet werden können, gerade in Bezug auf normative Erwartungen an Erziehung und Mutterschaft. Daraus sollten sich dann theoretische Rückschlüsse für Hilfs- und Beratungsstellen herleiten lassen, die sich auf sexualisierte Gewalt fokussieren, was einen wertvollen Beitrag für das Helfersystem im Kontext sexualisierterGewalt leisten würde.
5.1 Sexualisierte Gewalt und die Mutter-Kind-Beziehung: Ergebnisse aus einer Fallstudie von Milena Noll (2013)
Die Fallstudie „Sexualisierte Gewalt und Erziehung - Auswirkungen familialer Erfahrungen auf die Mutter-Kind-Beziehungen" von Milena Noll aus dem Jahr 2013 bietet eine neue erziehungswissenschaftliche Perspektive auf die Thematik der sexualisierten Gewalt. Die zentrale Fragestellung ist dabei, inwiefern sich die Erfahrung sexualisierter Gewalt, die Frauen in ihrer Kindheit und Jugend erlebt haben, auf die Erziehung ihrer eigenen Kinder auswirkt. Durch narrative Interviews sollte den Frauen ermöglicht werden, über teilweise tabuisierte Themenfelder zu sprechen, was einen ganzheitlichen Zugang zu den Lebensgeschichten der Frauen zuließ (vgl. Noll 2013: 258). Anschließend wurden drei ausgewählte Fallbeispiele anhand von biographieanalytischen und tiefenhermeneutischen Methoden rekonstruiert (vgl. ebd.: 15).
Bei allen drei Frauen zeigte sich, dass sich stark mit dem Nicht-Handeln der eigenen Mutter auseinandergesetzt wird und das Sprechen über die Misshandlungserfahrungen allgemein sehr schwergefallen ist (vgl. ebd.: 258). Während zwei der Frauen (Irma und Gertrud) ihre Mütter als „kühl, dominant und lieblos" (ebd.: 259) bezeichnen, zeige sich im dritten Fallporträt von Victoria Verständnis gegenüber den nichtanerkennenden Verhaltensweisen der eigenen Mutter, weil sie diese mit den in ihrer Herkunftsfamilie vorherrschenden patriarchalischen Familienkonstellationen entschuldigt, aus denen sich die Mutter nicht habe loslösen können (vgl. ebd.). Der Wunsch nach einer unterstützenden Umgebung und einer Mutter als Identitätsfigur, welche selbstständig und stark wahrgenommen wird, sei enorm ausgeprägt. Alle drei Frauen wünschen sich zudem Anerkennung von ihren Müttern für das ihnen angetane Unrecht, was ihnen bis dato verwehrt blieb (vgl. ebd.). Noll beschreibt in Anlehnung an Winnicott (1997), dass der Halt aus der Umwelt einen Platz für „Spiel und Selbsterfahrung [...] [schafft] und [...] Anerkennung [gewährt], die insbesondere Mädchen brauchen, um eine reife und selbstständige (Mutter-)Persönlichkeit auszubilden" (ebd.: 259). Dies verhindere, dass sie in dem Beziehungsaufbau zu ihren Kindern und Lebenspartnern in einen Strudel von „Abhängigkeit, Selbstaufgabe und Nichtanerkennung geraten" (ebd.) und bestärke mütterliche Verhaltensweisen, die sich einerseits bei explorativen Bestrebungen seitens des Kindes und andererseits bei der Entwicklung von Standhaftigkeit in Stress- und Spannungssituationen förderlich zeigen würden (vgl. ebd.). Zudem müsse sich bei den Frauen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass eine Identifizierung mit der eigenen Mutter zuvor eine Loslösung von dieser bedinge, damit sie eine eigene „Subjektivität und Weiblichkeit" (ebd.: 260) herausbilden können.
Laut Noll folge aus der Anerkennung über das erlebte Unrecht und der Aufhebung des Schweigens jedoch nicht zwingend eine unproblematische Beziehung zwischen Mutter und Kind, denn alle drei Frauen hätten Schwierigkeiten im Dialog über die sexualisierten Gewalterfahrungen mit ihren Kindern gezeigt (vgl. Noll 2013: 262). Die Frauen haben den Wunsch, mit ihren Kindern über das Erlebte zu sprechen und verspüren gleichzeitig hinsichtlich dessen verschiedenartige Ängste und Sorgen (vgl. ebd.). Auch würden sich Belastungen im Familienalltag unter anderem dadurch zeigen, dass die Erinnerung der sexualisierten Gewalterfahrung auf unterschiedlichen Ebenen ständig präsent sei. Bei allen drei Frauen äußere sich eine Tendenz dahingehend, die Töchter und Söhne in gewisse Rollen zu unterteilen. Während die Söhne eher potentielle Täter oder aber Retter darstellen, werden die Töchter demgegenüber als „Opfer" angesehen (vgl. ebd.: 263). Hier würden sich hierarchische Geschlechterbilder zeigen, die von männlicher Dominanz geprägt seien (vgl. end.: 266). Vor allem Victoria setzte sich durch einen „rigiden" und „herrschaftsbestimmten" (ebd.) Erziehungsstil durch, welcher sich vor allem negativ auf ihren jüngsten Sohn auswirkte, der aufgrund dessen eine instabile Persönlichkeit entwickelte und sich in therapeutische Behandlung begeben musste. Viktoria sah bei ihm physische Ähnlichkeiten zu ihrem Vater, von dem die sexualisierte Gewalt ausgegangen war und hätte ihn deshalb anders behandelt, als ihren ältesten Sohn und ihre Tochter (vgl. ebd.: 266 f). Bei Irma zeigen sich ebenfalls Belastungen in der Mutter-Kind-Beziehung, da sie die Beziehung zu ihrer eigenen Mutter nicht lösen konnte. Diese emotionalen Spannungen würden sich somit auf die Beziehung zu ihrerTochter übertragen (vgl. ebd.: 267). Gertrud habe sich in ihren Erzählungen kaum über die Beziehung zu ihren Töchtern und Söhnen geäußert, verdränge die sexualisierte Gewalt durch ihren Stiefvater jedoch, weshalb sie ihren Töchtern keine Unterstützung bieten könnte und zu tradierten Verhaltensweisen beitrage (vgl. ebd.: 268). Psychotherapien hätten im Bewältigungsprozess der Frauen zwar eine Hilfe dargestellt, sie ließen jedoch die Beziehung zu ihren Kindern außer Acht und trugen schlussfolgernd auch nichts zur Entwicklung einer einfühlsamen Mutter-Kind-Beziehung bei (vgl. ebd.: 262).
Die Ergebnisse lassen ein gewisses Schema erkennen. Die Anerkennung des erlebten Unrechts stellt bei allen drei Frauen einen entscheidenden Faktor im Bewältigungsprozess dar. Vornehmlich wird diese Anerkennung bei der eigenen Mutter gesucht, die sich jedoch in allen drei dargestellten Fällen nicht unterstützend, sondern ablehnend und abweisend zeigten. Sofern diese Anerkennung im Laufe des Lebens dann nicht anderweitig durch das nahe soziale Umfeld erfolgt ist, konnte das Geschehene kaum bewältigt werden, was sich ebenfalls auf die Beziehung zu den eigenen Kindern und den Lebenspartnern ausgewirkt hat. Viktoria hebe sich von Irma und Gertrud insofern ab, dass sie von ihrer Schwiegermutter im Erwachsenenalter die gewünschte Unterstützung und Anerkennung bekam, die ihr als Kind gefehlt hat. Dadurch habe sie ein „gebrochenes" Kohärenzgefühl und eine gewisse Widerstandsfähigkeit bei Herausforderungen entwickeln können (vgl. Noll 2013: 261). Noll hebt in dem Zusammenhang auch die „wenig hilfreiche Rolle von Institutionen" (ebd.: 261) hervor, was durch Gerichtsverfahren bei Gertrud und Viktoria sichtbar wurde. Die Gerichte zeigten sich „als Instanzen [...], die teilweise das Sprechverbot erneut durchsetzten (Gertrud) oder stereotype Schuldzuweisungen erneuerten (Viktoria)" (ebd.). Noll beschreibt, dass die Frauen ihre traumatischen Erfahrungen kaum überwunden haben und sich auf die Bewältigung des eigenen Lebens fokussieren, wodurch sie nicht in der Lage seien, einen Perspektivwechsel zugunsten ihrer Kinder zu vollziehen; die Kinder würden durch ihre Mütter nicht als eigenständige Individuen wahrgenommen werden (vgl. ebd.: 264). Obwohl sich alle drei Frauen darum bemühten, die Verhaltensweisen ihrer Mütter nicht zu wiederholen, seien sie „ähnlich abwesend wie ihre eigenen Mütter, [...] [weil] sie nicht in der Lage sind, auf die Entwicklungs- und Persönlichkeitsbedürfnisse ihrer Kinder einzugehen" (ebd.). Die Mutter-Kind-Beziehung richtet sich also nach der erfahrenen Traumatisierung, die durch die sexualisierte Gewalterfahrung entstanden ist und nicht bewältigt werden konnte, was unbewusst zu tradierten Erziehungsweisen führt (vgl. ebd.). Auch werde sichtbar, dass die Aufhebung des Sprechverbots hinsichtlich der sexualisierten Gewalterfahrungen als ein kommunikativer Prozess zu verstehen sei (vgl. ebd.: 264). Pädagogische Interventionen sollen Änderungen im Familienalltag hervorbringen, indem schädigende Erziehungs- und Handlungsmuster durchbrochen werden, weshalb sich die Konzeptionen an „der Ausgangslage der betroffenen Mütter, je nach Aufarbeitung ihrer Vergangenheit und den Problematiken spezifischer Mutter-Kind-Beziehung, ausrichten [sollten]" (ebd.). Dies erfordere entsprechende Qualifikationen der Fachkräfte, die im Rahmen sozialpädagogischer, familientherapeutischer oder beratender Hilfsangebote tätig sind. Dabei sei besonders wichtig, dass die Fachkräfte festgefahrene Verhaltensmuster erkennen und in Bezug auf tradierte Geschlechterrollen- bilder auf eine sensible, transparente sowie akzeptierende Weise mit den betroffenen Frauen zusammen reflektieren (vgl. ebd.: 269f). Im Allgemeinen fehle es an qualifiziertem Personal, das adäquat mit psychisch belasteten Eltern und ihren Kindern umgehen könne (vgl. ebd.: 270). Die Fachkräfte müssten im Bereich der Ursachen von psychischen Störungen, sowie der Gesprächsführung, eingehend geschult werden.
5.2 Sexualisierte Gewalt, Bindung und STEEP™: Untersuchung des Interventionskonzeptes
5.2.1 Herausarbeitung konzeptioneller Leerstellen von STEEP™
Noll (vgl. 2013: 269) zieht aus den Ergebnissen ihrer Fallstudie zwei wesentliche Schlussfolgerungen, aus denen hervorgeht, dass die in den vorherigen Abschnitten genannten bindungstheoretischen Rückschlüsse, eingrenzend auch im Kontext von sexualisierter Gewalt, eine Gültigkeit besitzen:
1. Die Perspektive der Kinder, die Schwierigkeiten im Familienalltag und die Erwartungen an die Mutterrolle werden weder in einer Einzeltherapie noch in der Familienhilfe zusammenhängend beleuchtet.
2. Die transgenerationale Weitergabe der erfahrenen Gefühlskalte erfordere weitreichende pädagogische Interventionen, um die von der sexualisierten Gewalt beeinflussten Wirklichkeitskonstruktionen der Betroffenen zu korrigieren und die persönlichen Leitbilder hinsichtlich dereigenen Erziehung und Handlungsweisen auch durchsetzen zu können.
Das STEEP™-Programm wurde auf Grundlage eben jener Erkenntnisse konzipiert, dass Misshandlungszyklen durch eine bewusste Aufarbeitung überwunden werden können, wodurch die Weitergabe von psychosozialen Belastungen und risikohaften Lebensbedingungen an die nächste Generation verhindert werden kann. Dies ist im Hinblick darauf, dass sexualisierte Gewalt weitreichende transgenerationale Auswirkungen haben kann, eine wertvolle Wissensressource. Da sexualisierte Gewalt besonders die Interaktionsmuster, Kommunikationsweise und Beziehungsgestaltung von betroffenen Müttern zu ihren Kindern beeinflusst, sollte eine dahingehende Intervention diese Aspekte intensiv aufgreifen können.
Gemäß Crittenden (vgl. 2005: 26) sollten bei risikoreichen Mutter-Kind-Beziehungen Interventionen angewendet werden, die die elterlichen Bedürfnisse in den Blick nehmen und das Risiko für zukünftige Problemlagen minimieren. STEEP™behandelt diese Punkte in den unterschiedlichen konzeptionellen Zielsetzungen, die methodisch unter anderem auf der Verhaltens- und Beziehungsebene umgesetzt werden sollen. So ist hier hervorzuheben, dass dabei einerseits kindliche Entwicklungsetappen und Verhaltensweisen erläutert werden, um den Eltern ein besseres und realistisches Verständnis für den Umgang zu ihren Kindern und den eigenen Erziehungsvorstellungen zu vermitteln, sowie andererseits auch elterliche Lebenskrisen in den Blick genommen werden. Die Konfrontation mit der Vergangenheit mitsamt zukunftsorientierter Blickweise, das Erkennen von Bewältigungsstrategien und Abwehrmechanismen, die Infragestellung einer „Alles-oder-nichts-Haltung", die Strategie des Reframings und Perspektivwechsels, sowie das Problemlöseverfahren, beinhalten die nötige Fokussierung auf mütterliche Interaktionsmuster, Kommunikation und Beziehung zu den Kindern (vgl. Abschnitt 4.2.2 Strategien der STEEP™-Beraterin). Dies geschieht primär mithilfe einer STEEP™-Berate- rin, die zu der Mutter im Vorfeld eine vertrauensvolle Beziehung herstellen soll, damit zentrale Veränderungen erwirkt werden können. Dass ein unterstützendes soziales Umfeld mit entsprechender emotionaler Beziehungsqualität im Bewältigungsprozess von sexualisierter Gewalt eine bedeutende Rolle spielt, konnte in der Fallstudie von Noll unter anderem anhand der biografisch-analytischen Auswertungen von Victorias Erzählungen verdeutlicht werden (vgl. Noll 2013: 261). Es stellt sich hier die Frage, inwiefern die STEEP™-Beraterin diese Funktion erfüllen könnte.
Best (2020) richtet ihren Forschungsblick auf die Beziehungsgestaltung zwischen Beraterinnen und Klientinnen im Spannungsfeld von Nähe und Distanz. Dabei werde der Begriff der Nähe „als Mittel zur Herstellung eines Arbeitsbündnisses angesehen" (Best 2020: 43), dies bedürfe aber gleichlaufend einer gewissen Distanz um der Ausnutzung des Machtgefälles zwischen Beraterin und Klientin, sowie Komplikationen in der Beziehung entgegenzuwirken (vgl. ebd.). Auf dem Grundsatz, dass ein Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz herrschen muss, stütze sich professionelles psychosoziales Handeln (vgl. ebd.). Wenn kein gewisses Maß an Sachlichkeit im Umgang mit der Klientin gezeigt wird, könne nicht von Professionalität gesprochen werden und die Problemsituationen der Hilfesuchenden gegebenenfalls sogar verschlimmert werden (vgl. ebd.: 44). Der Beziehungsbegriff im Kontext von Beratung unterliege häufig keinen eindeutigen Abgrenzungen, weshalb Best bindungstheoretische Überlegungen hinzuzieht und feststellt, dass Bindung als ein grundlegender Bestandteil von Beziehungen anzusehen sei (vgl. ebd.: 47).
Auch STEEP™ sieht den Aufbau einer Bindung zwischen Beraterin und Klientin als Schlüsselelement für eine vertrauensvolle Beziehungsentwicklung an (vgl. Erickson/Egeland 2005: 57). Die STEEP™- Beraterinnen entstammen verschiedenartigen kulturellen Hintergründen, hätten mindestens einen College-Abschluss (vergleichbar mit der hiesigen Hochschulreife) oder seien legitimierte Fachkräfte, die sich alle einem STEEP™-Orientierungskurs, einer STEEP™-Ausbildung, Supervision sowie einer praktischen Ausbildung unterziehen müssen, bevor sie am STEEP™-Programm als Beraterinnen tätig sein dürfen (vgl. ebd.: 53). Die STEEP™-Beraterinnen werden in ihren Kompetenzen geschult respektvoll, unvoreingenommen und feinfühlig mit den Müttern und ihren Problemlagen umzugehen, indem sie dazu angeleitet werden, die individuellen Unterschiede in jeder Zusammenarbeit anzuerkennen, ferner das persönliche Verhalten und die eigene Arbeitsweise fortwährend zu reflektieren (vgl. ebd.). Es gibt umfassende Anleitungen dafür, wie neue Beziehungsmodelle entwickelt und die Selbstständigkeit mitsamt dem Machtgefühl der Mütter gestärkt werden können (vgl. ebd.: 57). Erickson und Egeland (vgl. ebd.: 56 f) erzählen von einem Fallbeispiel, in dem eine Mutter gegenüber der STEEP™-Beraterin zunächst keine Äußerungen hinsichtlich ihrer Konflikte äußerte und sich die Hausbesuche in den ersten Monaten auf gemeinsames Fernsehen beschränkten; am Ende jedoch baute diese Mutter genug Vertrauen zu der STEEP™-Beraterin auf und öffnete sich ihr auf emotionaler Ebene (vgl. ebd.). Andere Teilnehmerinnen machten durch die STEEP™-Beratungen erstmalig die Erfahrung, dass ihnen Fürsorge und langfristige Anteilnahme, sowie unerschütterliche Unterstützung zuteil wurde (vgl. ebd.). Die Interventionsgestaltung zeigt sich hier folglich zumindest theoretisch förderlich im Aufbau eines stabilen sozialen Netzwerkes, da davon ausgegangen werden kann, dass die positiven Erfahrungen, die mit der STEEP™-Beraterin gesammelt wurden, auf andere Beziehungen übertragen werden und sich somit dahingehend internalisierte Denkmuster verändern lassen können. Gerade bezüglich der Tragweite im An- oder Aberkennungsprozess von sexualisierter Gewalt und der Notwendigkeit eines Dialogs bei der Offenlegung, der von beiden Gesprächspartnern auf gleicher Stufe geführt werden sollte, hat diese Interventionsmethode eine besondere Bedeutung.
Die Gruppentreffen basieren ebenfalls im Wesentlichen auf bindungstheoretischen Grundannahmen. Dahingehend gibt es von Strauß und Mattke (2018) wissenschaftliche Publizierungen zum Zusammenhang zwischen Bindungsmustern und Gruppenprozessen. Darin wird unter anderem empfohlen eine Gruppe als mögliche „sichere Basis für Exploration [zu verstehen] [...], [wobei] die Tragfähigkeit dieser Basis aufmerksam im Blick zu haben [...] für Gruppentherapeuten hilfreich sein [dürfte]" (Strauß 2018: 96). Das STEEP™-Programm schildert in der Sinnhaftigkeit der Gruppentreffen genau dies: Es soll eine „vertrauensfördernde, sichere Umgebung" (Erickson/Egeland 2005: 81) geschaffen werden, damit Eltern sorglos über ihre Gefühle und Befürchtungen sprechen können, was in erster Instanz durch den vorherigen Beziehungsaufbau zur STEEP™-Beraterin beispielhaft vorgeführt werden soll. Solche Interventionsmaßnahmen zielen demnach unter anderem darauf ab, die sozialen Strukturen im Leben der teilnehmenden Frauen zu stärken. Werden die Biografien von Gertrud und Irma aus der Fallstudie von Noll hinzugezogen, die im Gegensatz zu Victoria eben keinerlei Rückhalt aus ihrem nahen sozialen Umfeld erfahren hatten, kann die Vermutung aufgestellt werden, dass eine solche Begleitung durch die Gruppentreffen und der STEEP™-Beraterin ab der Schwangerschaft bis in das zweite Lebensjahr ihrer Kinder wahrscheinlich zu einer Erleichterung ihrer Bewältigungsbemühungen und Verbesserung der Mutter-Kind-Beziehung geführt hätten. Allerdings gilt diese Perspektive in der Hauptsache nur dem nahen sozialen Nahraum der Mutter. Der institutionelle und gesellschaftliche Umgang mit Frauen, die sexualisierte Gewalt erdulden mussten, unterliegt Vorgängen, die sich der Kontrolle des STEEP™-Programms entziehen. Dahingehend muss eine harmonische Kooperation zwischen Institutionen wie dem Jugendamt, den Ermittlungsbehörden und den Angeboten innerhalb des Unterstützungssystems für sexualisierte Gewalt herrschen, damit Aufdeckungsprozesse der Betroffenen grundlegend positiv verlaufen können.
Konzeptionell wird die Bindungstheorie im STEEP™-Programm auf mehreren Ebenen angewandt: Einerseits wird sie als Basis für einen angemessenen elterlichen Umgang zu den Kindern genutzt, andererseits werden diese bindungstheoretischen Kenntnisse in den Hausbesuchen und Gruppentref- fen auch zum Beziehungsaufbau zwischen Mutter und STEEP™-Beraterin angewandt. Nun könnte es angesichts der Tatsache, dass sexualisierte Gewalt überproportional Frauen betrifft und somit eine geschlechtsspezifische Problematik darstellt, eine eher günstige Fügung sein, dass sich STEEP™im Ursprung hauptsächlich an Mütter wendet. Wie sich mit dem Blick auf das durch die Bindungstheorie erzeugte Mutterbild gezeigt hat, können durch die Fokussierung auf die Mutterschaft jedoch komplexe Problematiken einhergehen. Es besteht die Gefahr dadurch das Bild einer idealen Mutter zu kreieren, die anhand ihrer Verhaltensweisen kategorisch bewertet wird und sich anhand derer selbst identifizieren sollte. In den Fallbeispielen aus Nolls Studie verspürten die Frauen den Drang, eine „gute" Mutter zu sein, was auf pädagogische und therapeutische Weise unterstützt werden solle (vgl. Noll 2013: 269), allerdings sollte dies von Seiten der STEEP™-Beraterinnen anhand einer kri- tisch-reflektierenden Perspektive auf etwaige Idealvorstellungen geschehen. Insbesondere sollte das nicht nur hinsichtlich typisierter Rollenbilder und geschlechtsspezifischer Eigenschaftszuschreibungen erfolgen, sondern auch im Hinblick auf normative Erziehungsvorstellungen, die durch die formulierten Ziele und die Schwerpunktsetzung auf die Bindungstheorie erzeugt werden.
An dieser Stelle ist abermals die Kritik von Otto und Keller (vgl. 2012: 7) anzuführen, dass die Grundlagen der Bindungstheorie hauptsächlich mittelständische Erziehungsziele und -praktiken des Westens repräsentieren. Diese Leerstellen übertragen sich schematisch auf die Konzeption des STEEP™- Programms, in der die bindungstheoretischen Leitlinien nicht hinterfragt werden. Dies schließt einerseits die Mutterzentriertheit und andererseits den Anspruch mit ein, dass die sichere Bindung als die optimalste Bindungsform gilt. Die bindungstheoretische Beanspruchung, universell gültig zu sein, kann daher aus kulturvergleichender Sicht ohne weiterführende Forschung, die Lebens- und Familienformen aller Art berücksichtigen, nicht gehalten werden, was in der Konzipierung von STEEP™ beachtet werden sollte.
Pavkovic (vgl. 2001: 263) schreibt dazu, dass Beraterinnen die eigene Handlungspraxis aus einer interkulturellen Sichtweise heraus fortwährend reflektieren müssen, um wirksame Interventionen treffen zu können. Der Grundstein dafür sei eine entsprechende psychotherapeutisch angesetzte Qualifizierung sowie die Herstellung einer übereinstimmenden Verständigungsdimension, damit die Klientinnen etwaige Interventionsmethoden der Beraterinnen begreifen können (vgl. ebd.: 263). Die methodische Vorgehensweise müsse sich an die Lebenswelt der Klientinnen anpassen. In der Praxis kultursensibler Beratung und Therapie werde sich laut Borke et. al. (vgl. 2015: 144) an gängigen Modellen von Beratungs- und Therapieprozessen orientiert, mit dem Unterschied, dass auf jeder Dimension kulturbezogene Werte und Normen der Klientinnen berücksichtigt werden. Da sich die „kulturspezifischen Vorstellungen und Erwartungen sowie möglicher Konsequenzen für den weiteren Entwicklungsverlauf zunehmend im Spannungsfeld zwischen der eigenen Kultur und der Normativität der Aufenthaltskultur positionieren" (Borke et. al. 2015: 144), können daraus in der Zusammenarbeit zwischen Klientin und Beraterin individuelle Zielsetzungen konstruiert werden. Gerade durch die sozialen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland, in der migrationsgesellschaftliche Perspektiven enorme Relevanz gewonnen haben, ist eine kultursensible Beratungsweise unbedingt erforderlich. Es reicht nicht aus, dass die STEEP™-Beraterinnen unterschiedlichen Kulturkreisen entstammen; transkulturelle Perspektiven müssen auch in der formulierten Philosophie und Zielsetzung fest verankert sein, damit sie in allen Supervisionen und Selbstreflexionsprozessen aktiv herangezogen werden. Da der Begriff der sexualisierten Gewalt in verschiedenen Gesellschaften abweichend voneinander definiert wird, somit auch von der individuellen Wahrnehmung der Frauen abhängig ist und sich das Sprechverbot sowie der allgemeine Umgang mit sexualisierter Gewalt je nach Kultur unterschiedlich äußert, haben transkulturelle Blickwinkel im Umgang mit betroffenen Frauen dahingehend nochmal eine spezielle Bedeutung.
Eine relevante Bedingung für einen barrierefreien Zugang von STEEP™, ist die Möglichkeit einer Teilnahme am Programm. In dem Konzeptpapierzum STEEP™-Angebot des Familienzentrums Erika6 steht geschrieben, dass sich schwangere Frauen oder Eltern entweder direkt an STEEP™-Beraterin- nen wenden können oder unter anderem über Familienbildungsstätten, Jugend- und Sozialämter, Schwangerschaftsberatungsstellen, Arzte, sowie Hebammen vermittelt werden. Dabei richte sich das Angebot in der Regel an erstgebärende Frauen, jedoch könnten in Ausnahmefällen auch Familien, die schon mehrere Kinder haben, betreut werden. Auf Anfrage per E-Mail wurde seitens der Leitung zudem mitgeteilt, dass es beim Erstgespräch mit den Eltern einen Leitfaden gibt, womit das Angebot vorgestellt werde und anhand dessen die Eltern entscheiden können, ob sie am STEEP™-Pro- gramm teilnehmen möchten. Die Anmeldung sei verbindlich und es müsse ein Einverständnis für die Hausbesuche und Gruppentreffen unterschrieben werden. Zudem sei die Teilnahme kostenfrei und werde über städtische Finanzmittel für die Familienbildung, Stiftungsgelder und Eigenmittel finanziert. Somit bestehen keine ökonomischen Ausgrenzungspunkte, dafür aber Kriterien, die sich nur an eine bestimmte Zielgruppe richten. Dies ist für die Auswahl eines geeigneten Interventionsprogramms gerichtet auf die subjektiven Bedürfnisse der Klientinnen durchaus sinnvoll. Hier könnte darüber nachgedacht werden, die Konzeption des STEEP™-Programms dauerhaft auszuweiten um beispielsweise nicht vorzugsweise nur erstgebärende, junge Mütter anzusprechen. Gerade für Mütter mit mehreren Kindern, bei denen sich Verhaltensweisen manifestiert haben, die hinderlich für den Aufbau einer stabilen Mutter-Kind-Beziehung sind, wäre die Teilnahme an einer Intervention wie dem STEEP™-Programm gleichermaßen erstrebenswert.
In der Fallstudie von Noll (2013) wurde aus dem Fallporträt von Victoria ersichtlich, dass sich die Beziehung zu ihrem jüngsten Sohn Alex am Schwierigsten gestaltete, da dieser äußerlich ihrem Vater ähnelte, der sie jahrelang sexuell misshandelte. Sie habe Alex „von klein auf" (Noll 2013: 235) weder richtig in den Arm nehmen, noch andere Formen der Nähe zeigen können, da sie ihn nicht unabhängig von ihrem Vater als eigenständiges Individuum wahrnahm. Zu dieser Realisation kam Victoria erst im Rahmen einer Familientherapie als Alex schon 13 Jahre alt war (vgl. ebd.: 236). Hier zeigen sich zwei Hürden: Einerseits das Unvermögen die Kindsperspektive einzunehmen und andererseits die generelle Handlungsunfähigkeit, auf die spezifischen Probleme ihres Sohnes adäquat einzugehen. Dies generiert negative Selbstbilder bei Mutter und Kind. Bei Victoria äußert sich das durch die Infragestellung ihrer Rolle als „guter" Mutter und bei ihrem Sohn Alex in Form eines im Rahmen der Familientherapie gemalten Bildes, in welchem er sich selbst als Außenseiter der Familie darstellte (vgl. ebd.). Diese riskante Mutter-Kind-Dynamik hätte womöglich durch eine frühere Intervention abgeschwächt werden können. STEEP™ wäre in diesem konkreten Fall aufgrund der bindungstheoretischen Orientierung, welche die Umgangsqualität zwischen Mutter und Kind fokussiert, nur in Bezug auf die konkrete Problemstellung geeignet; nicht aber unter Berücksichtigung der gängigen Teilnahmekriterien.
5.2.2 Theoretische Rückschlüsse für Hilfs- und Beratungsstellen
Noll hat in ihrer Studie über die Auswirkungen sexualisierter Gewalt auf die Mutter-Kind-Beziehung aufzeigen können, dass Fachberatungsstellen und (familien-)therapeutische Hilfen Frauen mit sexualisierten Gewalterfahrungen unterstützen, dabei jedoch entweder die Mutter-Kind-Beziehung oder psychopathologische Beschwerden der Frauen nicht betrachten. Die Mutter-Kind-Beziehung wird maßgeblich von der Bindung zwischen Mutter und Kind beeinflusst, weshalb bindungstheoretische Überlegungen bei Hilfsangeboten, die von Müttern mit sexualisierten Gewalterfahrungen wahrgenommen werden, unbedingt miteinbezogen werden sollten. Gleichzeitig sind jedoch auch die psychischen Folgen zu betrachten, die sexualisierte Gewalt bei betroffenen Frauen hinterlässt. Das STEEP™-Programm beleuchtet beide Aspekte, indem durch unterschiedliche Methoden und Zielsetzungen die Mutter-Kind-Bindung gestärkt werden soll. Dies erfolgt durch die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Mutter, der Aufdeckung schädlicher Bewältigungsmechanismen und Anwendung von Strategien für einen Perspektivwechsel zugunsten des Kindes. Eine flächendeckende Implementierung eines bindungstheoretischen Interventionsprogramms in Fachberatungsstellen für Frauen mit sexualisierten Gewalterfahrungen könnte die von Noll festgestellten Lücken im Helfersystem für Mütter schließen. Erfolgen sollte dies allerdings mit kritischer Betrachtung auf die Bindungstheorie, welche teilweise stark durch normative Erziehungs- und Mutterbilder geprägt ist. Wie exemplarisch am STEEP™-Programm aufgezeigt werden konnte, wurden diese theoretischen Leerstellen blind in das Konzept von STEEP™ übernommen. Kultursensible Betrachtungen auf allen Dimensionen der Intervention sowie reflexive Perspektiven auf die gesellschaftlich verankerten Geschlechter- rollenbilder, könnten dem Normativitätsproblem der Bindungstheorie entgegenwirken, sofern diese auch konzeptionell übernommen werden. Teilweise wird das Konzept der mütterlichen Feinfühligkeit mittlerweile auch an beide Elternteile gerichtet und dahingehend zur „Skala elterlicher Feinfühligkeit" adaptiert (vgl. Künster/Ziegenhain 2014: 22). Besonders im Kontext der Frühen Hilfen, wird die Skala elterlicher Feinfühligkeit als praktisches Instrument zur Beratung junger Eltern verwendet (vgl. ebd.). Dies hebt die Fokussierung auf die Mutterschaft auf, welche impliziert, dass eine Mutter unabhängig der familiären Strukturen hauptverantwortlich für das Kindeswohl ist.
Ebenso sollte sich bei einer Intervention als Risikofaktor einer möglichen Kindeswohlgefährdung nicht unbedingt explizit auf Faktoren wie das junge Alter der Mutter beschränkt und als Teilnahmevoraussetzung definiert werden; in Deutschland liegt das Durchschnittsalter von erstgebärenden Frauen beispielsweise bei 30 Jahren (vgl. StBA 2019).
6 Schlussbetrachtung
Anhand derzusammengestellten Erkenntnisse wurde ersichtlich, dass bei der Erfassung und Definition sexualisierter Gewalt methodologische Hürden existieren. Dabei hat sich herausgestellt, dass sexualisierte Gewalt an soziokulturelle Bedingungen gekoppelt ist, vornehmlich Frauen betrifft und sich auf nahezu jeden Lebensbereich auswirken kann. Die Folgen können kurz- und langfristig sein, sind oft nicht vorhersehbar und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Vorliegende Arbeit konzentrierte sich dabei auf die sozialen, psychopathologischen und transgenerationalen Folgen, die in enger Wechselwirkung zueinander stehen.
Eltern, die hohen psychosozialen Belastungen und Risiken etwaiger Art ausgesetzt sind, wie es beispielsweise bei einer unverarbeiteten Traumatisierung durch sexualisierte Gewalt der Fall ist, zeigen gehäuft Verhaltensweisen, die einen belastenden Effekt auf die Erziehung ihrer Kinder ausüben. Dies äußert sich unter anderem in der Unfähigkeit einen Perspektivwechsel zugunsten des Kindes zu unternehmen, die eigenen Bedürfnisse nicht von denen des Kindes differenzieren zu können und unzutreffende Interpretationen von kindlichen Verhaltensweisen, die sich in einer unangemessenen Reaktion auf kindliche Signale ausdrücken. In diesen Fällen sind beraterisch-therapeutische Hilfsangebote nötig, um Schutzfaktoren herauszuarbeiten, die potenziellen Entwicklungsrisiken des Kindes entgegenwirken sollen. Durch die Ergebnisse des Minnesota Parent-Child-Projects konnte dargestellt werden, dass hierfür bindungstheoretische Überlegungen besonders geeignet sind, da die Umgangsqualität zwischen Mutter und Kind im Wesentlichen durch die gegenwärtige Lebenseinstellung der Mutter modifiziert werden kann. Daraus konnte geschlossen werden, dass bindungstheoretische Interventionen im Hinblick auf risikohaftes Elternverhalten eine bedeutsame Rolle spielen. Zu beachten ist hierbei, dass es bei der Entwicklung von elterlichen Erziehungs- und Beziehungskompetenzen auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes ankommt, sowie bezüglich eines interkulturellen Kontextes und der (außer-)familiären Gefüge betrachtet werden muss. Die Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth definiert eine gelungene Erziehung anhand der mütterlichen Fähigkeit, dem Kind einerseits Schutz und Versorgung bieten zu können sowie andererseits eine vertrauensvolle Mutter-Kind-Bindung zu entwickeln, die von emotionaler Wärme, Feinfühligkeit und Akzeptanz geprägt ist und sich wohltuend auf die Emotionsregulation des Kindes auswirkt. Der Blick auf das Mutterbild der klassischen Bindungstheorie hat ergeben, dass die Fokussierung auf die Mutter von westlichen Idealen geprägt ist und diese geschlechtsspezifischen Normvorstellungen aus kulturvergleichenderSicht nicht haltbar sind.
Mittels theoretischer Aufarbeitung konnte aufgezeigt werden, dass sich diese blinden Flecken der klassischen Bindungstheorie als Leerstellen in der Konzeption des STEEP™-Programms widerspiegeln: Das sichere Bindungsmuster, die mütterliche Feinfühligkeit und die Mutterzentriertheit werden idealisiert, orientiert an Werten und Normen der westlichen Welt. Die Maßnahmen, die das STEEP™- Programm anwendet, sind im Hinblick auf die mehrdimensionalen Auswirkungen sexualisierter Gewalt trotzdem als geeignet einzustufen. Die fehlenden Perspektiven auf psychopathologische Symptome, alltägliches Erziehungsverhalten und der Mutter-Kind-Beziehung, die von Noll angesprochen wurden, werden im STEEP™-Programm in Wechselwirkung zueinander betrachtet. Auch die Hinderung der Weitergabe von risikohaften Verhaltensweisen an die nächste Generation, ist im STEEP™- Programm ein festgelegtes Ziel. Tradierte Risikomechanismen sind im Kontext von sexualisierter Gewalt präsent und zeigen sich in einigen Studien beispielsweise bei Töchtern von betroffenen Müttern durch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, selbst Betroffene sexualisierte Gewalt zu werden. Aus diesen Gründen ist es bei der Formulierung von Hilfsangeboten für vorbelastete Mütter von hoher Relevanz, die Mutter-Kind-Bindung, das Erziehungsverhalten und die psychische Verfassung der Mutter assoziativ zu betrachten. Zudem hat sich herausgestellt, dass ungünstige Eltern-Kind-Interaktionen auch biologische Veränderungen auslösen können. Da biologische Prozesse auch an mentale Erfahrungen gekoppelt sind und somit eine Wechselbeziehung zwischen Umwelt und Genetik herrscht, könnten weiterführende epigenetische Untersuchungen zu einer Wissenserweiterung in der Auseinandersetzung mit tradierten Verhaltensweisen führen.
Die Implementierung eines bindungstheoretischen Frühinterventionsprogramms in das Angebotsspektrum von Fachberatungsstellen für Frauen mit sexualisierten Gewalterfahrungen zur Bedarfsdeckung der von Noll ausgewiesenen Lücken im Helfersystem, wird hiermit aufgrund der dargestellten Perspektiven empfohlen. Letzteres allerdings unter Berücksichtigung der theoretischen Rückschlüsse für Hilfs- und Beratungsangebote, die sich aus der Untersuchung des STEEP™-Programms in vorliegender Arbeit ergeben haben. Hierzu zählen:
1. Eine kritisch-reflexive Haltung gegenüber normativen Erziehungsvorstellungen und Ge- schlechterrollenbilder,
2. Eine kultursensible Beratungsweise auf allen Interventionsebenen,
3. Eine Ausweitung der elterlichen Zielgruppe, die am Interventionsprogramm teilnehmen darf. Dahingehend stellt sich die Frage, inwiefern die praktische Umsetzung einerflächendeckenden Implementierung eines solchen Programms in Fachberatungsstellen realisierbar ist. Hierfür sind finanzielle Rücklagen nötig, die staatlich oder anderweitig gefördert werden müssen. Das bedeutet auch, dass die Fachberatungsstellen und die Beratungsqualität von den Geldmitteln der Länder, Kommunen und Gemeinden abhängig sind.
Zielsetzungen weiterführender Forschungen sollten sein, die Wissensvorkommen der Beratungswissenschaft noch weiter auszubauen und interkulturelle Perspektiven in die Bindungswissenschaften zu integrieren. Die Ausführungen zur Mutterrolle innerhalb der Bindungstheorie lassen schlussfolgern, dass die interdisziplinäre und -kulturelle Ausrichtung der Bindungsforschung in Zukunft noch ausgeweitet werden muss um alle möglichen Perspektiven und Einflussfaktoren auf die Bindungsentwicklung des Menschen zu berücksichtigen.
Gleichzeitig sollte sich in Studien auch auf die Rolle der Väter und männlichen Beziehungspartner bei sexualisierten Gewalthandlungen an Frauen fokussiert werden. Weiterführende Forschungen, politische Diskurse, Aufklärungsarbeit und der Ausbau von Qualitätskriterien für Fachberatungsstellen tragen ausall diesen Gründen eine fortwährende Verantwortung innerhalb der Debatte um sexu- alisierter Gewalt.
In dieser Arbeit wurde sexualisierte Gewalt ausschließlich in Bezug auf Mädchen und Frauen betrachtet, da die Mutter-Kind-Bindung und der Einfluss von sexualisierter Gewalt auf Frauen, im Fokus der hier gestellten Forschungsfrage stehen. Abschließend wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Jungen und Männer sexualisierte Gewalt erleiden und dies ein gleichwertig relevantes Forschungsfeld ist, das eingehenden Untersuchungen bedarf und Ausgangspunkt für weiterführende Arbeiten darstellen könnte.
Literaturverzeichnis
Ahnert, Lieselotte/Spangler, Gottfried (2014): Die Bindungstheorie. In: Ahnert, Lieselotte (Hrsg.): Theorien der Entwicklungspsychologie. Berlin und Heidelberg: Springer-Verlag
Amann, Gabriele/Wipplinger, Rudolf(Hrsg.) (2005): Sexueller Missbrauch. Ein Überblick zu Forschung, Beratung und Therapie. Ein Handbuch. Tübingen: dgvt-Verlag
Andresen, Sabine/Demant, Marie (2017): Worin liegt die Verantwortung der Erziehungswissenschaft? Ein Diskussionsbeitrag zurAufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Erziehungswissenschaft. In: Erziehungwissenschaft 28 (2017) 54, S. 39-49, http://nbn- resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-148730(20.12.2020)
Arnemann, J. (2019): DNA-Methylierung. In: GressnerA.M., Arndt T. (eds): Lexikon der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik. Springer Reference Medizin. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48986-4_3465(01.01.2021)
Bange, Dirk (2002): Definitionen und Begriffe. In: Bange, Dirk/ Körner, Wilhelm (Hrsg.): Sexueller Missbrauch. Handwörterbuch. Göttingen: Hogrefe
Bange, Dirk (2018a): Politische Debatten rund um die Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt seit2010. In: Tuider, Elisabeth (Hrsg.): Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte.Theorie, Forschung, Praxis.Weinheim-Basel: BeltzJuventa
Bange, Dirk (2018b): Sexualisierte Gewalt und die Rolle der Eltern. In: Tuider, Elisabeth (Hrsg.): Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis. Weinheim-Basel: BeltzJuventa
Bange, Dirk (2018c): Familienbezogene Interventionen bei sexualisierterGewalt. In: Tuider, Elisabeth (Hrsg.): Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis.Weinheim-Basel: BeltzJuventa
Best, Laura (2020): Nähe und Distanz in der Beratung. Das Erleben der Beziehungsgestaltung aus der Perspektive des Adressaten. Soziale Arbeit als Wohlfahrtsorganisation, Dissertation Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 2019. Wiesbaden: Springer Fachmedien
Böllert, Karin (2014): Sexualisierte Gewalt. Institutionelle und professionelle Herausforderungen. Wiesbaden: Springer Fachmedien
Berghaus, Barry J. (2011):A New Look at Attachment Theory & Adult 'Attachment' Behavior. In: Behaviorology Today, Volume 14, No 2 https://www.behaviorology.org/oldsite/pdf/AttachmentTheoryBeh.pdf(10.01.2021)
Bolwby, John (1975): Bindung. Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung. Kindler Studienausgabe. München: Kindler Verlag
Bowlby, John (2008): Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendungen der Bindungstheorie. München: Ernst Reinhardt
Borke, Jörn/Schiller, Eva-Maria/Schöllhorn, Angelika/Kärtner, Joscha (2015): Kultur - Entwicklung - Beratung. Kultursensitive Therapie und Beratung für Familien mit Säuglingen und Kindern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Bretherton, Inge (2011): Die Geschichte der Bindungstheorie. In: Spangier, Gottfried/Zimmermann, Peter(Hrsg.): Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung undAnwendung. Stuttgart: Klett- Cotta
BundeskriminalamtfBKA] (2018): Partnerschaftsgewalt. KriminalstatistischeAuswertung. Berichtsjahr 2018. In: https://www.bka.de/DE/Aktuellelnformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/ Partnerschaftsgewalt/partnerschaftsgewalt_node.html (29.12.2020)
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend [BMFSFJ] (2012): Bericht der Bundesregierung zur Situation der Frauenhäuser, Fachberatungsstellen und anderer Unterstützungsangebote fürgewaltbetroffene Frauen und deren Kinder. Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, Drucksache 17/10500. In: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/bericht-der-bundesregierung-zur- situation-der-frauenhaeuser-fachberatungsstellen-und-anderer-unterstuetzungsangebote- fuer-gewaltbetroffene-frauen-und-deren-kinder/80630 (05.01.2021)
Büchele, Agnes (2010): Gewalt gegen Frauen: Viel erreicht! Wenig verändert? In: Ebermann et al. (Hg.) (2010): In Anerkennung der Differenz. Feministische Beratung und Psychotherapie. Gießen: Psychosozial-Verlag
Christmann, Bernd (2018): Mit Kindern sprechen. In: Tuider, Elisabeth (Hrsg.): Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis. WeinheimBasel: BeltzJuventa
Cierpka, Manfred (2005): Besser vorsorgen als nachsorgen. Möglichkeiten der psychosozialen Prävention. In: Cierpka, Manfred (Hrsg.): Möglichkeiten derGewaltprävention. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Crittenden, Patricia M. (2005): Präventive und therapeutische Intervention bei risikoreichen Mutter- Kind-Dyaden: Der Beitrag der Bindungstheorie und Bindungsforschung. In: Deutsches Jugendinstitut eV, IKK-Nachrichten 1-2/2005: Gewalt gegen Kinder: Früh erkennen - früh helfen
Denker, Hannah (2012): Bindung und Theory of Mind. Bildungsbezogene Gestaltung von Erzieherinnen-Kind-Interaktionen. Wiesbaden: Springer Fachmedien
Eickhorst, Andreas et. al. (2010): Elterliche Feinfühligkeit bei Müttern und Vätern mit psychosozialen Belastungen. Universitätisklinikum Heidelberg, Online-Publikation: Springer-Verlag, https://www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/f ruehehilfen.de/pdf/Bundesgesundheitsblatt_Artikel_Eickhorst.pdf (14.12.2020)
Erickson, Martha F./Egeland, Byron (2006): Die Stärkung der Eltern-Kind-Bindung. Frühe Hilfen für die Arbeit mit Eltern von der Schwangerschaft bis zum zweiten Lebensjahr des Kindes durch das STEEP™-Programm. Stuttgart: Klett-Cotta.
Fitzgerald, Michael(2020): Criticism of Attachment Theory. Department of Psychiatry, Trinity College Ireland. https://www.researchgate.net/publication/338696030_Criticism _of_Attachment_Theory_2020 (15.01.2021)
Freyberger, Harald J./Schneider,Wolfgang/Stieglitz, Rolf-Dieter(Hrsg.)(2002): Kompendium Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin. Bern: Verlag Hans Huber
Gawlich, Gabriele (2013): Herausforderungen der Interessenvertretung. Das Potenzial der Betroffenen unterstützen. In: Andresen, Sabine/Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.): Zerstörerische Vorgänge. Missachtung und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Institutionen. Weinheim und Basel: BeltzJuventa
Geier, Andrea (2020): Logik und Funktion von Misogynie. Probleme und Perspektiven. In: ethikundgesellschaft, 2/2020
Glammeier, Sandra (2018): Perspektiven der Geschlechtertheorie auf sexualisierte Gewalt. In: Tuider, Elisabeth (Hrsg.): Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis. Weinheim-Basel: BeltzJuventa
Grebenstein, Anne-Kathrin (2017): Sexualisierte Gewalt an Säuglingen und Kleinkindern im Kontext Früher Hilfen. Eine Expertise zu den Gründen für die geringe Beachtung von sexualisierter Gewalt im Praxisfeld Frühe Hilfen. Hildesheim: Universitätsverlag Hildesheim. E-Publikation: http://dx.doi.org/10.18442/701 (28.12.2020)
Grossmann, Klaus E. (2000): Bindungsforschung im deutschsprachigem Raum und derStand bindungstheoretischen Denkens. In: Psychologie in Erziehung und Unterricht. Jahrgang 47, Hefti, S. 221-237
Grossmann, Karin/Grossmann, Klaus E. (2012): Bindungen - das Gefüge psychischer Sicherheit. Stuttgart: Klett-Cotta
Grossmann, Klaus E./Grossmann, Karin (Hrsg.) (2015): Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie. Stuttgart: Klett-Cotta
Hagemann-White, Carol (2001): Gewalt gegen Frauen: Ein Überblick deutschsprachiger Forschung. In: Journal für Konflikt- und Gewaltforschung, Vol. 3, 2/2001, S. 23-44, http://www.uni- bielefeld.de/ikg/jkg/2-2001/hagemann-white.pdf(15.12.2020)
Hahn, Judith (2020): Die Ordnung des Weiblichen. Zur normativen Struktur und rechtlichen Konkretisierung von Misogynie im Licht von Kate Mannes „Down Girl". In: ethikundgesellschaft, 2/2020
Hellbrügge, Theodor (2012): Risiko- und Schutzfaktoren in der kindlichen Entwicklung. In: Brisch Karl. H./Hellbrügge, Theodor (Hrsg.): Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern. Stuttgart: Klett-Cotta
Helfferich, Cornelia/Kavemann, Barbara/Kindler, Heinz (Hrsg.) (2016): Forschungsmanual Gewalt. Grundlagen der empirischen Erhebung von Gewalt in Paarbeziehungen und sexualisierter Gewalt. Wiesbaden: Springer Fachmedien
Herman, Judith L. (2003): Die Narben der Gewalt. Traumatische Erfahrungen verstehen und überwinden. Paderborn (Konzepte der Psychotraumatologie, Bd. 3). (Originalausgabe erschienen 1992: Trauma und Recovery)
Hertrampf, Susanne (2008): Ein Tomatenwurf und seine Folgen. Eine neue Welle des Frauenprotests in der BRD. In: https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35287/neue- welle-im-westen (21.12.2020)
Heynen, Susanne (2006): Die Bedeutung subjektiverTheorien für Bewältigungsprozesse nach einer Vergewaltigung. In: Freiburger Frauenstudien 19, Budrich Journals
Hüther, Gerald (2007): Vorgeburtliche Einflüsse aufdie Gehirnentwicklung. In: Brisch, Karl Heinz (Hrsg.): Die Anfänge der Eltern-Kind-Bindung. Schwangerschaft, Geburt und Psychotherapie. Stuttgart: Klett-Cotta
Kavemann, Barbara (2000): Kinder und häusliche Gewalt - Kinder misshandelter Mütter. In: Landespräventionsrat Niedersachsen (Hrsg.): Kindesmisshandlung und Vernachlässigung, Vol. 3, Issue 2, S. 106-120
Kärtner, Joscha (2018): Kulturelle Unterschiede in der Erziehung. In: https://www.nifbe.de/component/themensammlung? view=item&id=93&catid=49&showall=1&start=0 (12.01.2021)
Keller, Heidi (2014): Kultur und Bindung. In: Ahnert, L. (Hrsg.): Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung: mit 42 Abbildungen und 16Tabellen. München/Basel
Kirschke, Karoline/Hörmann, Kerstin(2014): Grundlagen der Bindungstheorie, https://www.kita- fachtexte.de/flleadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_kirschke_hoermann_2014.pdf (10.12.2020)
Kißgen, Rüdiger/Suess, Gerhard J. (2005): Bindung in Hoch-Risiko-Familien. Ergebnisse aus dem Minnesota Parent Child Project. In: Frühförderung interdisziplinär, 24. Jg. München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag
Künster, Katrin/Ziegenhain, Ute (2014): Dossier Elterliche Feinfühligkeit und die kindliche Entwicklung - die Skala elterlicher Feinfühligkeit als Praxistool zur Beratung junger Eltern, 3/14, In: https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder- Jugendpsychiatrie/Dokumente/SHV_3_2014_Kuenster.pdf (23.12.2020)
Lohaus, Arnold/Heinrichs, Nina/Konrad, Kerstin(2018): LangfristigeAuswirkungenvon sexuellen Misshandlungserfahrungen. In: Tuider, Elisabeth (Hrsg.): Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte.Theorie, Forschung, Praxis.Weinheim-Basel: Beltz Juventa
Main, Mary (2012): Aktuelle Studien zur Bindung. In: Gloger-Tippelt, Gabriele (Hrsg.): Bindung im Erwachsenenalter. Ein Handbuch fürForschung und Praxis. Bern/Göttingen/Toronto/Seattle: Verlag Hans Huber
McCloskey, Laura/Bailey, JenniferA. (2000): The Intergenerational Transmission of Risk for Child Sexual Abuse. In: Journal of Interpersonal Violence. 2000;15(10),S. 1019-1035, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/088626000015010001(25.12.2020)
Mead, Margaret (1962): A cultural anthropologist's approach to maternal deprivation. In: Deprivation of maternal care. A Reassesment of its Effects. Geneva: WHO.
Menne, Klaus (2014): Erziehungsberatung im Kontext der Hilfen zur Erziehung. Fakten aus der Statistik. In: Scheuerer-Englisch (u.a.) (Hrsg.): Jahrbuch für Erziehungsberatung. Band 10. Weinheim und Basel: BeltzJuventa, S. 224-254
Moggi, Franz (2004): Folgen sexueller Gewalt. In: Körner, Wilhelm u.a. (Hrsg.) (2004): Sexueller Missbrauch: Band 1. Grundlagen und Konzepte. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe- Verlag
Mosser, Peter (2018a): Folgen und Nachwirkungen sexualisierter Gewalt. In: Tuider, Elisabeth (Hrsg.): Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis. Weinheim-Basel: BeltzJuventa
Mosser, Peter (2018b): Die Rolle von Jugendämtern, Ermittlungsbehörden und spezialisierten Beratungsstellen bei der Aufdeckung sexualisierter Gewalt. In: Tuider, Elisabeth (Hrsg.): Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis. Weinheim-Basel: BeltzJuventa
Mück, Karin (2008): Sensible Berichterstattung zum Thema Gewalt an Frauen. Wien: MA 57 - Frauenabteilung der Stadt Wien, S. 7-35
Noll, Milena (2013): Sexualisierte Gewalt und Erziehung. Auswirkungen familialer Erfahrungen auf die Mutter-Kind-Beziehungen. Opladen, Berlin &Toronto: Budrich UniPress.
Noll, Milena (2016): Feministische Beratung von Frauen mit sexualisierten Gewalterfahrungen. In: Wiltrud Gieseke/Dieter Nittel (Hrsg.): Handbuch Pädagogische Beratung über die Lebensspanne. Weinheim und Basel: Beltz Juventa
Oelkers, Jürgen (2018): Sexualisierte Gewalt inder Jugend- und Reformbewegung. In: Tuider, Elisabeth (Hrsg.) u.a. (2018): Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis.Weinheim-Basel: BeltzJuventa
Otto, Hiltrud/Keller, Heidi(2012): Bindung und Kultur. nifbe-Themenheft Nr.1. https://www.nifbe.de/images/nifbe/lnfoservice/Downloads/Themenhefte/ Bindung_und_Kultur_online.pdf (04.01.2021)
Pavkovic, Gari (2001): Erziehungsberatung mit Migrantenfamilien. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kindepsychiatrie. Ergebnisse aus Pschsychotherapie, Beratung und Psychiatrie 50 (2001), Heft 4, S. 252-264
Radicke, Christine (2014): Familiale Tradierungsprozesse in einer Drei-Generationen-Perspektive. Kontinuierliche Veränderungen - veränderliche Kontinuitäten. Erziehungswissenschaftliche Studien Band 1. Göttingen: Universitätsverlag
Rauh, Heilgard (2012): Erste Bindung (12-13 Monate). In: Stokowy, Martin/Sahar, Nicola (Hrsg.): Bindung und Gefahr. Das dynamische Reifungsmodell der Bindung und Anpassung. Gießen: Psychosozial-Verlag
Rauwald, Marianne (Hrsg.) (2013): Vererbte Wunden. Transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen. Weinheim & Basel: Beltz Verlag, S. 139-147
Rieske, Thomas V./Scambor, Elli/Wittenzeller, Ulla (2018): Aufdeckungsprozesse - Dimensionen und Verläufe. In: Tuider, Elisabeth (Hrsg.) u.a. (2018): Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte.Theorie, Forschung, Praxis.Weinheim-Basel: Beltz Juventa
Robert-Koch-Institut [RKI] (2008): Gesundheitliche Folgen von Gewalt unter besonderer Berücksichtigung von häuslicher Gewalt gegen Frauen. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 42
Scambor, Elli/Wittenzeller, Ulla/Rieske, Thomas V. (2018): Bedingungen für gelingende Aufdeckungsprozesse. In: Tuider, Elisabeth (Hrsg.) u.a. (2018): Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte. Theorie, Forschung, Praxis. Weinheim-Basel: Beltz Juventa
Schröttle, Monika/Müller, Ursula i.A. des BMFSFJ (2005): Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Ergebnisse der repräsentativen Untersuchung zu Gewalt gegen Deutschland, https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/studie--lebenssituation-sicherheit-und- gesundheit-von-frauen-in-deutschland/80694 (01.12.2020)
Schütze, Yvonne (2000): Wandel der Mutterrolle - Wandel der Familienkindheit? In: Herlth, Alois (Hrsg.): Spannungsfeld Familienkindheit. Neue Anforderungen, Risiken und Chancen. Opladen: Leske + Budrich, 92-105
Simkin, Penny u.a (2015): Wenn missbrauchte Frauen Mutter werden: Die Folgen früher sexueller Gewalt und therapeutische Hilfen. Stuttgart: Klett-Cotta
Strauß, Bernhard (2018): Die Gruppe als sichere Basis. Bindungstheoretische Überlegungen zur Gruppenpsychotherapie. In: Strauß, Bernhard/Mattke, Dankwart(Hrsg.): Gruppenpsychotherapie. Lehrbuch fürdie Praxis. Berlin und Heidelberg: Springer-Verlag
Statistisches Bundesamt [StBA] (2020): Durchschnittliches Alter der Mutter bei der Geburt des Kindes 2019 (biologische Geburtenfolge) nach Bundesländern, Statistisches Bundesamt (Destatitis). In: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/geburten-mutter-alter-bundeslaender.html (02.02.2021)
Suomi, Stephen/van der Horst, Frank/van derVeer, René (2008): Rigorous Experiments on Monkey Love: An Account of Harry F. Harlows Role in the History ofAttachement Theory. In: Intergrative Psychological and Behavioral Science 42, S. 345-369.
World Health Organization [WHO] (2005): WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women: summary report of initial results on prevalence, health outcomes and women's responses. Geneva: World Health Organization
Ziegenhain, Ute (2007): Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenzen bei jugendlichen Müttern. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. Göttingen: Vanden- hoeck & Ruprecht, S. 660-675
[...]
1 Die Neue Frauenbewegung entstand in den 1970er Jahren durch studentische Frauengruppen, die mit verschiedenen Aktionen vorherrschende, geschlechtsspezifische Ungleichheiten in das Blickfeld des öffentlichen Interesses rücken wollten und dadurch eine große mediale Aufmerksamkeit fürdas Thema generierten (vgl. Hertrampf 2008)
2 In der Studie wurde der englische Begriff „traditional" verwendet, allerdings nicht weiter eingegrenzt, weshalb auf eine wörtliche Übersetzung des Wortes in die deutsche Sprache zurückgegriffen wurde.
3 „Während die Psychopathologie den Querschnitt wie den Verlauf symptomatologisch [...] abbildet, sagt sie allein nichts Definitives [...] aus. Psychopathologische Merkmale werden auf unterschiedliche Weise erfasst. Die Entscheidung, ob ein bestimmtes Phänomen pathologisch anzusehen ist, basiert letztlich auf der Fremdbeurteilung des Untersuchers." (Freyberger/Schneider/Stieg- litz 2002: 4)
4 „DNA-Methylierung ist im Wesentlichen ein Mechanismus zur Regulation von Genaktivitäten, aber auch zur Gestaltung des Entwicklungsprogramms eines Organismus." (Arnemann 2019)
5 Das Suchportalwurde über folgenden Link aufgerufen: https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer- naehe/kartensuche.html (03.01.2021)
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit beschäftigt sich mit sexualisierter Gewalt an Frauen und deren Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Bindung, unter besonderer Berücksichtigung des bindungstheoretischen Interventionsprogramms STEEP™.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst die Einführung, sexualisierte Gewalt an Frauen (Definition, Auswirkungen, Bewältigung), die Mutter-Kind-Bindung nach Bowlby/Ainsworth, das Interventionsprogramm STEEP™, reflexive Perspektiven auf STEEP™ und die Schlussbetrachtung.
Was sind die wichtigsten Definitionen und Prävalenzangaben zu sexualisierter Gewalt?
Sexualisierte Gewalt wird im Kontext strafrechtlicher Relevanz definiert als Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Die Prävalenz variiert je nach Definition und Studie, wobei bis zu 34% der Frauen in Deutschland von verschiedenen Formen sexueller Belästigung betroffen sein könnten.
Welche sozialen Auswirkungen hat sexualisierte Gewalt auf Frauen?
Soziale Auswirkungen umfassen den sozialen Rückzug, Belastungen in Paarbeziehungen (bis hin zu Trennungen), Einschränkungen in Ausbildung und Beruf, sowie Schuldzuweisungen und Stereotypisierung von Opfern.
Welche psychopathologischen Auswirkungen sind mit sexualisierter Gewalt verbunden?
Psychopathologische Auswirkungen können Depressionen, Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS), Suchterkrankungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen (BPS), Angst-, Ess- und Sexualstörungen sowie Suizidgefährdung umfassen.
Was bedeutet transgenerationale Weitergabe von sexualisierter Gewalt?
Transgenerationale Weitergabe bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, sexualisierte Gewalt zu erleben, von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden kann, sowohl durch Überlieferung von Verhaltensweisen als auch durch biologische Veränderungen.
Welche Rolle spielen Bewältigung, Aufdeckung und Intervention bei sexualisierter Gewalt?
Bewältigungsstrategien können Verdrängung, aber auch den Drang, über das Erlebte zu sprechen, umfassen. Aufdeckungsprozesse beinhalten Erinnern, Einordnen und Offenlegen der Gewalt. Interventionen zielen darauf ab, Betroffenen Anerkennung, Schutz, Verständnis und Unterstützung zu bieten.
Was sind die Grundannahmen der Bindungstheorie nach Bowlby/Ainsworth?
Die Bindungstheorie geht davon aus, dass das Bedürfnis nach engen, emotionalen Beziehungen ein menschliches Grundbedürfnis ist. Eine sichere Bindung zur Bezugsperson (vor allem der Mutter) ist wichtig für die Entwicklung psychischer Sicherheit und Emotionsregulation.
Was ist die "Fremde Situation" und wie wird sie in der Bindungsforschung eingesetzt?
Die "Fremde Situation" ist ein standardisiertes Verfahren, um das Bindungsverhalten von Kindern zu untersuchen, indem ihre Reaktion auf Trennung und Wiedervereinigung mit der Mutter in einer fremden Umgebung beobachtet wird.
Was bedeutet "mütterliche Feinfühligkeit" und wie wird sie erfasst?
Mütterliche Feinfühligkeit bezieht sich auf die Fähigkeit der Mutter, die Signale ihres Kindes wahrzunehmen, korrekt zu interpretieren, angemessen darauf zu reagieren und dies unmittelbar zu tun. Sie wird anhand von Skalen zur Erfassung mütterlicher (Un-)Feinfühligkeit bewertet.
Welches Mutterbild liegt der Bindungstheorie zugrunde?
Die Bindungstheorie sieht die Mutter oft als primäre Bezugsperson, die hauptverantwortlich für das kindliche Wohlbefinden ist. Dieses Mutterbild ist jedoch normativ und von westlichen Idealvorstellungen geprägt.
Was ist das Interventionsprogramm STEEP™ und welche Ziele verfolgt es?
STEEP™ ("Steps Towards Effective Enjoyable Parenting") ist ein bindungstheoretisch fundiertes Frühinterventionsprogramm zur Förderung und Begleitung von Hoch-Risiko-Familien. Ziele sind u.a. die Förderung gesunder Einstellungen zur Elternschaft, besseres Verständnis kindlicher Entwicklung, feinfühlige Reaktionen auf kindliche Signale und die Stärkung sozialer Netzwerke.
Welche Methoden werden im STEEP™-Programm eingesetzt?
Methoden umfassen die Begleitung durch eine STEEP™-Beraterin, die verschiedene Strategien anwendet, die "Seeing is Believing™"-Strategie (Videoaufnahmen von Eltern und Kindern) sowie Hausbesuche und Gruppentreffen.
Welche Kritikpunkte gibt es am STEEP™-Programm im Kontext sexualisierter Gewalt?
Kritikpunkte umfassen konzeptionelle Leerstellen durch die Übernahme normativer Erziehungs- und Mutterbilder aus der Bindungstheorie, mangelnde kultursensible Betrachtungen und begrenzte Zugangskriterien. Es wird die Idealisiertung eines sicheren Bindungsmusters hervorgehoben.
Welche Empfehlungen werden für Hilfs- und Beratungsstellen im Umgang mit Frauen mit sexualisierter Gewalt gegeben?
Empfohlen wird die Implementierung bindungstheoretischer Frühinterventionsprogramme, die die Mutter-Kind-Bindung, das Erziehungsverhalten und die psychische Verfassung der Mutter assoziativ betrachten, unter Berücksichtigung kultursensibler Beratungsweisen und einer kritisch-reflexiven Haltung gegenüber normativen Erziehungsvorstellungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Sexualisierte Gewalterfahrungen von Müttern und die Mutter-Kind-Bindung. Reflexive Perspektiven auf das STEEP-Programm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1148218