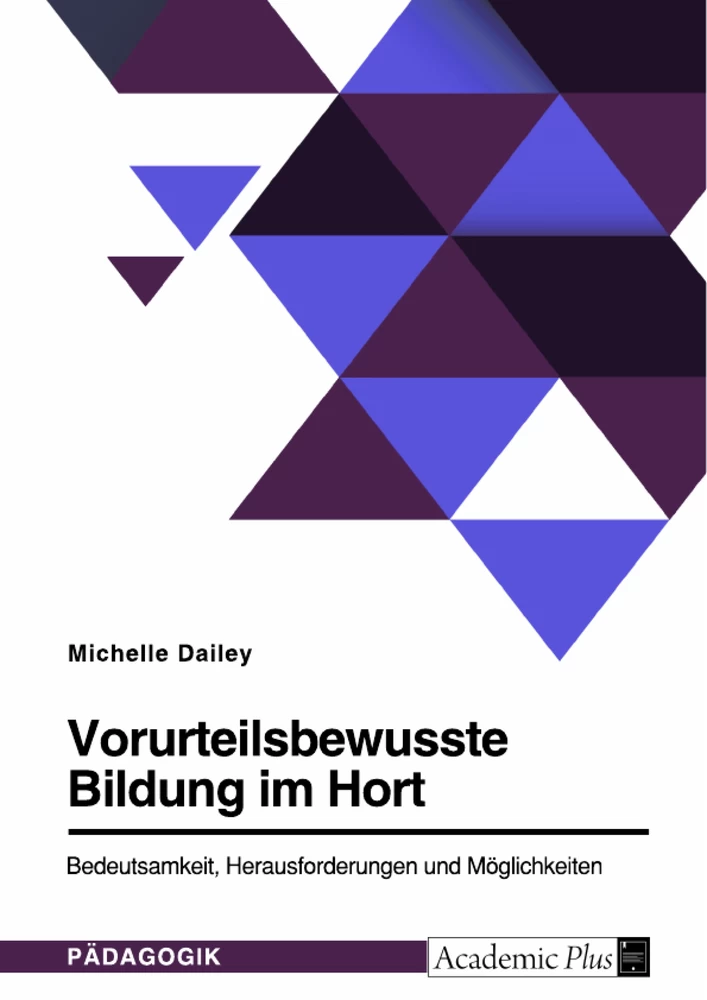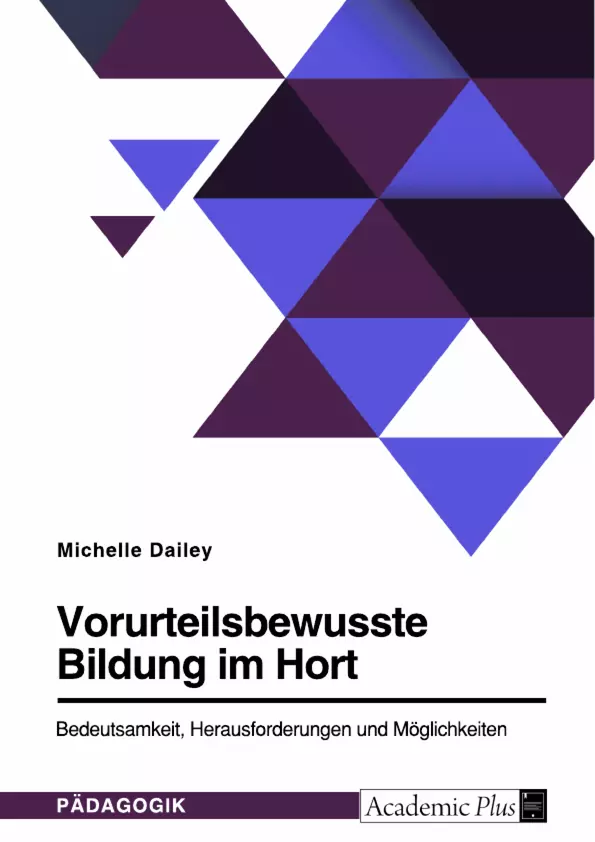Diese Studie stellt eine Weiterentwicklung akademischer Theorieproduktion zu vorurteilsbewusster Bildung dar. Anhand eines Beispielhorts in Mecklenburg-Vorpommern werden diskriminierender Ausgrenzungspraktiken im Hort analysiert und die Bedeutsamkeit vorurteilsbewusster Aus- und Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte herausgearbeitet. Daran anschließend werden Herausforderungen für eine Verstetigung sowie konkrete Möglichkeiten einer Anwendung erarbeitet. Im Fokus dabei steht die Extraktion subjektiver Einstellungen der Fachkräfte zu Ausgrenzung und Diskriminierungsprozessen im Hort sowie Rahmenbedingungen, die von den Fachkräften in Bezug auf das Thema der Arbeit bedeutsam gemacht werden.
Innerhalb der Studie werden zehn Expert*inneninterviews von Fachkräften aus unterschiedlichen Disziplinen ausgewertet und mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring sowie interpretativer Methoden nach Jean-Claude Kaufmann ausgewertet.
Interdisziplinäre Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass Erziehungs- und Bildungsinstitutionen Räume sind, in denen Vorurteile, Stereotype und Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen verschiedener Zugehörigkeiten reproduziert werden. Dies hat insbesondere auf junge Kinder negative Effekte, da sie entweder in ihrer Identitätsentwicklung und der Teilhabe am pädagogischen Alltag behindert werden oder bereits früh lernen, Diskriminierung gegen benachteiligte Kinder auszuüben. Pädagogischen Fachkräften kann hierbei eine wichtige Schlüsselfunktion beigemessen werden, da sie eine Vorbildfunktion für Kinder erfüllen und den Alltag sowie das Miteinander in Grundschule und Hort ausgestalten. Dennoch existieren keine flächendeckenden Reflexions- und Weiterbildungsräume, in denen Fachkräfte sich mit der eigenen Verstrickung in gesellschaftliche Ungleichgewichte beschäftigen und ihre pädagogische Praxis diesbezüglich reflektieren können.
Bildungsarbeit mit intersektionalen Ansätzen kann der Diskriminierungsrealität, die in deutschen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen bei gleichzeitigem Diskriminierungsverbot herrscht, gerecht werden. Der Ansatz vorurteilsbewusster Bildung ist besonders anschlussfähig für Antidiskriminierungsarbeit im Hort, da er die individuelle Rolle in gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen ebenso berücksichtigt, wie strukturelle Auswirkungen dieser.
Inhaltsverzeichnis
- DANKSAGUNG
- INHALTSVERZEICHNIS
- VORWORT
- 1 EINLEITUNG
- 1.1 ERKENNTNISINTERESSE UND FORSCHUNGSSTAND
- 1.2 AUFBAU DER ARBEIT
- 2 VORURTEILSBEWUSSTE BILDUNG ALS BILDUNGSPRAKTISCHER GEGENSTAND
- 2.1 HISTORISCHE ENTWICKLUNG
- 2.2 GRUNDANNAHMEN
- 2.3 ZIELE VORURTEILSBEWUSSTER BILDUNGSARBEIT
- 3 DISKRIMINIERENDE AUSGRENZUNGSPRAKTIKEN
- 3.1 BEGRIFFSERKLÄRUNG
- 3.1.1 Othering
- 3.1.2 Diskriminierung
- 3.2 KONSTRUKTIONSPROZESSE DES PÄDAGOGISCHEN ALLTAGS
- 3.2.1 Performativitätstheorie
- 3.2.2 Diskursive Ausgrenzungspraktiken
- 3.2.3 Ausgrenzung in deutschen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen am Beispiel Rassismus
- 3.1 BEGRIFFSERKLÄRUNG
- 4 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR HORT UND PRÄZISIERUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN
- 4.1 FALLSTRICKE DER HORTARBEIT
- 4.2 DISKURSIVE AUSGRENZUNGSPRAKTIKEN IM UNTERSUCHTEN HORT
- 5 GRUNDPRINZIPIEN QUALITATIVER FORSCHUNG
- 5.1 (FREMD-) VERSTEHEN ALS ERKENNTNISPRINZIP
- 5.2 GÜTEKRITERIEN QUALITATIVER FORSCHUNG
- 6 METHODOLOGISCHE RAHMUNG
- 6.1 CHANCEN UND HÜRDEN EINER SEKUNDÄRANALYSE
- 6.2 DARSTELLUNG DES KONTEXTS, IN DEM DIE DATEN ERHOBEN WURDEN
- 6.2.1 Erhebungsmethode des qualitativen Expert*inneninterviews
- 6.2.2 Die Expert*in und ihr Wissen
- 6.3 AUSWERTUNG
- 6.3.1 Primärauswertung qualitative Inhaltsanalyse
- 6.3.2 Sekundärauswertung via Methoden nach Kaufmann
- 6.4 METHODISCHE GRENZEN
- 7 DOKUMENTATION UND REFLEXION DES FORSCHUNGSPROZESSES
- 7.1 ERHEBUNGSPROZESS INNERHALB DES MODELLPROJEKTS
- 7.1.1 Vorstellung des Modellprojekts Hortdialoge & Beteiligung
- 7.1.2 Fallauswahl
- 7.1.3 Leitfadenentwicklung
- 7.1.4 Durchführung der Expert*inneninterviews
- 7.1.5 Datenaufbereitung
- 7.1.6 Eignung der erhobenen Daten für Erkenntnisprozess
- 7.2 AUSWERTUNG DER DATEN
- 7.2.1 Methodische Vorbereitung
- 7.2.2 Erstellung eines Kodierleitfadens
- 7.2.3 Materialdurchlauf
- 7.2.4 Ergebnisaufbereitung
- 7.2.5 Interpretation
- 7.3 DARSTELLUNG VON LERNFORTSCHRITTEN
- 7.3.1 Interviewsituation
- 7.3.2 Auswertung
- 7.1 ERHEBUNGSPROZESS INNERHALB DES MODELLPROJEKTS
- 8 DISKUSSION
- 8.1 ERGEBNISSE
- 8.1.1 Bedeutsamkeit vorurteilsbewusster Bildung
- 8.1.2 Herausforderungen in der alltäglichen Arbeit für die befragten Fachkräfte
- 8.1.3 Möglichkeiten
- 8.2 ZUSAMMENFASSUNG
- 8.3 IMPLIKATIONEN FÜR ZUKÜNFTIGE STUDIEN
- 8.1 ERGEBNISSE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Bedeutsamkeit, Herausforderungen und Möglichkeiten vorurteilsbewusster Bildung im Hort. Ziel ist es, diskriminierende Ausgrenzungspraktiken im Hortkontext zu beleuchten und Handlungsempfehlungen für die Praxis zu entwickeln. Die Arbeit basiert auf einer qualitativen Sekundäranalyse von Expert*inneninterviews.
- Vorurteilsbewusste Bildung im Hortkontext
- Diskriminierende Ausgrenzungspraktiken und deren Konstruktionsprozesse
- Herausforderungen und Fallstricke in der Hortarbeit
- Möglichkeiten zur Förderung vorurteilsbewusster Bildung im Hort
- Methodologische Reflexion der qualitativen Sekundäranalyse
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Masterarbeit ein. Es beschreibt das Erkenntnisinteresse und den Forschungsstand zu vorurteilsbewusster Bildung, insbesondere im Hortkontext. Der Aufbau der Arbeit wird erläutert und die Forschungsfragen werden formuliert. Die Einleitung legt den Grundstein für die gesamte Arbeit, indem sie den Kontext und die Relevanz des Themas herausstellt.
2 Vorurteilsbewusste Bildung als bildungspraktischer Gegenstand: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung. Es beleuchtet die historische Entwicklung, die Grundannahmen und die Ziele vorurteilsbewusster Bildungsarbeit. Es wird ein fundiertes Verständnis des Konzepts geschaffen, das als Basis für die spätere Analyse der empirischen Daten dient. Die Ausführungen zu Zielen und Grundannahmen bilden eine wichtige Brücke zum folgenden Kapitel über diskriminierende Ausgrenzungspraktiken.
3 Diskriminierende Ausgrenzungspraktiken: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Othering“ und „Diskriminierung“ und analysiert die Konstruktionsprozesse diskriminierender Praktiken im pädagogischen Alltag. Es werden theoretische Ansätze wie die Performativitätstheorie und diskursive Ausgrenzungspraktiken herangezogen, um die Entstehung und Reproduktion von Diskriminierung zu erklären. Der Abschnitt zum Rassismus in deutschen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen verdeutlicht die gesellschaftliche Relevanz des Themas.
4 Schlussfolgerungen für Hort und Präzisierung der Forschungsfragen: Dieses Kapitel zieht erste Schlussfolgerungen aus den theoretischen Ausführungen und präzisiert die Forschungsfragen im Hinblick auf den Hortkontext. Es werden spezifische Fallstricke der Hortarbeit im Umgang mit Diskriminierung benannt und der Fokus auf diskursive Ausgrenzungspraktiken im untersuchten Hort gelegt. Dies bildet den Übergang zur methodischen Beschreibung der Arbeit.
5 Grundprinzipien qualitativer Forschung: Das Kapitel erläutert die grundlegenden Prinzipien qualitativer Forschung, insbesondere das (Fremd-)Verstehen als Erkenntnisprinzip und die Gütekriterien qualitativer Forschung. Es stellt das methodologische Fundament der Arbeit dar und rechtfertigt die gewählte Forschungsstrategie. Die detaillierte Ausführung schafft Transparenz und ermöglicht eine kritische Auseinandersetzung mit der Methodik.
6 Methodologische Rahmung: Dieses Kapitel beschreibt die methodologische Vorgehensweise der Arbeit. Es beleuchtet Chancen und Hürden einer Sekundäranalyse, stellt den Kontext der Datenerhebung vor (qualitative Expert*inneninterviews), beschreibt die Auswertungsmethode (qualitative Inhaltsanalyse und Methoden nach Kaufmann) und reflektiert die methodischen Grenzen. Die detaillierte Darstellung der Methode erlaubt eine umfassende Beurteilung der Validität und der Aussagekraft der Ergebnisse.
7 Dokumentation und Reflexion des Forschungsprozesses: Dieses Kapitel dokumentiert den gesamten Forschungsprozess detailliert, von der Vorstellung des Modellprojekts bis zur Interpretation der Ergebnisse. Es beschreibt die einzelnen Schritte der Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung und reflektiert den eigenen Lernprozess während der Forschung. Die transparente Darstellung der Vorgehensweise erhöht die Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Vorurteilsbewusste Bildung, Hort, Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassismus, Qualitative Forschung, Sekundäranalyse, Expert*inneninterviews, Pädagogischer Alltag, Performativität, Diskursanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Vorurteilsbewusste Bildung im Hort
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Bedeutung, Herausforderungen und Möglichkeiten vorurteilsbewusster Bildung in Hort-Einrichtungen. Sie beleuchtet diskriminierende Ausgrenzungspraktiken im Hortkontext und entwickelt daraus Handlungsempfehlungen für die Praxis. Die Arbeit basiert auf einer qualitativen Sekundäranalyse von Expert*inneninterviews.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Vorurteilsbewusste Bildung im Hortkontext, diskriminierende Ausgrenzungspraktiken und deren Entstehungsprozesse, Herausforderungen und Fallstricke in der Hortarbeit, Möglichkeiten zur Förderung vorurteilsbewusster Bildung im Hort und eine methodologische Reflexion der qualitativen Sekundäranalyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung (mit Forschungsstand und Forschungsfragen), Vorurteilsbewusste Bildung als bildungspraktischer Gegenstand (theoretische Grundlagen), Diskriminierende Ausgrenzungspraktiken (Definitionen und Analyse von Konstruktionsprozessen), Schlussfolgerungen für Hort und Präzisierung der Forschungsfragen, Grundprinzipien qualitativer Forschung, Methodologische Rahmung (Beschreibung der Sekundäranalyse und der Auswertungsmethoden), Dokumentation und Reflexion des Forschungsprozesses (detaillierte Darstellung der Vorgehensweise) und Diskussion (Ergebnisse, Zusammenfassung, Implikationen für zukünftige Studien).
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer qualitativen Sekundäranalyse von bereits erhobenen Daten aus qualitativen Expert*inneninterviews. Die Auswertung der Daten erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse und Methoden nach Kaufmann. Die Arbeit reflektiert explizit die Chancen und Herausforderungen einer Sekundäranalyse und die methodischen Grenzen des Vorgehens.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Arbeit beleuchten die Bedeutung vorurteilsbewusster Bildung im Hort, zeigen Herausforderungen in der täglichen Arbeit der befragten Fachkräfte auf und präsentieren Möglichkeiten zur Verbesserung der Praxis. Die konkreten Ergebnisse werden im Kapitel „Diskussion“ detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vorurteilsbewusste Bildung, Hort, Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassismus, Qualitative Forschung, Sekundäranalyse, Expert*inneninterviews, Pädagogischer Alltag, Performativität, Diskursanalyse.
Wo findet man die detaillierte Methodik?
Kapitel 6 ("Methodologische Rahmung") beschreibt detailliert die methodische Vorgehensweise, inklusive der Chancen und Herausforderungen der Sekundäranalyse, der Beschreibung der Datenerhebung (qualitative Expert*inneninterviews), der Auswertungsmethode (qualitative Inhaltsanalyse und Methoden nach Kaufmann) und der Reflexion methodischer Grenzen.
Wie ist der Aufbau der Arbeit strukturiert?
Das Inhaltsverzeichnis im HTML-Dokument gibt einen detaillierten Überblick über den Aufbau der Arbeit mit allen Kapiteln und Unterkapiteln.
- Citar trabajo
- Michelle Dailey (Autor), 2021, Vorurteilsbewusste Bildung im Hort. Bedeutsamkeit, Herausforderungen und Möglichkeiten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1149161