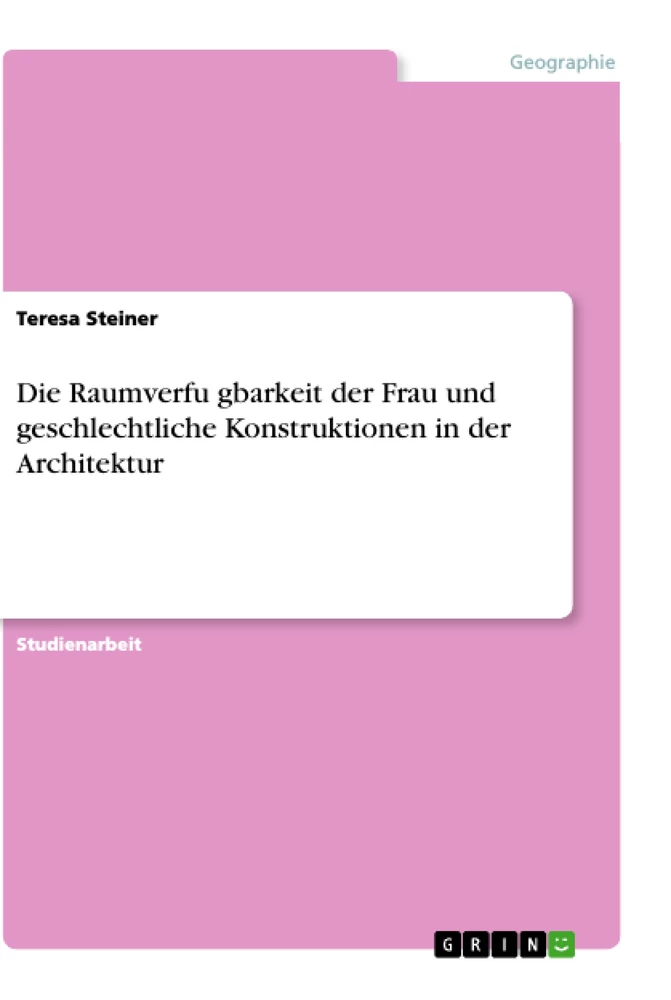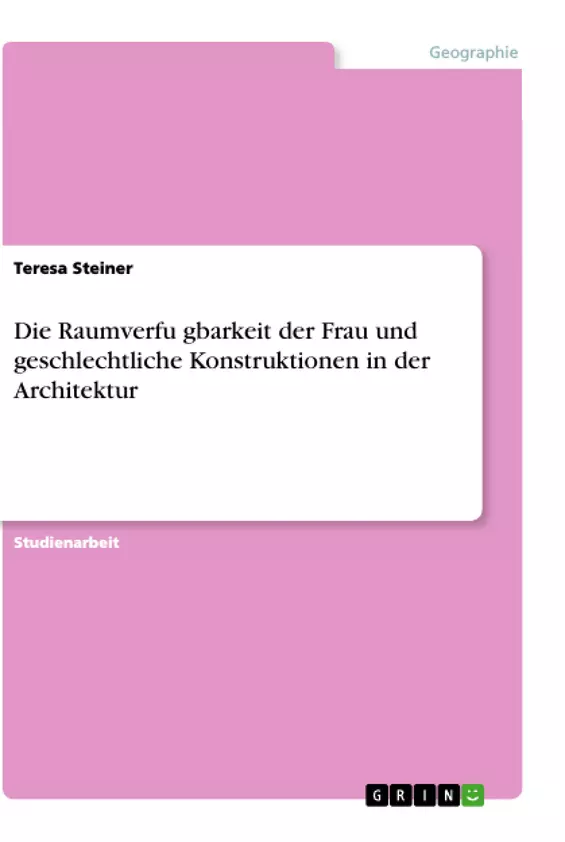Worin besteht der Unterschied der Raumverfügbarkeit von/für Frau und Mann? Wie hat sich diese historisch entwickelt und wie sieht diese sowohl innerhalb der Kulturgeschichte, als auch in der geschlechtlichen Konstruktion sozialer Räume aus? Diese Arbeit thematisiert die historische Geschlechter- und Raumzuordung im privaten und öffentlichen Raum, die Hauptpraktiken des "caring" innerhalb des "domestic space", als angeblich natürlichen Trieb der Frau sowie die Stellung des weiblichen Architektenberufs im 21. Jahrhundert. Im Laufe von drei Kapiteln wird illustriert, wie sich Frau und Mann durch die Geschichtsschreibung "Raum" aneignen (Kapitel 1); den "Raum", den sie anschließend haben, pflegen (Kapitel 2) und auf welche Weise Architektinnen im 21. Jahrhundert "Raum" schaffen (Kapitel 3), während sie tradierte Vorurteile und verstaubte Klischees bereinigen. Dabei ist es wichtig, die binäre Beziehungskultur von Geschlecht und Raum, Identität und Konstruktion, Theorie und Praxis, Wunsch und Wirklichkeit herauszuarbeiten, und diese um eine feministische Ethik zu ergänzen.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Raum aneignen.
- 1.1. Anfänge der Raumaneignung in ursprünglichen Gesellschaften
- 1.2. Oikos und Polis: Sie innen, Er außen.
- 1.3. Gendered spaces — Historische Reproduktion geschlechtlicher Raumzuordnung und binärer Hierarchie in der Architektur
- Kapitel 2: ›Raum‹ haben, Räume pflegen.
- 2.1. Caring labour. Eine Ethik der räumlichen Fürsorge
- 2.2. "Produktive Arbeit" des Mannes und "Nichtarbeit” der Frau
- 2.3. Reinigen, Shoppen, die Welt reparieren - Die natürliche Arbeit der Frau?
- 2.4. Kunst im domestic space: Kritik und Persiflage an der Rolle der ›Hausfrau‹ anhand feministischer Performance-Art
- Kapitel 3: Raum schaffen.
- 3.1. Berufsmythos “Der Architekt als männliches Genius”
- 3.2. Frauen in der Architektur. Frauenarchitektur?
- 3.3. Architektur als Spiegel gesellschaftlicher Werturteile
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die ungleiche Raumverfügbarkeit von Frauen und Männern im historischen und gesellschaftlichen Kontext. Sie analysiert die geschlechtsspezifische Konstruktion sozialer Räume und beleuchtet die Rolle von Architektur und Raumgestaltung in der Reproduktion geschlechtlicher Machtstrukturen. Die Arbeit strebt ein emanzipatorisches Erkenntnisinteresse an und hinterfragt traditionelle Geschlechterrollen im Umgang mit Raum.
- Geschlechtsspezifische Raumzuordnung in der Geschichte
- „Caring Labour“ und die Konstruktion weiblicher Hausarbeit
- Die Rolle der Frau in der Architektur
- Raum als Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse
- Feministische Perspektiven auf Raum und Geschlecht
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Raum aneignen.: Dieses Kapitel untersucht die Ursprünge der ungleichen Raumverfügbarkeit zwischen Frauen und Männern. Es beleuchtet die Konstruktion von Geschlecht als binäres System (aktiv/passiv, subjektiv/objektiv, männlich/weiblich) seit der Antike und diskutiert die veränderte Wahrnehmung von Raum in der Postmoderne. Mit Bezug auf Theorien von Henri Lefebvre und Michel Foucault wird Raum als soziales Gefüge und Machtstruktur analysiert, wobei die Raumaneignung als Ausdruck von Macht verstanden wird. Pierre Bourdieus Theorie des Habitus und Habitats wird herangezogen, um die unterschiedlichen Raumverhältnisse von Männern und Frauen zu erklären. Das Kapitel legt den Grundstein für die Analyse der geschlechtsspezifischen Raumverhältnisse in den folgenden Kapiteln.
Kapitel 2: ›Raum‹ haben, Räume pflegen.: Kapitel 2 konzentriert sich auf die "natürliche Arbeit" der Frau, insbesondere die Hausarbeit und den damit verbundenen "Caring Labour". Es hinterfragt die Konstruktion der weiblichen Rolle im "domestic space" als Ort der Pflege und Reinigung und analysiert kritisch, wie diese Tätigkeit als "Nichtarbeit" im Gegensatz zur produktiven Arbeit des Mannes dargestellt wird. Feministische Performance-Art wird als Mittel der Kritik und Persiflage an den traditionellen Geschlechterrollen im häuslichen Bereich untersucht. Das Kapitel verdeutlicht, wie die scheinbar private Sphäre des Haushalts mit gesellschaftlichen Machtstrukturen und der ungleichen Verteilung von Arbeit und Verantwortung verbunden ist.
Kapitel 3: Raum schaffen.: Das dritte Kapitel beleuchtet die Rolle von Frauen in der Architektur, im Kontrast zum etablierten "Berufsmythos" des männlichen Architekten als Genie. Es untersucht die Unterrepräsentanz von Frauen im Architekturberuf und analysiert, wie Architektur selbst als Spiegel gesellschaftlicher Werturteile fungiert und die geschlechtsspezifische Raumgestaltung widerspiegelt. Das Kapitel reflektiert über die Möglichkeiten und Herausforderungen für Architektinnen, tradierte Vorurteile zu überwinden und geschlechtergerechte Räume zu schaffen.
Schlüsselwörter
Raum, Macht, Gender, Raumverfügbarkeit, Geschlechterkonstruktion, Architektur, Caring Labour, Hausarbeit, Frauen in der Architektur, feministische Ethik, soziale Räume, Machtstrukturen, Habitus, Habitat.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Raum und Geschlecht
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die ungleiche Raumverfügbarkeit von Frauen und Männern im historischen und gesellschaftlichen Kontext. Sie analysiert die geschlechtsspezifische Konstruktion sozialer Räume und die Rolle von Architektur und Raumgestaltung bei der Reproduktion geschlechtlicher Machtstrukturen. Der Fokus liegt auf einem emanzipatorischen Erkenntnisinteresse und der Hinterfragung traditioneller Geschlechterrollen im Umgang mit Raum.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die zentralen Themen sind geschlechtsspezifische Raumzuordnung in der Geschichte, „Caring Labour“ und die Konstruktion weiblicher Hausarbeit, die Rolle der Frau in der Architektur, Raum als Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse und feministische Perspektiven auf Raum und Geschlecht. Die Arbeit beleuchtet die Ursprünge ungleicher Raumverfügbarkeit, die „natürliche Arbeit“ der Frau und den Berufsmythos des männlichen Architekten.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel 1: Raum aneignen: Untersucht die Ursprünge ungleicher Raumverfügbarkeit, die Konstruktion von Geschlecht als binäres System und Raum als soziales Gefüge und Machtstruktur. Theorien von Lefebvre, Foucault und Bourdieu werden angewendet.
Kapitel 2: ›Raum‹ haben, Räume pflegen: Konzentriert sich auf die „natürliche Arbeit“ der Frau, Hausarbeit und „Caring Labour“. Analysiert die Konstruktion der weiblichen Rolle im „domestic space“ und kritisiert die Darstellung dieser Tätigkeit als „Nichtarbeit“. Feministische Performance-Art wird als kritisches Mittel untersucht.
Kapitel 3: Raum schaffen: Beleuchtet die Rolle von Frauen in der Architektur im Gegensatz zum männlichen Architekten als Genie. Analysiert die Unterrepräsentanz von Frauen und Architektur als Spiegel gesellschaftlicher Werturteile. Reflektiert über Möglichkeiten und Herausforderungen für Architektinnen.
Welche Methoden werden in der Hausarbeit verwendet?
Die Hausarbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode, die auf der Analyse bestehender Literatur und Theorien basiert. Sie analysiert geschlechtsspezifische Raumzuordnungen historisch und gesellschaftlich und verwendet Theorien von Henri Lefebvre, Michel Foucault und Pierre Bourdieu, um die ungleiche Raumverfügbarkeit zu erklären. Feministische Perspektiven und die Analyse von Performance-Art bilden weitere methodische Ansätze.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit am besten?
Raum, Macht, Gender, Raumverfügbarkeit, Geschlechterkonstruktion, Architektur, Caring Labour, Hausarbeit, Frauen in der Architektur, feministische Ethik, soziale Räume, Machtstrukturen, Habitus, Habitat.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit strebt ein emanzipatorisches Erkenntnisinteresse an. Sie will die ungleiche Raumverfügbarkeit von Frauen und Männern aufzeigen und die Rolle von Architektur und Raumgestaltung bei der Reproduktion geschlechtlicher Machtstrukturen analysieren. Letztendlich zielt sie auf eine kritische Hinterfragung traditioneller Geschlechterrollen im Umgang mit Raum ab.
- Citar trabajo
- Teresa Steiner (Autor), 2021, Die Raumverfügbarkeit der Frau und geschlechtliche Konstruktionen in der Architektur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1149192