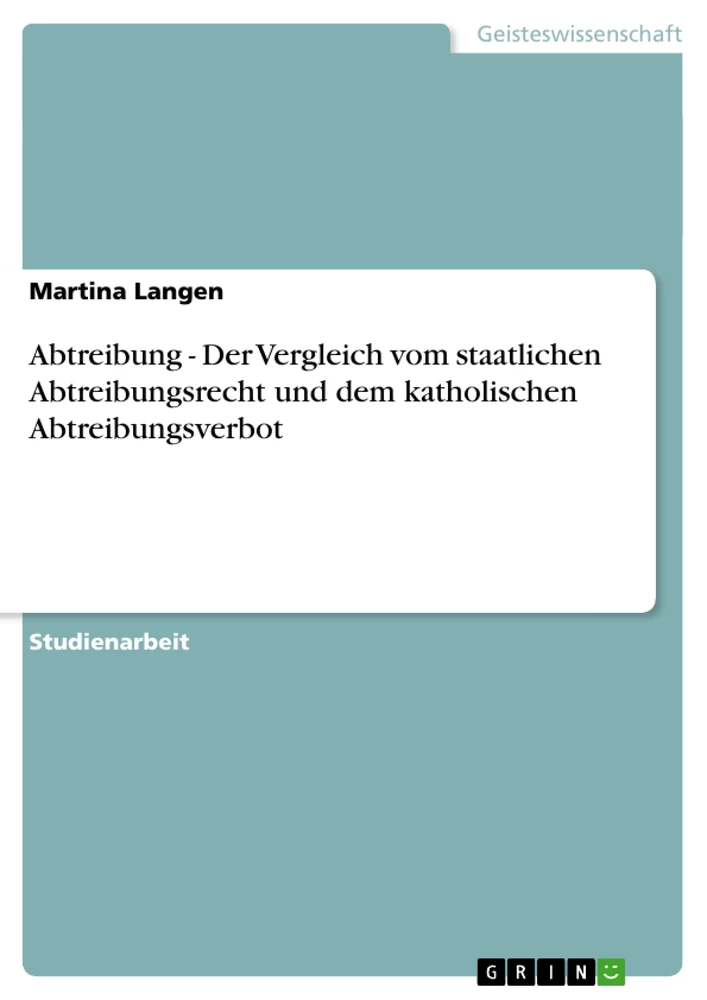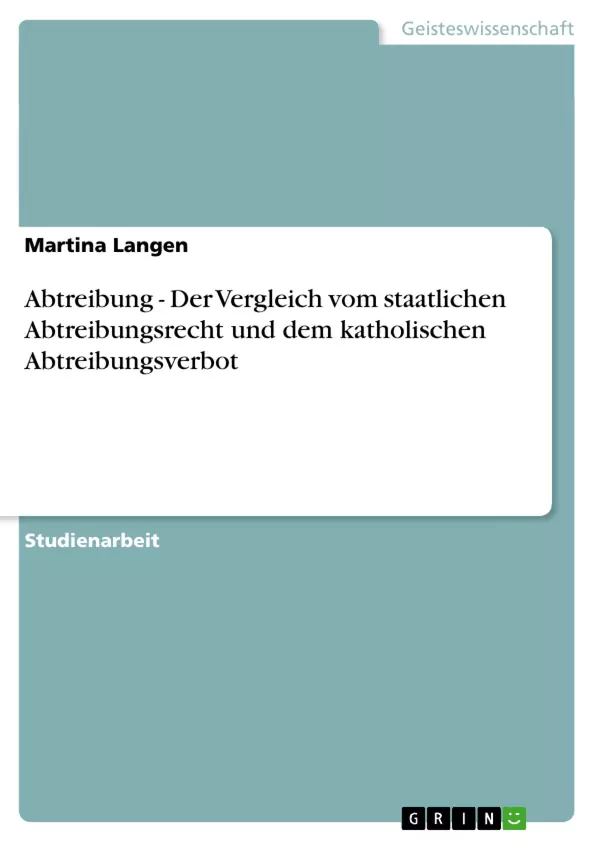Die ungewollte Schwangerschaft, die Familienplanung und die Beschränkung von
Fruchtbarkeit und Geburten stellen für nahezu alle Kulturen und Epochen ein
Problem dar.1 Die Frage um die es sich hier zumeist dreht ist, ob bzw. wann der
Embryo ein eigenes Lebensrecht besitzt, und wie sich dies auf die
Entscheidungsfreiheit der Schwangeren auswirkt. Abtreibung - der Abbruch einer
bereits bestehenden Schwangerschaft - sowie empfängnisverhütende Mittel und
Methoden, die das Entstehen einer Schwangerschaft verhindern sollen, sind laut
Metzers Lexikon der Religion Antwortversuche auf dieses Menschheitsproblem.
Schon seit den 70er Jahren kämpfen Massenbewegungen, aus vielfältigen
politischen zusammengesetzten Gruppierungen, für die Abschaffung der
strafrechtlichen Reglementierung der Abtreibung. Das strafbewehrte Verbot der
Abtreibung wird als konkretes Hindernis der Lebensplanung empfunden und zugleich
aber auch das umfassende Symbol der Herrschaft von Kirche und Staat über die
Sexualität des Einzelnen. Zwar sind sich die Kirche und der Staat einig darüber alles
zu tun, um Schwangerschaftsabbrüche zu vermeiden, in der Frage des Wie aber
gehen die Meinungen stark auseinander.
Im nachfolgendem Teil meiner Facharbeit beschäftige ich mich vorerst mit der Frage
wann und wie entsteht die menschliche Person. Diese Frage ist eine wesentliche
Vorraussetzung um die Abtreibungsdiskussion sachgerecht darstellen zu können.
Die Rechtfertigung eines Schwangerschaftsabbruches soll Situationen widerspiegeln
wie zum Beispiel die Kindestötung nach einer Vergewaltigung oder Töten um sich
selbst zu retten. Hierauf folgend einen Überblick über die Folgen einer Abtreibung.
Im zweiten Teil meiner Facharbeit beschäftige ich mich mit dem Vergleich des
kirchlichen Abtreibungsverbots und dem staatlichen Abtreibungsrecht in der
Geschichte. Diese Gegenüberstellung soll zeigen, in welchem Konflikt sich die
Frauen durch die Kontrolle ungewollter Schwangerschaften befinden und welche
Positionen die jeweiligen Institutionen einnehmen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Schwangerschaftsabbruch
- die vorgeburtliche Entwicklung des Kindes
- Rechtfertigungen eines Schwangerschaftsabbruches
- Folgen des Schwangerschaftsabbruches
- Der Vergleich vom staatlichen Abtreibungsrecht und dem katholischen Abtreibungsverbot
- Staatliche Abtreibungsrechte
- Entstehung des §218 StGB
- Der § 218 StGB Schwangerschaftsabbruch
- Kirchliche Abtreibungsverbote
- Zur Geschichte des katholischen Abtreibungsverbots
- Codex luris Canonici
- Der Katechismus der katholischen Kirche
- Der Vergleich
- Staatliche Abtreibungsrechte
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Facharbeit befasst sich mit dem Vergleich des staatlichen Abtreibungsrechts und dem katholischen Abtreibungsverbot. Ziel ist es, die unterschiedlichen Positionen von Staat und Kirche in Bezug auf die Frage des Schwangerschaftsabbruchs zu beleuchten und die daraus resultierenden Konflikte für Frauen aufzuzeigen.
- Die vorgeburtliche Entwicklung des Kindes und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens
- Rechtfertigungen für einen Schwangerschaftsabbruch, insbesondere in Bezug auf die Lebensgefährdung der Mutter und die mögliche Behinderung des Kindes
- Die Geschichte des katholischen Abtreibungsverbots und die Entwicklung des staatlichen Abtreibungsrechts in Deutschland
- Der Vergleich der Positionen von Staat und Kirche in Bezug auf die Abtreibungsfrage
- Die Auswirkungen der unterschiedlichen Positionen auf die Entscheidungsfreiheit von Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Schwangerschaftsabbruchs ein und stellt die Problematik der ungewollten Schwangerschaft und der Familienplanung dar. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Positionen von Staat und Kirche in Bezug auf die Abtreibungsfrage und die daraus resultierenden Konflikte für Frauen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Schwangerschaftsabbruch und seinen verschiedenen Aspekten. Es beleuchtet die vorgeburtliche Entwicklung des Kindes und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens. Außerdem werden Rechtfertigungen für einen Schwangerschaftsabbruch, wie zum Beispiel die Lebensgefährdung der Mutter oder die mögliche Behinderung des Kindes, diskutiert. Abschließend werden die Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs betrachtet.
Das dritte Kapitel vergleicht das staatliche Abtreibungsrecht mit dem katholischen Abtreibungsverbot. Es beleuchtet die Entstehung des §218 StGB und die Entwicklung des staatlichen Abtreibungsrechts in Deutschland. Außerdem wird die Geschichte des katholischen Abtreibungsverbots und die Position der katholischen Kirche in Bezug auf die Abtreibungsfrage dargestellt. Abschließend werden die unterschiedlichen Positionen von Staat und Kirche in Bezug auf die Abtreibungsfrage verglichen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Schwangerschaftsabbruch, das staatliche Abtreibungsrecht, das katholische Abtreibungsverbot, die vorgeburtliche Entwicklung des Kindes, die Rechtfertigung eines Schwangerschaftsabbruches, die Folgen des Schwangerschaftsabbruches, die Geschichte des katholischen Abtreibungsverbots, die Entwicklung des staatlichen Abtreibungsrechts in Deutschland, der Vergleich der Positionen von Staat und Kirche in Bezug auf die Abtreibungsfrage und die Auswirkungen der unterschiedlichen Positionen auf die Entscheidungsfreiheit von Frauen.
- Citation du texte
- Martina Langen (Auteur), 2006, Abtreibung - Der Vergleich vom staatlichen Abtreibungsrecht und dem katholischen Abtreibungsverbot, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115069