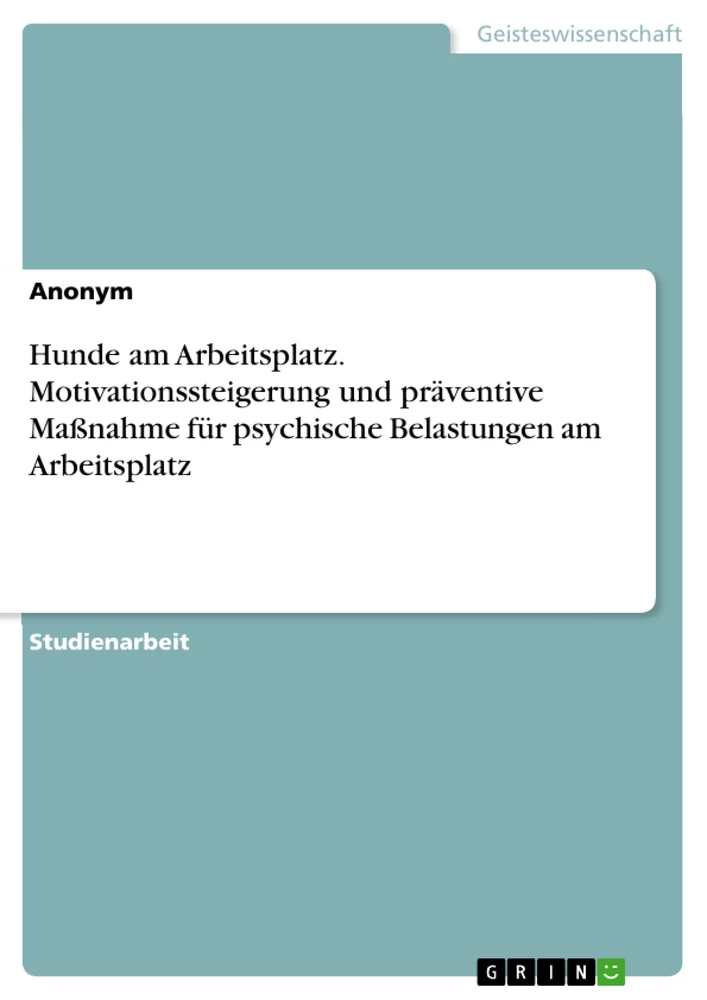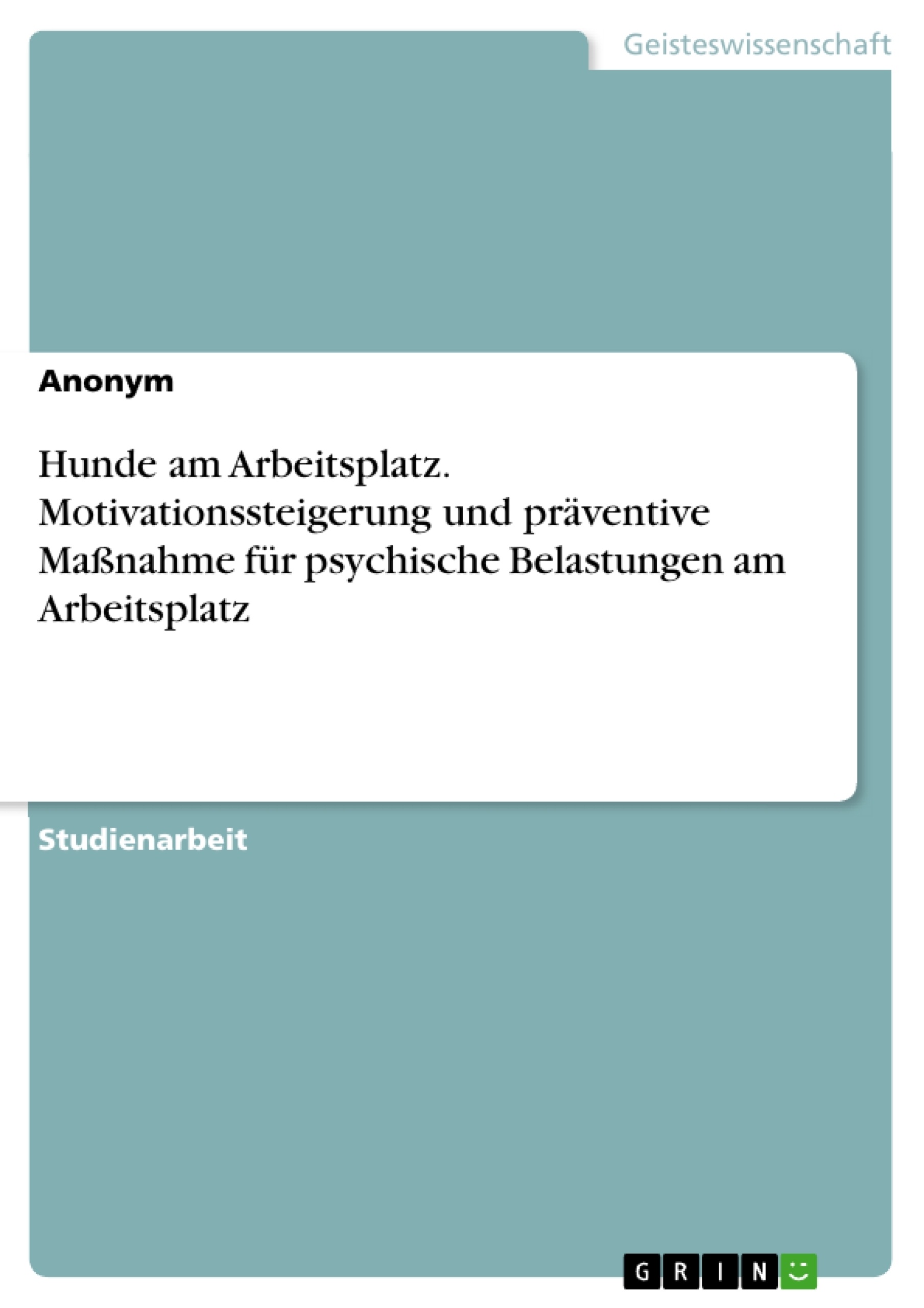Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, ob und wie Hunde einen positiven Effekt auf die Mitarbeiter haben, vor allem auf deren Gesundheit und Motivation und ob darüber hinaus weitere positive Auswirkungen auch auf die Arbeitgeber möglich sind.
Dafür ist es notwendig, Stress und psychische Belastung näher zu betrachten, wie diese entstehen und welche Auswirkungen sie haben. Ebenso soll Motivation definiert werden und wie Motivation entsteht. Zudem wird beleuchtet, welche negativen Folgen das Mitbringen von Hunden an den Arbeitsplatz haben kann. Speziell wird auf die Aspekte „Tierhaarallergie“ und „Kynophobie“ eingegangen und ob diese tatsächlich solch eine Relevanz entfalten, dass mehr gegen als für Hunde am Arbeitsplatz spricht. Ebenso wird auf mögliche Folgen für den Hund selbst im Kontext mit einer artgerechten Haltung eingegangen. Zuletzt werden alle nötigen Voraussetzungen für das Mitbringen des „Besten Freundes“ erörtert und ob sich diese in der öffentlichen Verwaltung, insbesondere in den Finanzämtern erfüllen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Status quo
- Zielsetzung - „Dog-In statt Burn-Out”?
- Die Hund-Mensch-Beziehung
- Population und Geschichte des „Besten Freundes”
- Die Hund-Mensch-Interaktion
- Physische und psychische Auswirkungen
- Effekte auf Motivation und andere Vorteile
- Negative Konsequenzen
- Voraussetzungen für Hunde am Arbeitsplatz
- Rechtliche Bedingungen
- Kriterien bezüglich des Arbeitsplatzes
- Geeignetheit des Hundes
- Übertragung auf die Finanzverwaltung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Einsatz von Hunden am Arbeitsplatz und analysiert dessen potenzielles Potenzial zur Steigerung der Mitarbeitermotivation und zur präventiven Eindämmung psychischer Belastungen. Die Arbeit untersucht die Hund-Mensch-Beziehung, analysiert die Auswirkungen von Hunden auf das Arbeitsumfeld und erörtert rechtliche und praktische Aspekte der Integration von Hunden am Arbeitsplatz.
- Die Hund-Mensch-Beziehung und deren Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit
- Die Rolle von Hunden in der Arbeitswelt und deren Einfluss auf die Motivation und das Arbeitsklima
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen und praktischen Voraussetzungen für Hunde am Arbeitsplatz
- Die Übertragbarkeit des Konzepts auf die Finanzverwaltung
- Eine kritische Analyse der Chancen und Risiken von Hunden am Arbeitsplatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der zunehmenden psychischen Belastung am Arbeitsplatz dar, insbesondere im öffentlichen Dienst. Die Arbeit stellt die Frage, ob Hunde als Mittel zur Steigerung der Motivation und zur präventiven Gesundheitsförderung eingesetzt werden können.
Kapitel 2 beleuchtet die Hund-Mensch-Beziehung in ihrer historischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Es werden die Auswirkungen der Interaktion von Mensch und Hund auf die physische und psychische Gesundheit sowie deren potenziellen Einfluss auf Motivation und Arbeitsklima analysiert.
Kapitel 3 befasst sich mit den Voraussetzungen für Hunde am Arbeitsplatz. Es werden rechtliche Bedingungen, Kriterien bezüglich des Arbeitsplatzes, die Geeignetheit des Hundes und die Übertragung auf die Finanzverwaltung diskutiert.
Schlüsselwörter
Hunde am Arbeitsplatz, Motivationssteigerung, psychische Belastung, Arbeitsklima, Hund-Mensch-Beziehung, rechtliche Rahmenbedingungen, Finanzverwaltung, Gesundheitsförderung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorteile bieten Hunde am Arbeitsplatz?
Hunde können die Mitarbeitermotivation steigern, das Arbeitsklima verbessern und als präventive Maßnahme gegen psychische Belastungen wie Stress und Burn-out wirken.
Welche negativen Folgen können Hunde im Büro haben?
Mögliche Probleme sind Tierhaarallergien bei Kollegen, Kynophobie (Angst vor Hunden) sowie potenzielle Ablenkungen oder Konflikte bei nicht artgerechter Haltung.
Welche rechtlichen Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Es müssen arbeitsrechtliche Bedingungen geklärt werden, wie die Zustimmung des Arbeitgebers und der Kollegen sowie Versicherungsfragen und Hygienevorschriften.
Ist das Konzept "Hunde im Büro" für die Finanzverwaltung geeignet?
Die Arbeit untersucht speziell die Übertragbarkeit auf öffentliche Verwaltungen wie Finanzämter und prüft, ob sich die nötigen Voraussetzungen dort erfüllen lassen.
Welche Kriterien muss ein Hund erfüllen, um bürotauglich zu sein?
Der Hund muss gut sozialisiert sein, ein ruhiges Wesen haben und die Grundkommandos beherrschen, um den Arbeitsablauf nicht zu stören.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Hunde am Arbeitsplatz. Motivationssteigerung und präventive Maßnahme für psychische Belastungen am Arbeitsplatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1150716