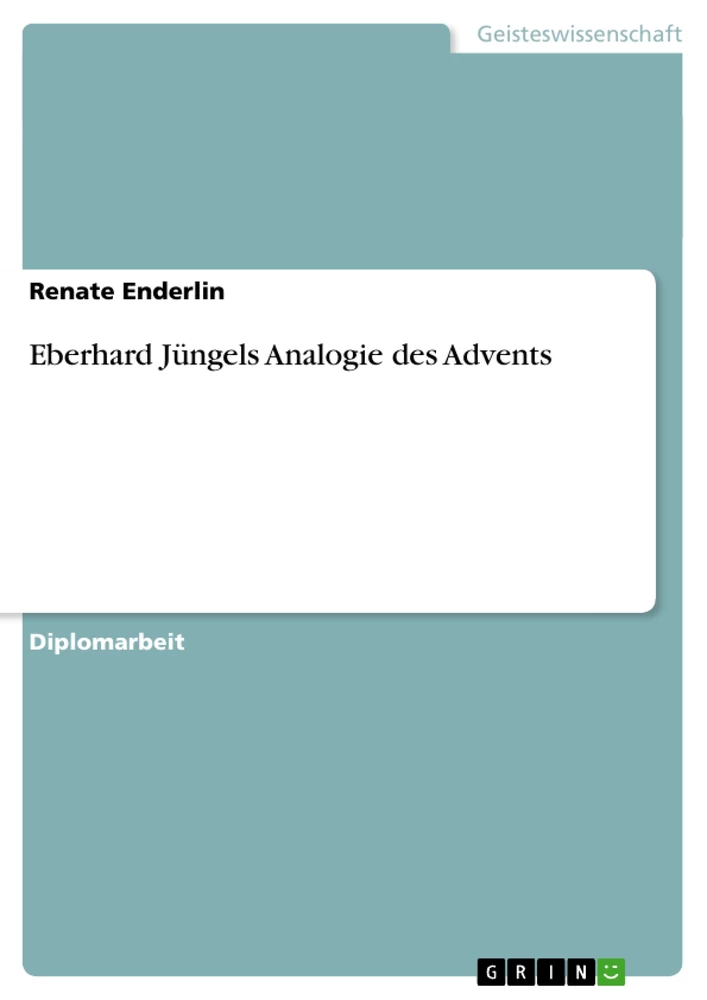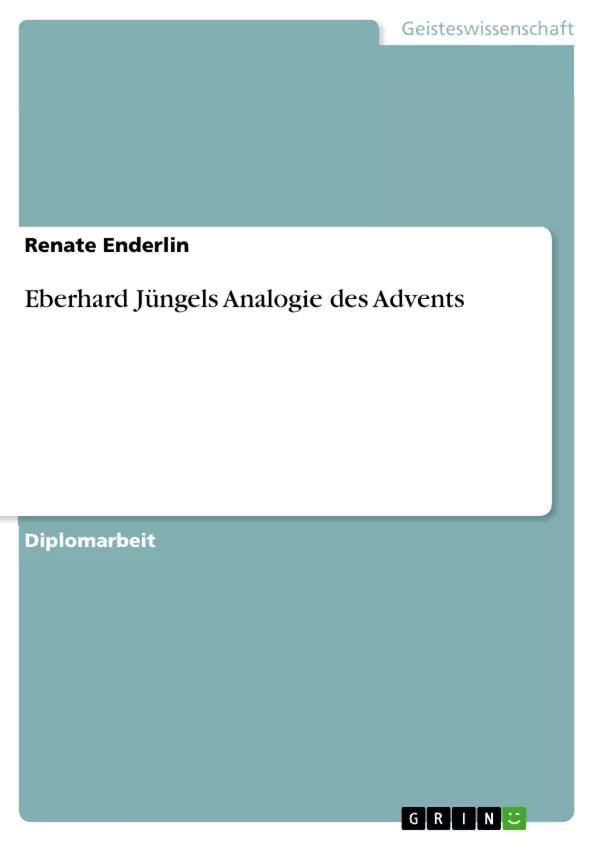Eberhard Jüngels Analogie des Advents soll in dieser Arbeit als jenes Beziehungsgeschehen erinnert werden, in dem die eschatologische Nähe Gottes als Zukunft anbricht –in dem Gott als Ereignis der Welt dem Menschen nahe kommt. Mit Jüngel und seinem Werk Gott als Geheimnis der Welt führt die Arbeit durch die Konstruktionen und das Zerbrechen der Gottesgedanken hin zu der dem theologischen Denken zugemuteten Prämisse der Offenbarung Gottes – die keinen Gottesgedanken konstruiert, sondern die Denkbarkeit Gottes
in der Analogie des Advents rekonstruiert. Um den Advent Gottes als theologische Prämisse in seiner Notwendigkeit für die Denkbarkeit des Gott-Denkens herauszuarbeiten und im Nachdenken in diese Prämisse der sich voraussetzenden Offenbarung Gottes hineinzufinden, wird im ersten Teil der Gottesbegriff bei Descartes und Kant erläutert, der sich als erkenntnistheoretisch oder moralisch denknotwendiger und damit vom Menschen vorgestellter Gottesgedanke aufzulösen beginnt. Die Konsequenz der Undenkbarkeit eines vom Menschen vorgestellten Gottesgedankens, die Negation des Gottesgedankens, zeigt sich in unterschiedlicher Weise bei Fichte, Feuerbach und Nietzsche und führt zu der Frage, wie und wo Gott wieder denkbar wird. Das Wort wird als Ort der Denkbarkeit erkannt, weil nur im Wort Gott selber, d.h. Gottes Offenbarwerden in der Geschichte und damit die Einheit zwischen Wesen und Existenz Gottes zur Sprache kommt. Im Wort ereignet sich die Beziehung Gottes zur Welt. In diesem relationalen Geschehen, in diesem Sprachereignis wird der Advent Gottes angebrochen sein, wenn sich der Mensch von diesem ansprechen und unterbrechen lässt.
Die Erinnerung dieses Ereignisses ist sprachlich, d.h. relational möglich, weil das Ereignis selbst zuvor sprachlich, d.h. relational geschehen ist. Das Sprachereignis vollzieht jene Entsprechung zwischen Gott und Menschen,
die in der je größeren Differenz zwischen Gott und Menschen die je größere Nähe Gottes zum Menschen zum Ausdruck bringt. Diese Entsprechung zwischen Denken und Zu-Denkendem definiert nicht die Relata, definiert nicht Gott und Mensch, sondern geschieht definitiv in der Relation. Diese gewährt Entsprechung im Widerspruch. Das Evangelium ist als Zeugnis
dieses Ereignisses der Entsprechung das Zeugnis von der Menschwerdung Gottes.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Wege und Sackgassen im Denken
- 1.1 Si comprehendis, non est Deus
- 1.2 Gottes Advent als theologische Prämisse
- 1.2.1 Mehr als notwendig
- 1.3 Der Gottesgedanke als Denknotwendigkeit
- 1.3.1 Descartes' Zweifel
- 1.3.2 Kants Postulat
- 1.4 Negation des Gottesgedankens als Denknotwendigkeit
- 1.4.1 Fichtes Denkverbot
- 1.4.2 Feuerbachs Denkgebot
- 1.4.3 Nietzsches Mutmaßung
- 1.5 Jüngels zumutbare Zumutung
- 1.6 Ort der Denkbarkeit - das Wort
- 1.6.1 Hermeneutische Vorentscheidungen
- 1.6.2 Gegenständlich-Sein Gottes im Wort
- 1.6.3 Das Wort als Ereignis – Hier im Jetzt
- 1.6.4 Sprachphilosophische Bemerkungen
- 2. Wege und Sackgassen in der Sprache
- 2.1 Offenbarung als Problem und Prämisse
- 2.2 Theologische Analogiemodelle
- 2.2.1 Beredtes Schweigen bei Dionysius Areopagita
- 2.2.2 Das Analogieverständnis bei Thomas von Aquin
- 2.2.3 Erkenntnistheoretische Bemerkungen
- 2.2.4 Der Streit um die Analogie bei Barth und Przywara
- 2.2.5 Kritik an Jüngels Kritik
- 2.3 Jüngels Analogieverständnis
- 2.3.1 Das Phänomen der Analogie bei Parmenides
- 2.3.2 Das Phänomen der Analogie bei Heraklit
- 2.3.3 Die Analogie des Advents bei Jüngel
- 2.4 Mit Jüngel zum Advent der Analogie
- 2.5 Zwei Umwege
- 3. Wegweiser zu neuen Fragen
- 4. Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit Eberhard Jüngels Analogie des Advents und untersucht, wie sich Gottes Sein im Denken und in der Sprache erfassen lässt. Die Arbeit analysiert Jüngels Kritik an traditionellen Analogiemodellen und stellt seine eigene Konzeption der Analogie des Advents dar.
- Die Frage nach der Denkbarkeit und Sprechbarkeit Gottes
- Die Kritik an traditionellen Analogiemodellen
- Jüngels Analogie des Advents als Antwort auf die Frage nach Gottes Offenbarung
- Die Rolle des Wortes und der Sprache in der Theologie
- Die Bedeutung des Ereignisses in der christlichen Theologie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Frage nach der Denkbarkeit Gottes ergeben. Es analysiert verschiedene Denkansätze, die sich mit der Frage nach dem Gottesgedanken auseinandersetzen, von Descartes' Zweifel bis hin zu Nietzsches Mutmaßung. Jüngels Ansatz wird als eine "zumutbare Zumutung" vorgestellt, die den Ort der Denkbarkeit im Wort sieht.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Problem der Sprache in der Theologie. Es untersucht verschiedene theologische Analogiemodelle, von Dionysius Areopagita bis hin zu Thomas von Aquin, und analysiert den Streit um die Analogie bei Barth und Przywara. Jüngels Kritik an diesen Modellen wird beleuchtet und seine eigene Konzeption der Analogie des Advents vorgestellt.
Das dritte Kapitel bietet einen Ausblick auf neue Fragen, die sich aus Jüngels Analogie des Advents ergeben. Es zeigt, wie Jüngels Ansatz neue Perspektiven für die Theologie eröffnet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Eberhard Jüngel, Analogie des Advents, Gottes Offenbarung, Denkbarkeit Gottes, Sprache in der Theologie, Hermeneutik, Ereignis, Wort Gottes, Kritik an traditionellen Analogiemodellen, theologische Sprache, christliche Theologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Eberhard Jüngels 'Analogie des Advents'?
Jüngel beschreibt Gott als ein Ereignis, das im Wort auf den Menschen zukommt (Advent) und eine Beziehung stiftet, die Gott denkbar und sagbar macht.
Wie kritisiert Jüngel den Gottesbegriff von Descartes und Kant?
Er sieht in ihnen Konstruktionen einer Denknotwendigkeit, die Gott auf eine Funktion für das menschliche Denken oder die Moral reduzieren, anstatt ihn als Offenbarung zu begreifen.
Warum ist das 'Wort' so wichtig für Jüngels Theologie?
Das Wort ist der Ort, an dem Gott sich selbst mitteilt. Nur im Sprachereignis wird die Einheit von Gottes Wesen und Existenz für den Menschen erfahrbar.
Was unterscheidet Jüngels Analogie von der klassischen 'analogia entis'?
Während die klassische Analogie auf einer Seinsähnlichkeit beruht, fokussiert Jüngel auf die Entsprechung im Sprachereignis der Offenbarung Gottes.
Welche Rolle spielt Nietzsche in der Argumentation der Arbeit?
Nietzsches Negation des Gottesgedankens wird als Konsequenz der Sackgassen des modernen Denkens dargestellt, die zu Jüngels Neubesinnung auf das Wort führt.
- Quote paper
- Renate Enderlin (Author), 2008, Eberhard Jüngels Analogie des Advents, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115145