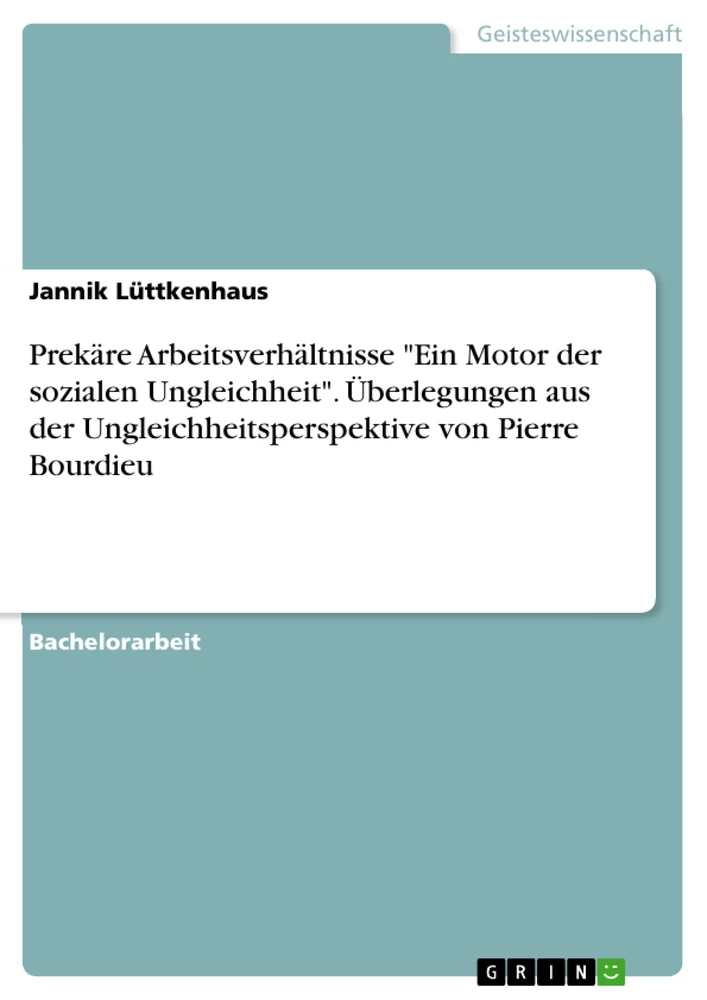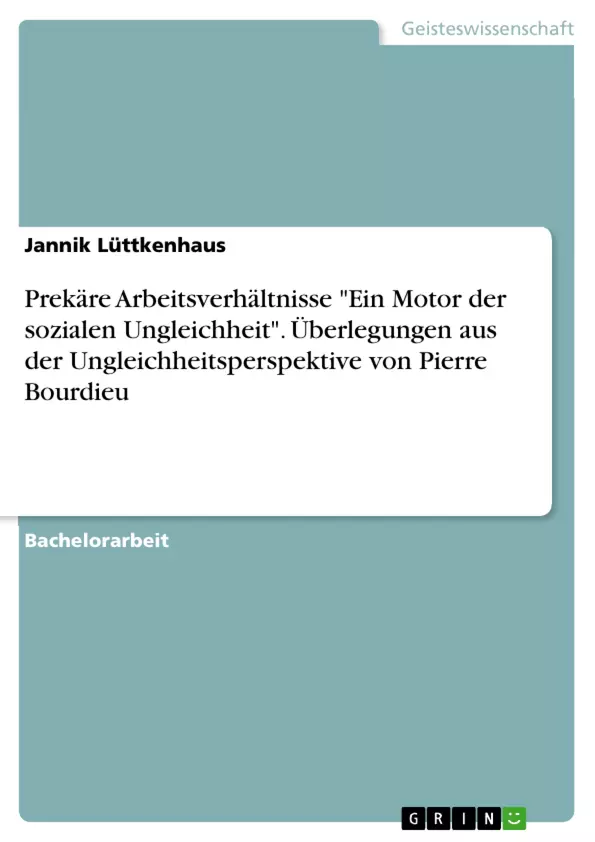Die folgende Bachelorarbeit setzt sich mit der Fragestellung auseinander, ob und wie prekäre Arbeitsverhältnisse die soziale Ungleichheit beeinflussen. In der vorliegenden Arbeit wird erläutert, inwieweit unterschiedliche empirische und theoretische Zusammenhänge zwischen der Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen und der Entwicklung sozialer Ungleichheit in Deutschland aufgezeigt werden können. Es wird der These nach gegangen, ob „prekäre Arbeitsverhältnisse ein Motor der sozialen Ungleichheit“ sein können. Hierzu wird die Ungleichheitsperspektive von Pierre Bourdieu mit einbezogen. Ziel der Arbeit ist es, mit Hilfe der Ungleichheitsperspektive von Bourdieu festzustellen, ob und wie prekäre Beschäftigungsverhältnisse ein signifikanter Faktor für die soziale Ungleichheit in Deutschland sein können. Diese Arbeit wird sich dabei auf den Raum Deutschland begrenzen. Hintergrund sind die unterschiedlichen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Konstellationen in anderen Ländern, die berücksichtigt werden müssten. Die Auswertung weiterer Länder würde den Umfang dieser Arbeit übersteigen, oder keine detaillierte Analyse zulassen. Es ist außerdem zu beachten, dass sich diese Arbeit auf die Ungleichheitsperspektive von Pierre Bourdieu fokussiert.
Der Aufbau der Bachelorarbeit ist in mehrere Teilbereiche gegliedert. Nach der Einleitung folgt eine Erläuterung zu den Begrifflichkeiten. Hier werden kurz die Beschäftigungsverhältnisse vorgestellt und die Unterschiede zwischen diesen Verhältnissen erläutert und definiert. Danach folgt eine Darstellung der aktuellen Lage der prekären Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland. Es wird der Frage nach gegangen, inwieweit diese Beschäftigungen bestimmte Auswirkungen und Folgen für Individuen haben, die in diesen Verhältnissen leben. Anschließend folgt die Vorstellung von Bourdieus Ungleichheitstheorieansatz und eine Analyse der prekären Verhältnisse mithilfe Bourdieu. Nachdem die Theorie erläutert wird, erfolgen mit Hilfe dieser Theorie einige Impulse. Am Ende wird das Resümee der wissenschaftlichen Arbeit erläutert. Abschließend folgen die Quellen und das Literaturverzeichnis.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Flexible Arbeitsverhältnisse
- 2.1 Erwerbstätigkeit
- 2.2 Das Normalarbeitsverhältnis
- 2.3 Atypische Beschäftigungen
- 3. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse
- 3.1 Definition
- 3.2 Agenda 2010
- 3.3 Empirische Bestandsaufnahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse
- 3.4 Risikogruppen
- 3.5 Lebenslagen von prekären Beschäftigten
- 3.6 Konsequenzen aus prekärer Beschäftigung
- 3.7 Zusammenfassung
- 4. Bourdieus Ungleichheitstheorie
- 4.1 Soziale Ungleichheit - eine kurze Einführung
- 4.2 Die Habitus Theorie
- 4.3 Sozialer Raum
- 4.4 Bourdieus Kapitalformen
- 4.5 Klassen
- 5. Impulse aus den bourdieuschen Ansatz
- 5.1 Apell zum politischen Handeln
- 5.2 Lösungsvorschläge
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht, ob und wie prekäre Arbeitsverhältnisse die soziale Ungleichheit beeinflussen. Sie analysiert die Zusammenhänge zwischen der Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen und der Entwicklung sozialer Ungleichheit in Deutschland. Die Arbeit verfolgt die These, dass „prekäre Arbeitsverhältnisse ein Motor der sozialen Ungleichheit“ sein können und untersucht dies anhand der Ungleichheitsperspektive von Pierre Bourdieu. Ziel ist es, mithilfe von Bourdieus Ansatz festzustellen, ob und wie prekäre Beschäftigungsverhältnisse ein signifikanter Faktor für die soziale Ungleichheit in Deutschland sind.
- Prekäre Arbeitsverhältnisse als Motor der sozialen Ungleichheit
- Zusammenhang zwischen Prekarisierung und sozialer Ungleichheit
- Analyse der prekären Verhältnisse mithilfe von Bourdieus Ungleichheitsperspektive
- Bedeutung der Kapitalformen und des Habitus für die soziale Ungleichheit
- Impulse für politisches Handeln zur Bekämpfung von Prekarisierung und sozialer Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Thematik im Kontext der heutigen Arbeitswelt herausstellt und den Forschungsrahmen der Arbeit absteckt. Kapitel 2 erläutert die verschiedenen Arten von Beschäftigungsverhältnissen, insbesondere die Unterscheidung zwischen dem klassischen Normalarbeitsverhältnis und flexiblen Arbeitsformen. Kapitel 3 beschäftigt sich mit prekären Beschäftigungsverhältnissen. Es definiert diesen Begriff, beleuchtet die Hintergründe im Zusammenhang mit der Agenda 2010, analysiert empirische Daten zur Verbreitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland und zeigt die Folgen dieser Arbeitsverhältnisse für die Lebenslagen der Betroffenen auf.
Kapitel 4 präsentiert Bourdieus Ungleichheitstheorie, wobei die zentralen Konzepte wie Habitus, sozialer Raum und Kapitalformen im Detail erklärt werden. Im Anschluss erfolgt eine Analyse der prekären Verhältnisse unter Verwendung der Bourdieuschen Theorie. Kapitel 5 leitet aus den gewonnenen Erkenntnissen Impulse für politisches Handeln ab und bietet Lösungsansätze zur Bekämpfung von Prekarisierung und sozialer Ungleichheit.
Schlüsselwörter
Prekäre Arbeitsverhältnisse, soziale Ungleichheit, Pierre Bourdieu, Habitus, sozialer Raum, Kapitalformen, Agenda 2010, flexible Arbeitsverhältnisse, Normalarbeitsverhältnis, atypische Beschäftigung, Risikogruppen, Lebenslagen, Konsequenzen, politische Handlung, Lösungsvorschläge.
Häufig gestellte Fragen
Sind prekäre Arbeitsverhältnisse ein Motor der sozialen Ungleichheit?
Diese Bachelorarbeit geht genau dieser These nach und untersucht, wie die Prekarisierung von Jobs die soziale Schere in Deutschland weiter öffnet.
Welche Rolle spielt Pierre Bourdieu in dieser Analyse?
Seine Theorien zu Kapitalformen (ökonomisch, kulturell, sozial) und dem Habitus dienen als Werkzeug, um die tieferen Ursachen der Ungleichheit zu verstehen.
Was ist der Unterschied zwischen Normalarbeitsverhältnis und atypischer Beschäftigung?
Das Normalarbeitsverhältnis ist unbefristet und voll sozialversichert, während atypische Jobs (wie Leiharbeit oder Minijobs) oft unsicher und schlechter bezahlt sind.
Welchen Einfluss hatte die Agenda 2010 auf prekäre Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Agenda 2010 als einen politischen Hintergrund, der zur Ausweitung flexibler und oft prekärer Beschäftigungsformen in Deutschland beigetragen hat.
Was sind die Konsequenzen für Menschen in prekären Lebenslagen?
Die Betroffenen leiden oft unter mangelnder Planungssicherheit, geringerem sozialen Status und einem erschwerten Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe.
- Quote paper
- Jannik Lüttkenhaus (Author), 2021, Prekäre Arbeitsverhältnisse "Ein Motor der sozialen Ungleichheit". Überlegungen aus der Ungleichheitsperspektive von Pierre Bourdieu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1151520