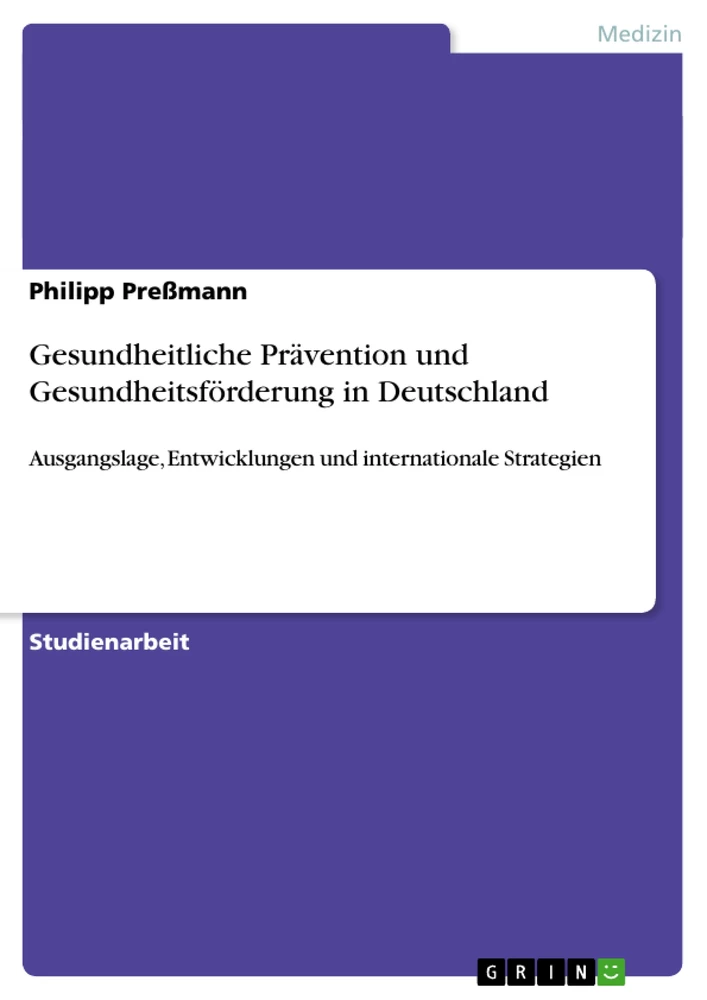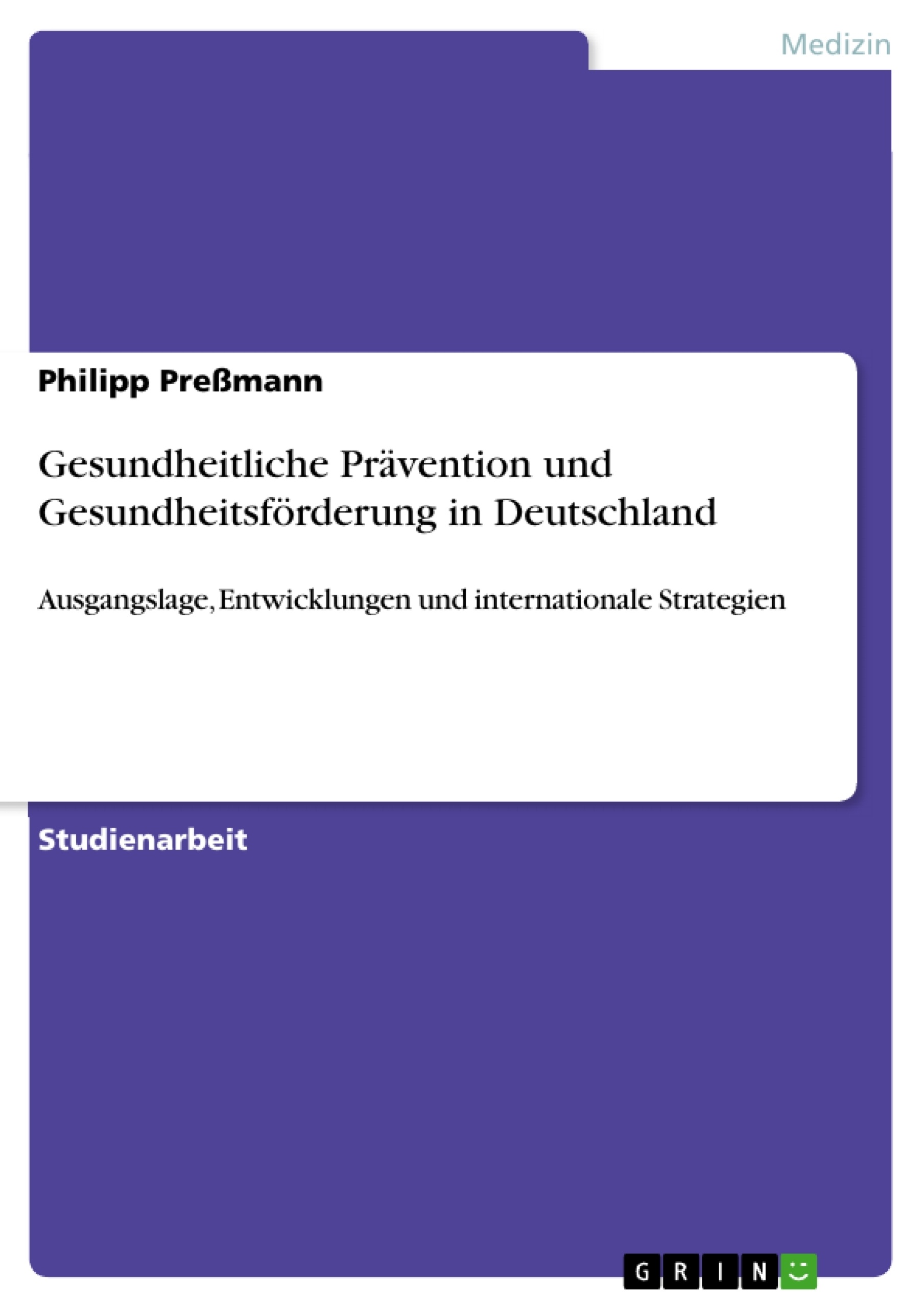Gesundheitliche bzw. nichtmedizinische Prävention soll neben den bereits vorhandenen und etablierten Säulen Kuration, Rehabilitation und Pflege als eigenständige vierte Säule im Gesundheitswesen aufgebaut und etabliert werden. Soweit der Stand in den politischen Lagern und den Lagern aller beteiligter Akteure inklusive der Wissenschaft. Dieser aktuelle Stand der Dinge drückt aber auch den Ist-Zustand von vor knapp 10 Jahren aus. In der Debatte um ein Präventionsgesetz gilt es viele Stolpersteine zu umgehen – bislang zumeist mit dem Ausgang, dass der Weg zu bundeseinheitlichen Regelungen letztendlich doch wieder versperrt bleibt, da die Interessen der vorgenannten Akteure doch zu weit auseinanderklaffen und ein Spagat unmöglich erscheint.
Vorliegende Arbeit beschäftigt sich nach dem Zusammentragen des Status Quo mit Hilfe der Vergangenheit und den Rahmenbedingungen für Prävention in Deutschland (Kapitel 2), mit besonderem Schwerpunkt dem Präventionsgesetz und den Entwürfen, die in der Diskussion stehen und standen (Kapitel 3). Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Darstellung der Präventionsdebatte zu skizzieren. In Kapitel 4 wird der Versuch unternommen, im Stile eines Benchmarkingvergleiches
aus internationalen Gesundheitssystemen, Vorgehensweisen zu landeseinheitlichen
Präventionsregelungen zu identifizieren, um deren Übertragbarkeit zu prüfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Ausgangslage: Gesundheitliche Prävention in Deutschland
- 2.1 Zur Begriffsklärung
- 2.2 Entwicklung und Organisation der Prävention in Deutschland
- 2.3 Finanzierung der Prävention
- 2.4 Prävention durch Krankenkassen
- 3 Das Präventionsgesetz – Ein gescheitertes Unterfangen?
- 3.1 Die Historie – Ein kurzer Aufriss der Präventionsdebatte
- 3.2 Die Entwürfe und Kernpunkte
- 3.3 Kritik und Diskussion
- 4 Prävention und Gesundheitsförderung im internationalen Vergleich
- 5 Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Debatte um die Etablierung gesundheitlicher Prävention als eigenständige Säule im deutschen Gesundheitssystem. Sie beleuchtet den Status quo der Prävention in Deutschland, analysiert das gescheiterte Präventionsgesetz und vergleicht internationale Strategien im Bereich der Gesundheitsförderung.
- Der aktuelle Stand der Präventionsdebatte in Deutschland
- Analyse des Präventionsgesetzes und der damit verbundenen Herausforderungen
- Begriffsklärung und unterschiedliche Verständnisweisen von Prävention
- Internationaler Vergleich von Präventionsstrategien
- Entwicklung und Organisation der Prävention in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung skizziert die Zielsetzung der Arbeit, nämlich die Darstellung der Präventionsdebatte in Deutschland. Sie beschreibt den angestrebten Aufbau gesundheitlicher Prävention als vierte Säule im Gesundheitssystem und die Schwierigkeiten bei der Umsetzung bundeseinheitlicher Regelungen aufgrund divergierender Interessen verschiedener Akteure. Die Arbeit fokussiert auf den Status quo der Prävention in Deutschland (Kapitel 2), die Diskussion um das Präventionsgesetz (Kapitel 3) und einen internationalen Vergleich (Kapitel 4).
2 Ausgangslage: Gesundheitliche Prävention in Deutschland: Dieses Kapitel untersucht den Status quo der gesundheitlichen Prävention in Deutschland. Es beginnt mit einer Begriffsklärung von Prävention, differenziert zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention und beleuchtet den Unterschied zwischen Prävention und Gesundheitsförderung. Es analysiert die Entwicklung und Organisation der Prävention in Deutschland, beginnend mit der Bismarck'schen Sozialgesetzgebung und der Entwicklung vom paternalistischen Ansatz hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung. Der Wandel des Krankheitsspektrums hin zu chronisch-degenerativen Erkrankungen und der demografische Wandel werden als wichtige Einflussfaktoren hervorgehoben. Das Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Verständnisweisen von Prävention bei verschiedenen Akteuren und die Herausforderungen bei der Formulierung einer gemeinsamen Grundlage für ein Präventionsgesetz.
3 Das Präventionsgesetz – Ein gescheitertes Unterfangen?: Dieses Kapitel analysiert die Debatte um ein Präventionsgesetz in Deutschland. Es beleuchtet die historische Entwicklung der Präventionsdebatte, die Kernpunkte der verschiedenen Gesetzesentwürfe und die Kritik an diesen Entwürfen. Es wird deutlich, dass die unterschiedlichen Interessen der beteiligten Akteure zu großen Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines bundeseinheitlichen Gesetzes geführt haben. Der Fokus liegt auf den zentralen Konfliktlinien und den Gründen für das Scheitern des bisherigen Vorhabens, ein umfassendes und effektives Präventionsgesetz zu etablieren. Die Kapitel befasst sich mit den politischen und gesellschaftlichen Hürden und den verschiedenen Perspektiven, die zu der bisherigen Blockade beigetragen haben.
4 Prävention und Gesundheitsförderung im internationalen Vergleich: Dieses Kapitel setzt sich mit internationalen Strategien und Vorgehensweisen im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung auseinander. Es analysiert verschiedene Gesundheitssysteme im internationalen Vergleich, um erfolgreiche Ansätze zur landesweiten Implementierung von Präventionsmaßnahmen zu identifizieren und deren Übertragbarkeit auf das deutsche System zu untersuchen. Der Vergleich dient dazu, Lösungsansätze und Best-Practice-Beispiele zu finden, die zur Überwindung der in Kapitel 3 identifizierten Hürden beitragen können. Es wird ein "Benchmarking"-Verfahren angewendet, um die verschiedenen nationalen Strategien zu vergleichen und potenzielle Transfermöglichkeiten zu evaluieren.
Schlüsselwörter
Gesundheitliche Prävention, Gesundheitsförderung, Präventionsgesetz, Deutschland, Internationaler Vergleich, Primärprävention, Sekundärprävention, Tertiärprävention, Risikofaktoren, Ressourcenstärkung, Gesundheitspolitik, Sozialgesetzgebung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Gesundheitliche Prävention in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Debatte um die Etablierung gesundheitlicher Prävention als eigenständige Säule im deutschen Gesundheitssystem. Sie beleuchtet den Status quo der Prävention in Deutschland, analysiert das gescheiterte Präventionsgesetz und vergleicht internationale Strategien im Bereich der Gesundheitsförderung.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt den aktuellen Stand der Präventionsdebatte in Deutschland, die Analyse des Präventionsgesetzes und der damit verbundenen Herausforderungen, die Begriffsklärung und unterschiedliche Verständnisweisen von Prävention, einen internationalen Vergleich von Präventionsstrategien und die Entwicklung und Organisation der Prävention in Deutschland.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Ausgangslage der gesundheitlichen Prävention in Deutschland, ein Kapitel zum gescheiterten Präventionsgesetz, ein Kapitel zum internationalen Vergleich von Präventionsstrategien und abschließend eine Zusammenfassung und ein Fazit. Jedes Kapitel wird im Dokument kurz zusammengefasst.
Was wird im Kapitel "Ausgangslage: Gesundheitliche Prävention in Deutschland" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht den Status quo der gesundheitlichen Prävention in Deutschland. Es umfasst eine Begriffsklärung von Prävention (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention), die Analyse der Entwicklung und Organisation der Prävention in Deutschland (von Bismarck'scher Sozialgesetzgebung bis zur ganzheitlichen Betrachtung), den Einfluss des Wandels des Krankheitsspektrums und des demografischen Wandels sowie die unterschiedlichen Verständnisweisen von Prävention bei verschiedenen Akteuren.
Was wird im Kapitel "Das Präventionsgesetz – Ein gescheitertes Unterfangen?" analysiert?
Dieses Kapitel analysiert die Debatte um ein Präventionsgesetz in Deutschland, beleuchtet die historische Entwicklung, die Kernpunkte der Gesetzesentwürfe und die Kritik daran. Der Fokus liegt auf den Konflikten der beteiligten Akteure, den Gründen für das Scheitern des Gesetzes und den politischen und gesellschaftlichen Hürden.
Worauf konzentriert sich das Kapitel zum internationalen Vergleich?
Das Kapitel zum internationalen Vergleich analysiert verschiedene Gesundheitssysteme, um erfolgreiche Ansätze zur landesweiten Implementierung von Präventionsmaßnahmen zu identifizieren und deren Übertragbarkeit auf das deutsche System zu untersuchen. Es werden Best-Practice-Beispiele und potenzielle Transfermöglichkeiten evaluiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gesundheitliche Prävention, Gesundheitsförderung, Präventionsgesetz, Deutschland, Internationaler Vergleich, Primärprävention, Sekundärprävention, Tertiärprävention, Risikofaktoren, Ressourcenstärkung, Gesundheitspolitik, Sozialgesetzgebung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Präventionsdebatte in Deutschland darzustellen, den angestrebten Aufbau gesundheitlicher Prävention als vierte Säule im Gesundheitssystem zu beschreiben und die Schwierigkeiten bei der Umsetzung bundeseinheitlicher Regelungen aufgrund divergierender Interessen zu beleuchten.
- Citar trabajo
- Diplom-Pflegewirt Philipp Preßmann (Autor), 2008, Gesundheitliche Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115153