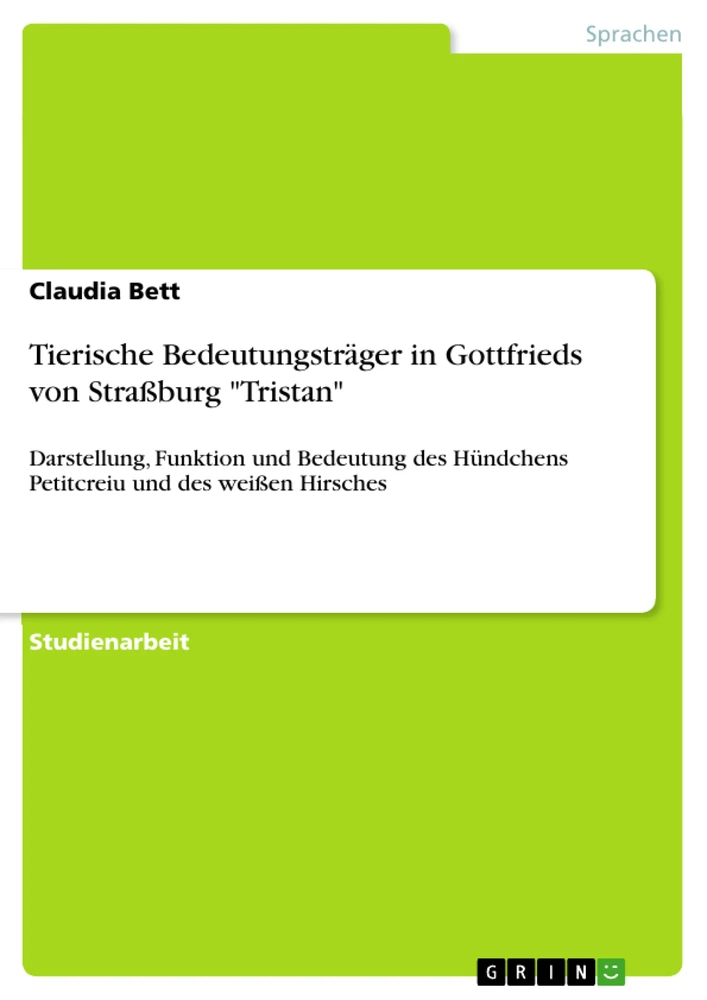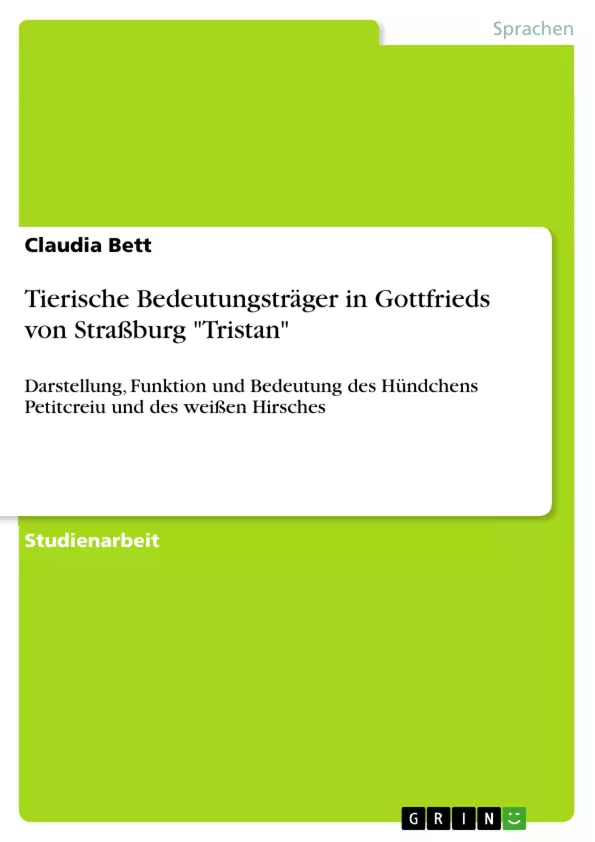Die folgende Arbeit befasst sich mit der Frage, worin die Mission der beiden Tiere (des Hündchens Petitcreiu und des weißen Hirsches) besteht, welcher Stellenwert ihnen in Gottfrieds Romanfragment zukommt und inwiefern sie trotz ihres recht kurzen und einmaligen Erscheinens als wichtige Funktions- und Bedeutungsträger innerhalb des Textes gesehen werden können.
Zunächst soll gezeigt werden, wie die Tierarten Hund und Hirsch allgemein in der zeitgenössischen mittelalterlichen Lebens- und Vorstellungswelt betrachtet und welche allegorischen und symbolischen Bedeutungen ihnen zugeschrieben wurden. Im Mittelpunkt von Gottfrieds von Straßburg 'Tristan' steht die Liebesbeziehung von Tristan und Isolde, die trotz ihres ehebrecherischen Charakters zum Ideal erhoben wird. Deshalb soll versucht werden, zu zeigen, inwiefern das Wunderhündchen und der weiße Hirsch als Symbole für das von Gottfried entworfene Minneideal gesehen werden können und ob sie in Bezug zu dem im Fokus stehenden Liebespaar stehen. Bevor die Funktion der beiden Tiere vor dem Hintergrund des Gesamtkontexts näher beleuchtet wird, ist es zunächst jedoch notwendig, sowohl Petitcreiu als auch den vremeden hirz genauer zu betrachten und zu analysieren, wie diese beiden Tiere von Gottfried eingeführt und beschrieben werden und welche besonderen Eigenschaften sie auszeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Wunderhündchen Petitcreiu
- Der Hund in der mittelalterlichen Vorstellungswelt
- Petitcreius Herkunft und optische Wirkung
- Die heilbringende Kraft Petitcreius
- Funktion der Petitcreiu-Episode
- Der weiße Hirsch der Minnegrotte
- Der Hirsch in der mittelalterlichen Vorstellungswelt
- Die äußere Erscheinung des Hirsches
- Funktion und Symbolik des weißen Hirsches
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle von Tieren im Romanfragment „Tristan“ von Gottfried von Straßburg, insbesondere mit den Figuren des Wunderhündchens Petitcreiu und des weißen Hirsches. Ziel ist es, die Funktionsweise und Bedeutung dieser Tiere im Kontext der mittelalterlichen Vorstellungswelt und des Minneideals zu analysieren.
- Der Hund in der mittelalterlichen Vorstellungswelt
- Die Symbolik des Hirsches im Mittelalter
- Die Funktion von Petitcreiu und dem weißen Hirsch in Gottfrieds „Tristan“
- Das Minneideal in Gottfrieds „Tristan“
- Die Verbindung von Tiermetaphern und Minneideal
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung von Tieren im mittelalterlichen Diskurs und stellt die Besonderheit der Figuren Petitcreiu und des weißen Hirsches in Gottfrieds Tristan heraus. Das Kapitel über Petitcreiu beleuchtet die Ambivalenz des Hundes in der mittelalterlichen Vorstellungswelt, betrachtet die Herkunft und die Beschreibung des Hündchens im Text und analysiert seine Funktion in der Episode.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Vorstellungswelt, Tiersymbolik, Hund, Hirsch, Gottfried von Straßburg, Tristan, Minneideal, Petitcreiu, weißer Hirsch, Funktionsweise, Bedeutung, Allegorie, Metapher, Textanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat das Hündchen Petitcreiu in Gottfrieds "Tristan"?
Petitcreiu ist ein Wunderhündchen, dessen Glöckchen jeden Kummer vergessen lässt. Es symbolisiert die Sehnsucht nach Trost in der leidvollen Liebesbeziehung von Tristan und Isolde.
Was symbolisiert der weiße Hirsch in der Minnegrotte?
Der weiße Hirsch gilt als edles, flüchtiges Tier und steht allegorisch für die Reinheit und die göttliche Dimension des Minneideals, das Tristan und Isolde anstreben.
Wie wurden Hunde im Mittelalter allgemein wahrgenommen?
Hunde galten als Symbole der Treue (Fides), konnten aber auch negative Konnotationen wie Unreinheit haben. In der höfischen Literatur überwog das Bild des treuen Begleiters.
Warum lehnt Isolde den Trost durch das Hündchen ab?
Isolde entfernt das magische Glöckchen, weil sie ihren Kummer um Tristan nicht vergessen will. Wahre Liebe bedeutet für sie, auch das Leid gemeinsam zu tragen.
Welche Rolle spielen Tiere als Bedeutungsträger in der mittelalterlichen Literatur?
Tiere fungieren oft als Spiegel menschlicher Eigenschaften oder als allegorische Hinweise auf moralische und religiöse Konzepte, die dem Leser tiefere Sinnschichten erschließen.
- Arbeit zitieren
- BA Claudia Bett (Autor:in), 2014, Tierische Bedeutungsträger in Gottfrieds von Straßburg "Tristan", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1152009