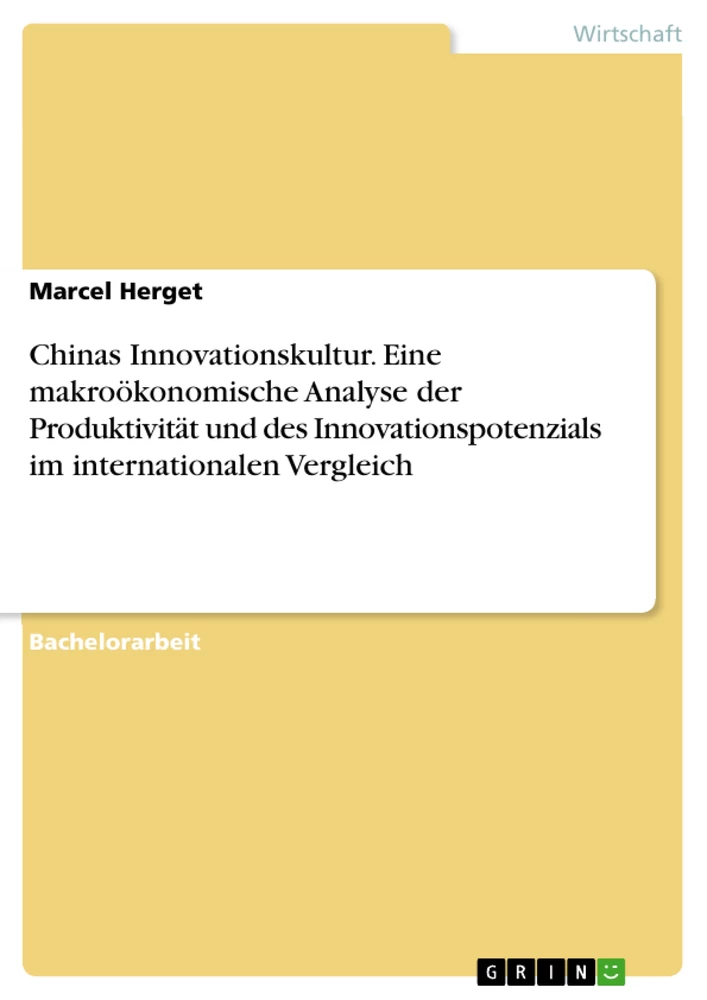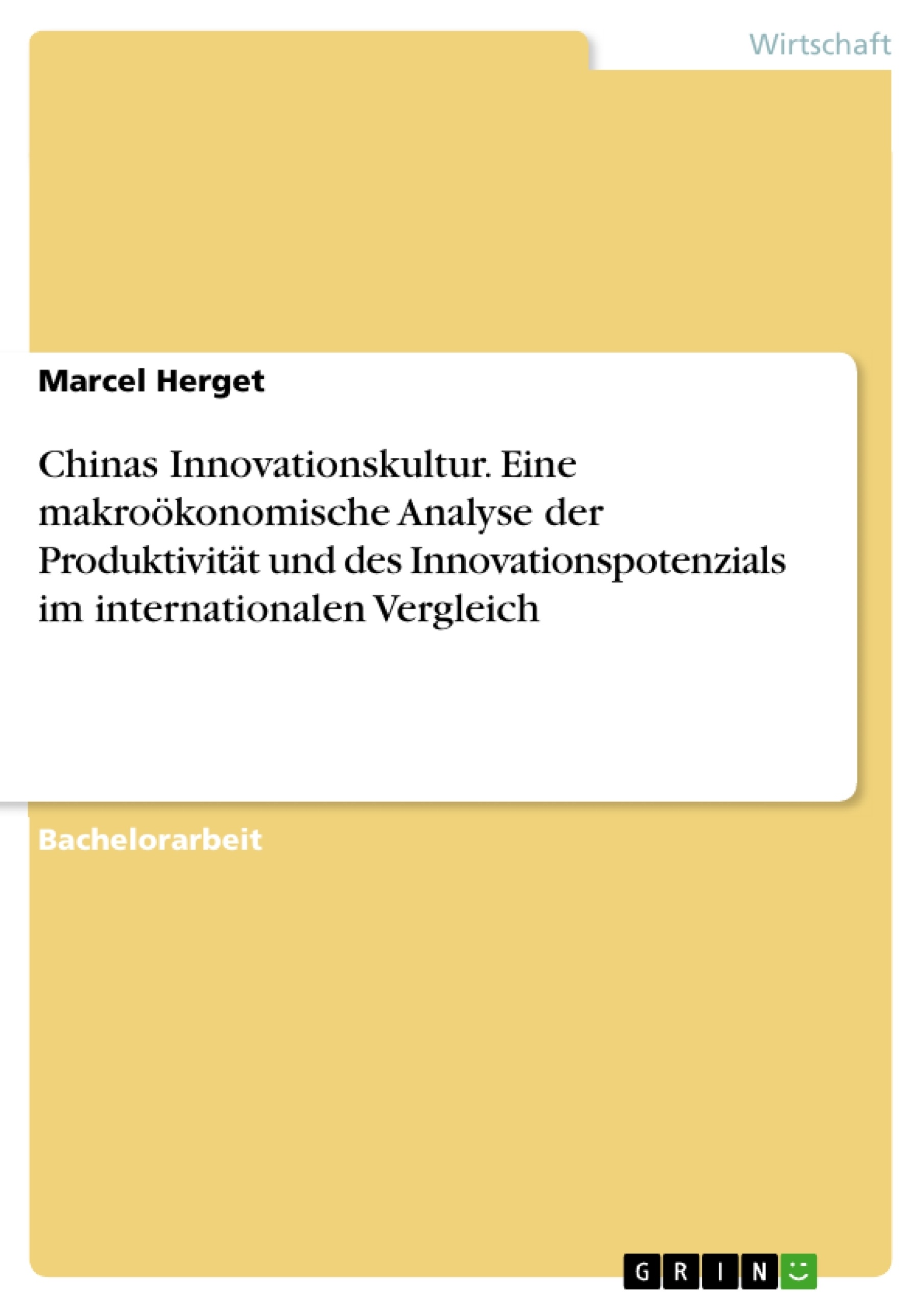China als ökonomisches Powerhouse des 21. Jahrhunderts hat eine lange und sehr lehrreiche, wirtschaftliche Geschichte. Mit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik im Jahr 1978 hat sich die heutige Großmacht entschieden, einen neuen, wirtschaftlichen Weg einzuschlagen und kann seitdem mit teilweise sehr imposanten Wachstumszahlen glänzen. Im Laufe der Zeit folgten viele wirtschaftliche Reformen und das grundlegende Wirtschaftssystem sowie die Wirtschaftspolitik haben sich stark verändert.
Seit 2016 ist China erstmals der wichtigste Handelspartner für Deutschland und viele Industrien sind stark von den Importen aus Ostasien abhängig.
Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Rolle Chinas als internationale, wirtschaftliche Großmacht zu eruieren und dabei vor allem die Innovationsstrategie- und Kultur zu analysieren. Die Arbeit soll außerdem näher untersuchen, ob China mit seiner neuen Strategie des innovationsgetrieben Wachstums erfolgreich sein kann.
Es wird zunächst mithilfe der Wachstumsrechnung, erstmals durch R. Solow im Jahr 1957 eingeführt, aufgezeigt, wie sich das Wachstum der Volksrepublik China bis 2019 entwickelt hat. Dabei wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aufgeteilt in die Komponenten Kapital, Arbeit und dem Solow-Residuum (= Totale Faktorproduktivität). Anschließend wird die totale
Faktorproduktivität (TFP) näher untersucht und in einen internationalen Vergleich gesetzt, um mehr über die Qualität der Produktivität aussagen zu können. Schließlich soll die Produktivität noch hinsichtlich der Effizienz und dem Technologischen Stand/Wissen untersucht werden. Den Abschluss der Arbeit bildet die kritische Auseinandersetzung mit dem nationalen Innovationssystem Chinas.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgehensweise
- Methodik und Modell
- Analyse
- Ausgangslage
- Totale Faktorproduktivität – nähere Untersuchung
- Technologischer Fortschritt und Effizienz
- Das demographische Problem
- Chinas Innovationssystem
- Der staatliche Sektor
- Universitäten und Hochschulen
- Wissenschaftliche Publikationen
- Patente
- Kultur und Interkulturelle Kommunikation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit Chinas Innovationskultur und analysiert die makroökonomischen Faktoren, die die Produktivität und das Innovationspotenzial des Landes im internationalen Vergleich beeinflussen. Die Arbeit untersucht, wie sich Chinas Wirtschaftswachstum zusammensetzt und welche Rolle die totale Faktorproduktivität dabei spielt. Darüber hinaus werden wichtige Aspekte des chinesischen Innovationssystems beleuchtet, um die Innovationskraft des Landes zu verstehen.
- Analyse der totalen Faktorproduktivität (TFP) in China
- Bewertung des technologischen Fortschritts und der Effizienz in China
- Bedeutung des staatlichen Sektors und der Hochschulen für das Innovationssystem Chinas
- Untersuchung der Rolle der Kultur und der interkulturellen Kommunikation für die Innovation
- Vergleich der Innovationskraft Chinas mit anderen Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und erläutert die Forschungsfrage, die Methodik und den Aufbau der Arbeit.
- Analyse: Dieses Kapitel analysiert die wirtschaftliche Entwicklung Chinas und untersucht die Rolle der totalen Faktorproduktivität. Es werden die Ursachen für das Wirtschaftswachstum Chinas beleuchtet und die Bedeutung des technologischen Fortschritts und der Effizienz für die Produktivitätssteigerung hervorgehoben. Zusätzlich wird das demographische Problem Chinas in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Landes diskutiert.
- Chinas Innovationssystem: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Institutionen und Strukturen, die die Innovation in China fördern. Es werden der staatliche Sektor, die Rolle der Universitäten und Hochschulen sowie die Bedeutung der Kultur und der interkulturellen Kommunikation für die Innovationskraft Chinas untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Innovationskultur, makroökonomische Analyse, Produktivität, Innovationspotenzial, totale Faktorproduktivität, technologischer Fortschritt, Effizienz, staatlicher Sektor, Universitäten, Hochschulen, Kultur, interkulturelle Kommunikation, Internationaler Vergleich.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Chinas aktueller Wirtschaftsstrategie?
China strebt einen Wandel von einer rein exportgetriebenen Wirtschaft hin zu einem innovationsgetriebenen Wachstum an, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.
Was bedeutet „Totale Faktorproduktivität“ (TFP)?
Die TFP misst den Teil des Wirtschaftswachstums, der nicht durch den Einsatz von Arbeit und Kapital erklärt werden kann, sondern auf technologischem Fortschritt und Effizienz basiert.
Welche Rolle spielen Universitäten im chinesischen Innovationssystem?
Universitäten sind zentrale Akteure für Forschung, wissenschaftliche Publikationen und die Anmeldung von Patenten, oft in enger Abstimmung mit staatlichen Vorgaben.
Welches demographische Problem hat China?
Die alternde Bevölkerung und die sinkende Zahl der Erwerbstätigen könnten das zukünftige Wirtschaftswachstum bremsen, weshalb Innovation zur Produktivitätssteigerung umso wichtiger wird.
Wie wichtig ist China als Handelspartner für Deutschland?
Seit 2016 ist China der wichtigste Handelspartner Deutschlands, wobei viele deutsche Industrien stark von Importen und dem Absatzmarkt in Ostasien abhängig sind.
- Arbeit zitieren
- Marcel Herget (Autor:in), 2021, Chinas Innovationskultur. Eine makroökonomische Analyse der Produktivität und des Innovationspotenzials im internationalen Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1152330