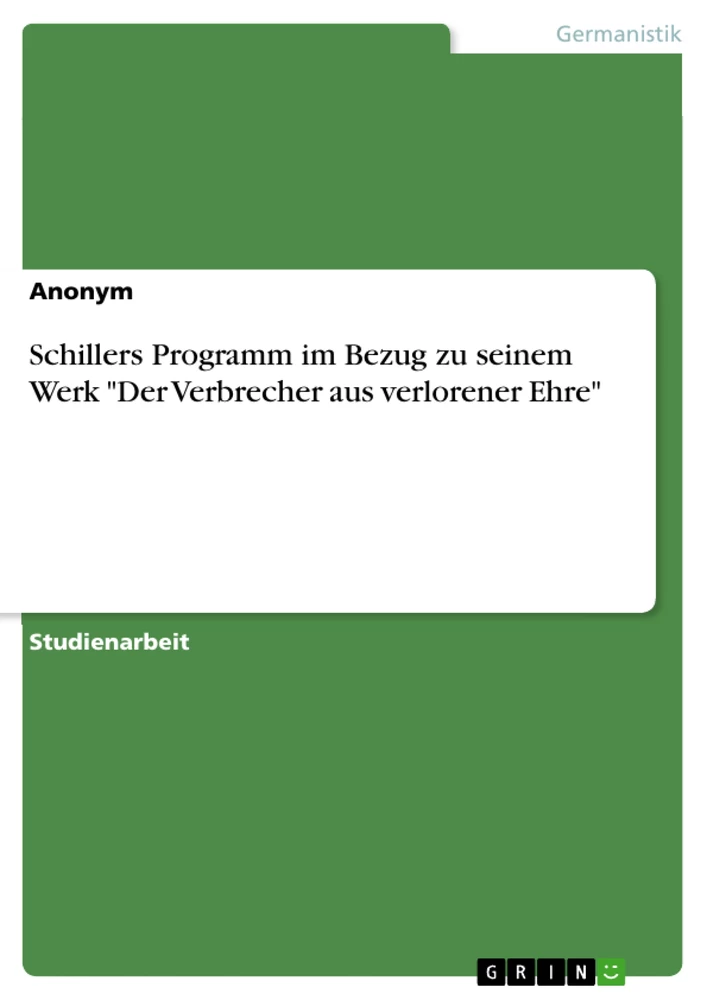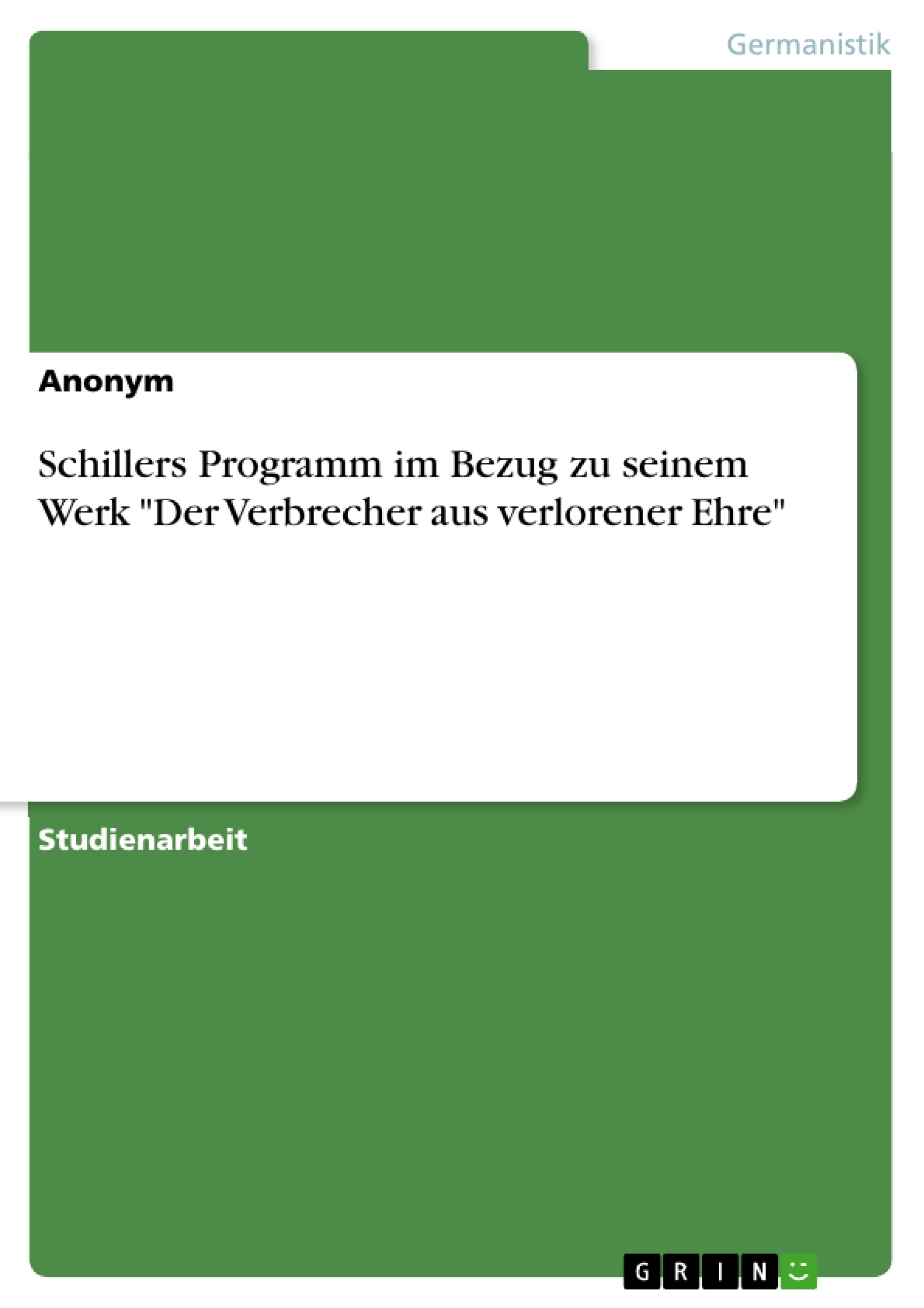Schiller gilt als einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller weltweit. Er sah sich dazu verpflichtet, die Menschheit verbessern zu wollen. Wie dies gelingen sollte, hielt er in seinem Werk "Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen" fest. Die vorliegende Arbeit stellt eine kurze Zusammenfassung seines Programms dar und stellt Verbindungen zwischen diesem und seiner Erzählung "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" her.
Um darzustellen, dass sich Schiller nicht erst während dem Verfassen seiner Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen damit beschäftigte, welche Intensionen ein Autor mit seinem Werk verfolgen sollte und wie eine Vervollkommnung des Individuums erlangt werden kann, sondern schon von Beginn an höhere Absichten durch seine verfassten Werke zu erreichen versuchte, soll sich diese Arbeit zunächst der Frage widmen, welches Programm Schiller in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen verfolgt. Dieses soll dann in Verbindung mit seinem Anliegen, welches er im Vorwort seiner Erzählung "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" äußert, gebracht und Gemeinsamkeiten festgestellt werden. Im Anschluss daran soll die Arbeit eigen, wie Schiller seine Vorsätze sowohl inhaltlich als auch sprachlich umsetzt. Zuletzt folgt ein Fazit, welches die Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst.
Inhaltsverzeichnis
- Schillers Ansprüche als Autor und Philosoph
- Schillers Programm
- Über die ästhetische Erziehung des Menschen
- Schillers Ziele im Verbrecher aus verlorener Ehre
- Umsetzung seiner Vorsätze im Verbrecher aus verlorener Ehre
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit Schillers programmatischem Ansatz in seinem Werk „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ und untersucht, wie er seine philosophischen Ideen in der Literatur umsetzt. Der Fokus liegt dabei auf Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen und seinen Vorstellungen von einer idealen Staatsform, die durch die Verbindung von Sinnlichkeit und Moralität erreicht werden kann.
- Schillers ästhetisches Erziehungsprogramm
- Die Rolle der Kunst zur Gestaltung der Gesellschaft
- Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in Schillers Werk
- Der Einfluss von Kants Philosophie auf Schillers Schriften
- Die Darstellung von Moralität und Recht im Verbrecher aus verlorener Ehre
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel untersucht Schillers Ansprüche als Autor und Philosoph, indem es seine frühen literarischen Werke und sein Interesse an der Politik und Philosophie beleuchtet. Insbesondere wird Schillers Interesse an Kants Ästhetik und seine Motivation, durch seine Werke die Menschheit zu verbessern, hervorgehoben.
- Das zweite Kapitel widmet sich Schillers Programm, das er in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen formuliert. Hierbei wird sein Ziel, die Menschen ästhetisch zu erziehen, um sie zum „bloß möglichen Ideal der Gesellschaft“ zu führen, erläutert. Im Zentrum steht die Notwendigkeit, den „Naturstaat“ in den „Vernunftsstaat“ zu verwandeln, ohne die Sinnlichkeit des Menschen zu zerstören. Schiller betont die Bedeutung der Ästhetik, um den harmonischen Menschen zu formen, der sowohl sinnlich als auch moralisch ist.
- Im dritten Kapitel werden die konkreten Umsetzungsmöglichkeiten von Schillers Programm im Verbrecher aus verlorener Ehre erörtert. Die Arbeit analysiert, wie Schiller in seinem Werk die Darstellung von Moralität und Recht in Bezug auf das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft konzipiert.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit thematisiert zentrale Aspekte von Schillers Philosophie und deren Umsetzung in seinem Werk „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“. Wichtige Schlüsselbegriffe sind dabei ästhetische Erziehung, Naturstaat, Vernunftsstaat, Sinnlichkeit, Moralität, Individuum, Gesellschaft, Recht, und Freiheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Schillers Programm der "ästhetischen Erziehung"?
Schiller postuliert, dass der Mensch durch die Kunst veredelt werden muss, um Sinnlichkeit und Moralität zu vereinen und so einen idealen Vernunftstaat zu ermöglichen.
Wie hängen die "Briefe" und die Erzählung "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" zusammen?
Die Arbeit zeigt, dass Schiller bereits in seinen literarischen Texten die philosophischen Ziele verfolgte, das Individuum durch die Darstellung moralischer Konflikte zu vervollkommnen.
Welche Rolle spielt das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in der Erzählung?
Schiller analysiert, wie gesellschaftliche Umstände und der Verlust der "Ehre" einen Menschen in die Kriminalität treiben können, was Fragen nach Recht und Moral aufwirft.
Was versteht Schiller unter dem "Naturstaat" und dem "Vernunftsstaat"?
Der Naturstaat basiert auf reiner Notwendigkeit und Trieben; der Vernunftsstaat ist das Ideal einer freien Gesellschaft, die durch ästhetische Bildung erreicht wird.
Wie setzt Schiller seine Vorsätze sprachlich um?
Durch eine präzise psychologische Analyse und eine Sprache, die den Leser zur Reflexion über das Schicksal des Protagonisten und die eigene Moral zwingt.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Schillers Programm im Bezug zu seinem Werk "Der Verbrecher aus verlorener Ehre", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1152992