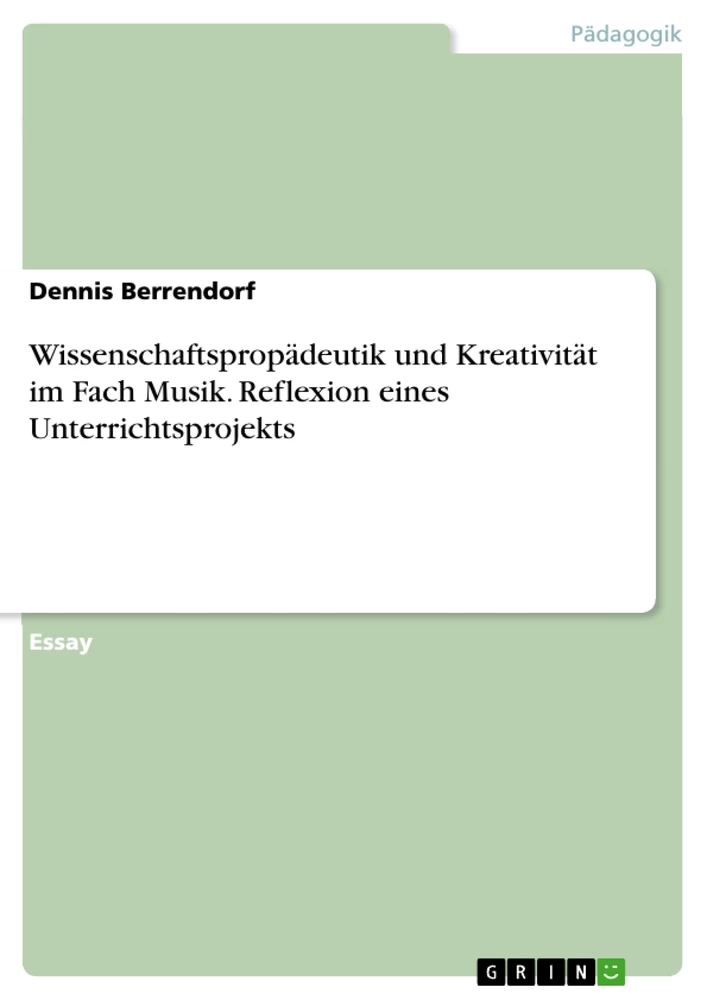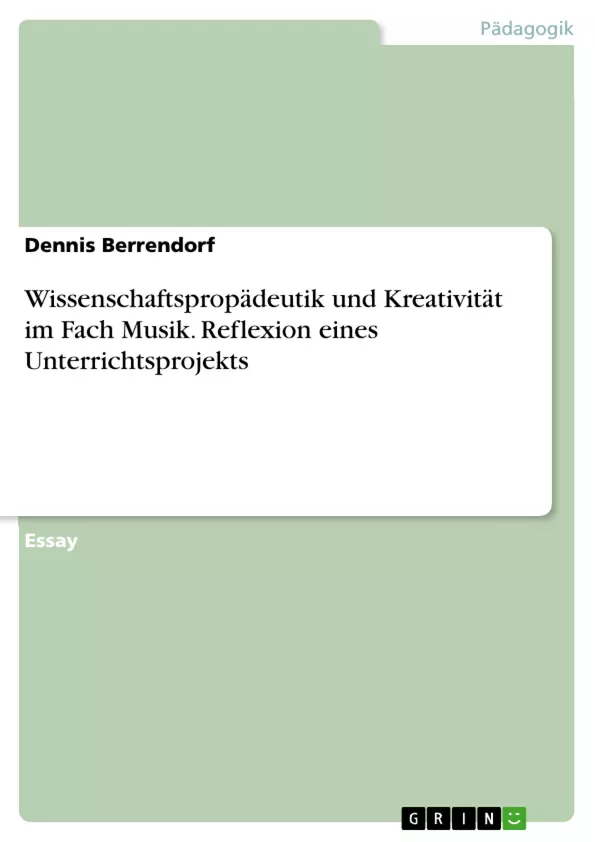Im folgenden Aufsatz werde ich mein Unterrichtsprojekt in der Einführungsphase des H.-Gymnasiums mit den Ansätzen der Wissenschaftspropädeutik und mit dem Aspekt der Kreativität untersuchen.
Der Aufbau ist so gestaltet, dass ich zunächst die wichtigsten Eigenschaften der Wissenschaftsorientierung in der gymnasialen Oberstufe anführe, und dann den Fokus auf die Beantwortung der Frage lege, inwiefern die Schülerinnen und Schüler innerhalb dieses Projekts kreativ sein konnten. Dabei werde ich immer wieder Beobachtungen aus dem Unterricht einfließen lassen, um die theoretischen Ansätze aspektorientiert untermauen zu können. Für die Erkenntnisse über die wissenschaftsorientierte Schulmusik stütze ich mich in erster Linie auf die Texte von Hans Heinrich Eggebrecht; in der Diskussion über die Kreativität werden besonders die Modelle von Henri Poincaré, Viktor Lowenfeld und Joy Paul Guilford zurate gezogen, um das Unterrichtsvorhaben unter diesen Gesichtspunkten schlussendlich verifizieren oder falsifizieren zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Wissenschaftspropädeutik und Kreativität im Fach Musik: Reflexion eines Unterrichtsprojekts
- Wissenschaftsorientierung in der gymnasialen Oberstufe
- Kreativität im Musikunterricht
- Didaktisches Ziel und Lernergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz analysiert ein Unterrichtsprojekt in der Einführungsphase des H.-Gymnasiums unter dem Aspekt der Wissenschaftspropädeutik und Kreativität im Fach Musik. Das Projekt verfolgt das Ziel, die Schülerinnen und Schüler mit dem Dies-Irae-Motiv vertraut zu machen, sie dazu anzuregen, selbstständig Theorien zu entwickeln und dieses Motiv kreativ umzusetzen.
- Wissenschaftspropädeutik in der gymnasialen Oberstufe
- Kreativität im Musikunterricht
- Konstruktivistische Lerntheorie
- Hermeneutischer Zirkel
- Didaktische Ziele und Lernergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
- Der erste Teil beleuchtet die wichtigsten Eigenschaften der Wissenschaftsorientierung in der gymnasialen Oberstufe. Hierbei werden die Ansätze von Hans Heinrich Eggebrecht und Helmut Tschache diskutiert, die betonen, dass Wissenschaft nicht als etwas getrenntes vom Leben verstanden werden sollte, sondern als Haltung, die aus den Fragen des Lebens erwächst.
- Im zweiten Teil wird der Aspekt der Kreativität anhand des Unterrichtsprojekts untersucht. Es wird gezeigt, wie die Schülerinnen und Schüler durch die Auseinandersetzung mit dem Dies-Irae-Motiv in einen Prozess der Perturbation, Inkubation und Illumination gelangen, der zu kreativen Einfällen führt.
- Der dritte Teil behandelt das didaktische Ziel des Projekts, welches darin bestand, jüngere musikästhetische Traditionen rezipieren und musikalisch-historische Kontexte neu zu gestalten. Es wird gezeigt, wie die Schülerinnen und Schüler in der zweiten Aufgabe des Projekts ein Rollenspiel entwickelten, in dem sie das jüngste Gericht interpretierten und dabei die ästhetische Intelligenz und Kreativität förderten.
Schlüsselwörter
Dieser Text befasst sich mit den Themen Wissenschaftspropädeutik, Kreativität, konstruktivistische Lerntheorie, Hermeneutischer Zirkel, ästhetische Intelligenz, Schulmusik und Musikwissenschaft. Die Forschungsarbeit zielt auf die Analyse eines Unterrichtsprojekts ab, das den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, mit dem Dies-Irae-Motiv kreativ zu arbeiten und gleichzeitig ein tieferes Verständnis für die wissenschaftliche Herangehensweise im Fach Musik zu entwickeln.
- Quote paper
- Dennis Berrendorf (Author), 2013, Wissenschaftspropädeutik und Kreativität im Fach Musik. Reflexion eines Unterrichtsprojekts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1153754