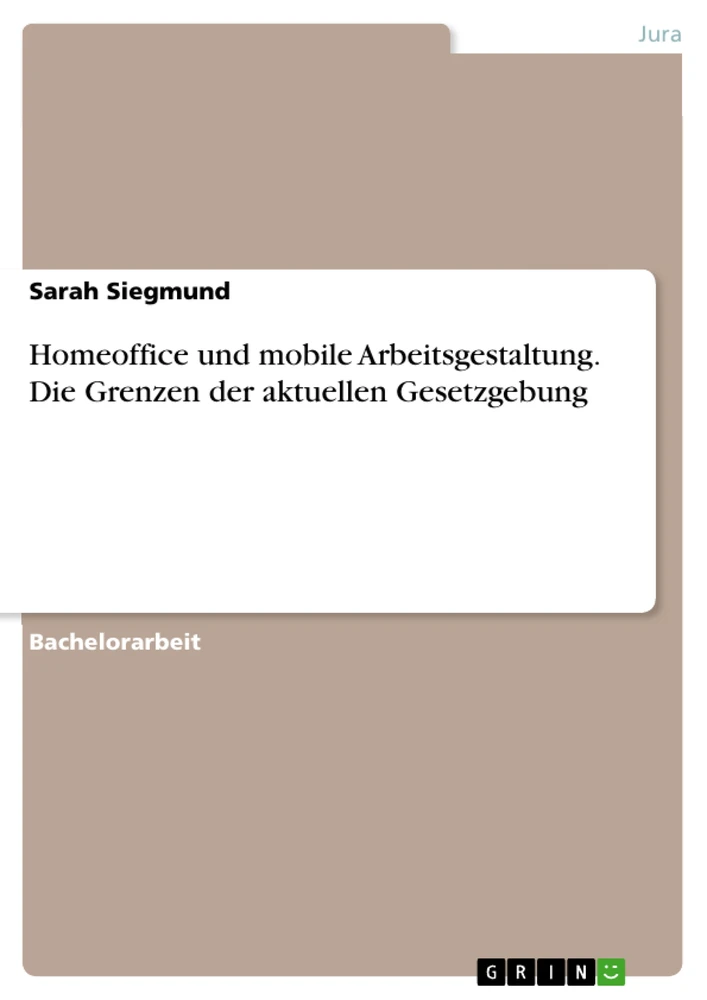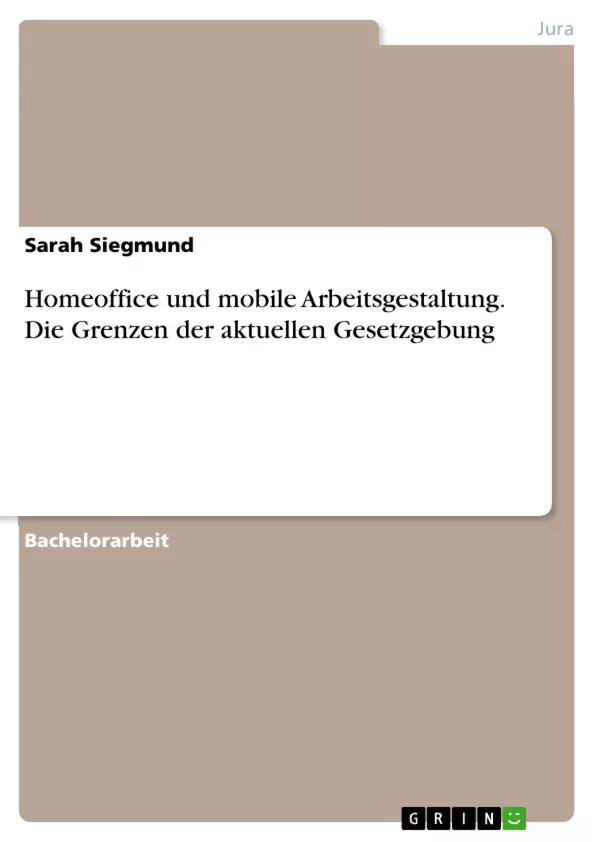Diese Bachelorarbeit thematisiert im ersten Teil die rechtliche Analyse der mobilen Arbeitsgestaltung sowie im zweiten Teil die der vorliegenden Gesetzentwürfe. Zunächst gilt es in Teil eins der Arbeit zu erläutern, was unter mobiler Arbeitsgestaltung zu verstehen ist, weshalb die Begriffe Telearbeit, Homeoffice sowie mobile Arbeit näher betrachtet werden. Nach den Begriffsbestimmungen folgt die Untersuchung der rechtlichen Handhabung der mobilen Arbeitsformen in der Praxis. Die Themengebiete Arbeitszeit, Arbeitsschutz, Gestaltung des Arbeitsplatzes, Datenschutz, Haftung und Sozialversicherung sollen von der Untersuchung erfasst werden. Der Sinn und Zweck besteht darin, einen Überblick über die derzeitige rechtliche Situation bei der Inanspruchnahme der mobilen Arbeitsgestaltung zu geben, um mögliche praktische Probleme zu identifizieren. Im zweiten Teil der Arbeit sollen die vorliegenden Gesetzentwürfe betrachtet werden. Nach einer kurzen inhaltlichen Wiedergabe soll herausgearbeitet werden, inwiefern die Gesetzentwürfe für die in den einzelnen Themengebieten identifizierten Probleme Lösungen anbieten. Das Ziel besteht darin, die Frage zu beantworten, ob die Gesetzentwürfe dafür geeignet sind, bestehende rechtliche Unsicherheiten zu beseitigen. Abschließend gilt zu erörtern, ob sich die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für die Umsetzung mobiler Arbeit überhaupt als sinnvoll erweist.
"Es gibt keinen Grund, warum irgendjemand einen Computer in seinem Haus bräuchte." (Ken Olsen, Gründer Digital Equipment Corporation, 1977).
Aus heutiger Sicht betrachtet, gilt die Äußerung als eine derartige Fehlprognose. In der Arbeitswelt 4.0 besteht die Möglichkeit für den Arbeitsnehmer durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien, wozu u.a. Laptops, Smartphones und Tablets gehören, die berufliche Tätigkeit ortsungebunden auszuführen. Auch privat belief sich der Anteil der Smartphone Nutzer in Deutschland 2020 bereits auf 86% , was bedeutet, dass fast jeder Deutsche ein Smartphone nutzt und somit in der Theorie, um die Dimensionen zu verdeutlichen, die Möglichkeit besitzt, ortungebunden zu arbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Mobile Arbeitsgestaltung
- I. Begriffsbestimmung
- a. Telearbeit
- b. Homeoffice
- c. Mobiles Arbeiten
- II. Rechtsgrundlage
- a. Anspruch
- b. Pflicht
- III. Vor- und Nachteile
- a. Arbeitnehmersicht
- b. Arbeitgebersicht
- C. Rechtliche Rahmenbedingungen
- I. Arbeitszeit
- a. Dauer und Lage
- b. Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
- II. Arbeitsschutz
- a. Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- b. Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
- III. Gestaltung des Arbeitsplatzes
- a. Ausstattung
- b. Aufwendungsersatz
- IV. Datenschutz
- a. Schutz personenbezogener Daten
- b. Schutz von Geschäftsgeheimnissen
- V. Haftung
- a. Arbeitnehmerhaftung
- b. Haftung Dritter
- VI. Sozialversicherung
- a. Arbeitsunfall
- b. Wegeunfall
- VII. Fazit
- D. Gesetzentwürfe
- I. Mobile Arbeit-Gesetz (MAG)
- a. Inhalt
- b. Umsetzung
- II. Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung mobiler Arbeit (EMAG)
- a. Inhalt
- b. Umsetzung
- III. Praktische Anwendbarkeit
- a. Rechtsgrundlage
- aa. Antrag (§ 111 Abs. 1 GewO-E)
- bb. Erörterungspflicht (§ 111 Abs. 2 GewO-E)
- b. Arbeitszeit
- aa. Mobile Arbeit-Gesetz (MAG)
- bb. Gesetzliche Fiktion (§ 111 Abs. 3-4 GewO-E)
- cc. Entwurf zur Erleichterung mobiler Arbeit (EMAG)
- c. Arbeitsschutz
- d. Gestaltung des Arbeitsplatzes
- e. Datenschutz
- f. Haftung
- g. Sozialversicherung
- h. Sonstiges
- VIII. Zusammenfassung
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der rechtlichen Gestaltung der mobilen Arbeit in Deutschland und untersucht die Grenzen der aktuellen Gesetzgebung. Ziel ist es, die rechtlichen Herausforderungen der mobilen Arbeitsgestaltung im Kontext von Arbeitsschutz, Datenschutz, Arbeitszeit und Sozialversicherung aufzuzeigen und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren.
- Begriffsbestimmung von Telearbeit, Homeoffice und mobiler Arbeit
- Analyse der Rechtsgrundlage für mobile Arbeit und die Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
- Bewertung der Vor- und Nachteile der mobilen Arbeitsgestaltung aus Sicht der Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Bewertung der Auswirkungen der aktuellen Gesetzgebung auf die mobile Arbeit
- Diskussion der Referentenentwürfe "Mobile Arbeit-Gesetz" (MAG) und "Entwurf zur Erleichterung mobiler Arbeit" (EMAG)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Bedeutung der mobilen Arbeitsgestaltung in der heutigen Arbeitswelt heraus. Kapitel B behandelt die Begriffsbestimmung von Telearbeit, Homeoffice und mobiler Arbeit und beleuchtet die Rechtsgrundlagen für die mobile Arbeit in Deutschland. In Kapitel C werden die rechtlichen Rahmenbedingungen der mobilen Arbeit im Hinblick auf Arbeitsschutz, Datenschutz, Arbeitszeit und Sozialversicherung analysiert. Kapitel D widmet sich der Diskussion der Referentenentwürfe "Mobile Arbeit-Gesetz" (MAG) und "Entwurf zur Erleichterung mobiler Arbeit" (EMAG) und untersucht deren praktische Anwendbarkeit.
Schlüsselwörter
Mobile Arbeit, Telearbeit, Homeoffice, Arbeitszeit, Arbeitsschutz, Datenschutz, Sozialversicherung, Gesetzentwürfe, Mobile Arbeit-Gesetz (MAG), Entwurf zur Erleichterung mobiler Arbeit (EMAG), Rechtsgrundlage, Arbeitnehmer, Arbeitgeber
Häufig gestellte Fragen
Was ist der rechtliche Unterschied zwischen Homeoffice und mobiler Arbeit?
Homeoffice (Telearbeit) ist meist ortsgebunden an die Wohnung, während mobiles Arbeiten die ortsunabhängige Tätigkeit (z. B. im Zug oder Café) beschreibt.
Gilt das Arbeitszeitgesetz auch im Homeoffice?
Ja, das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) regelt auch bei mobiler Arbeit die Höchstarbeitszeiten sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen und Ruhezeiten.
Wer haftet bei Unfällen während der mobilen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die sozialversicherungsrechtliche Einordnung von Arbeits- und Wegeunfällen im privaten Umfeld und die entsprechende Haftung des Arbeitgebers.
Welche Anforderungen stellt der Datenschutz an mobiles Arbeiten?
Der Schutz personenbezogener Daten und Geschäftsgeheimnisse muss durch technische und organisatorische Maßnahmen auch außerhalb des Betriebs gewährleistet sein.
Was sieht das geplante "Mobile Arbeit-Gesetz" (MAG) vor?
Die Gesetzentwürfe diskutieren unter anderem einen Rechtsanspruch auf mobile Arbeit sowie Erörterungspflichten für Arbeitgeber.
- Arbeit zitieren
- Sarah Siegmund (Autor:in), 2021, Homeoffice und mobile Arbeitsgestaltung. Die Grenzen der aktuellen Gesetzgebung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1153783