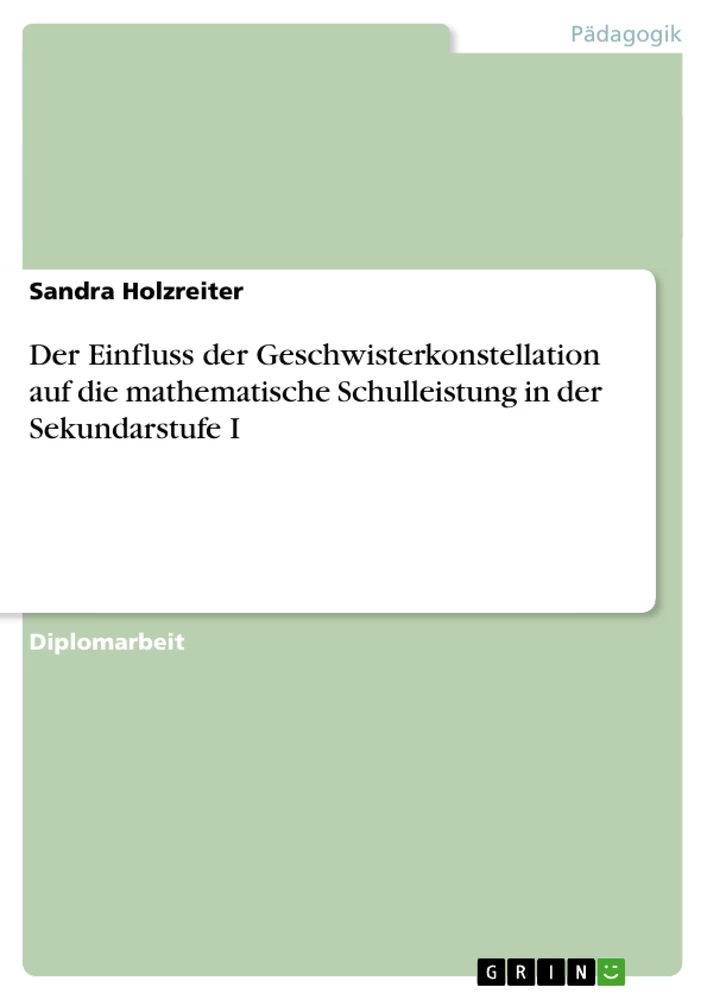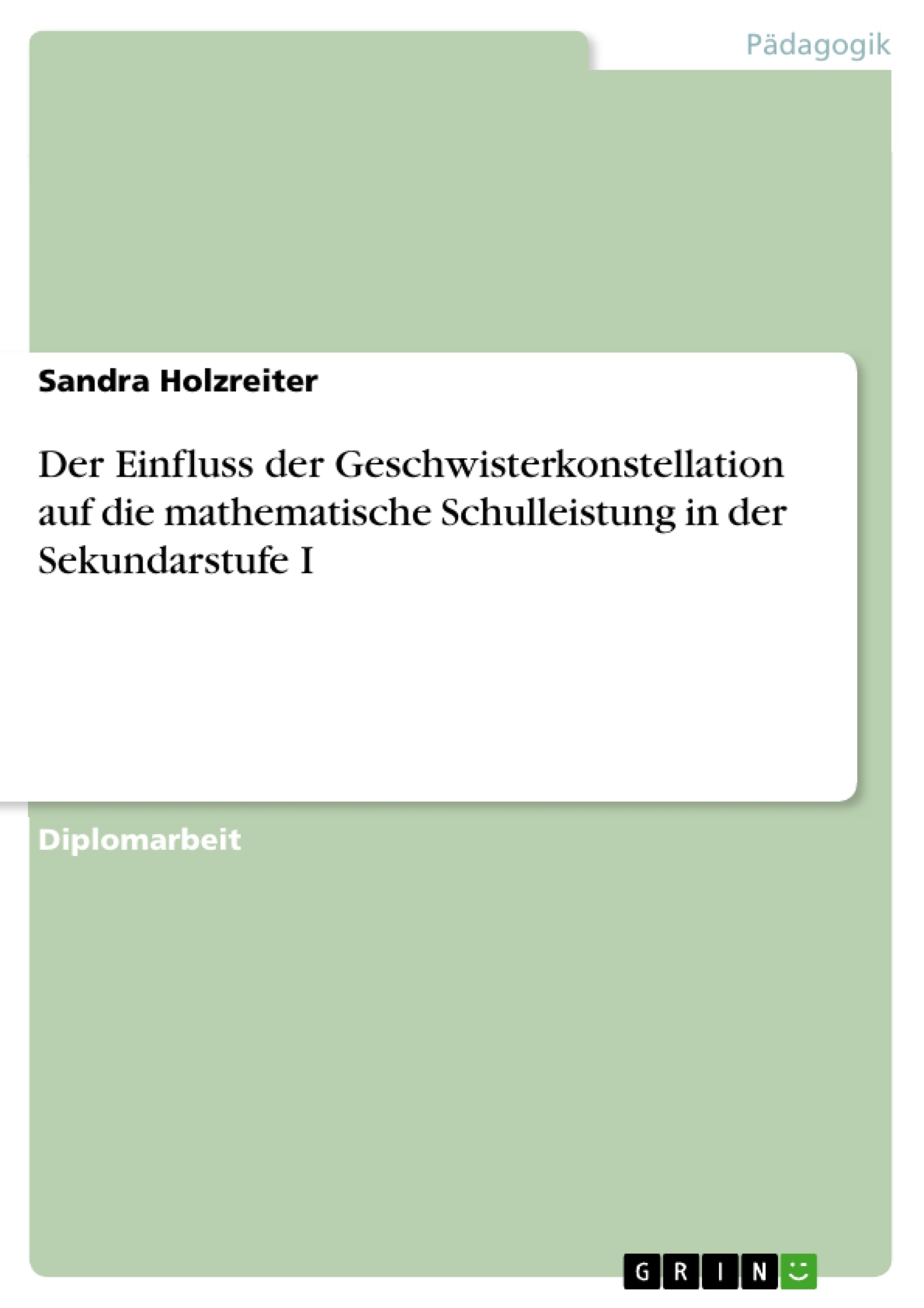Schule und die familiäre Lebensumwelt, zu welcher die Geschwister zu zählen sind, spielen eine große Rolle im Leben eines Kindes. Das Hauptziel dieser Arbeit ist es empirisch zu überprüfen, ob und in welchem Ausmaß die Geschwisterkonstellation, in Anlehnung an die Traditionelle Geschwisterkonstellationstheorie nach Alfred ADLER, welche die Auswirkung der Geschwisterposition auf die ersönlichkeitsentwicklung in den Mittelpunkt rückte, die Schulleistung beeinflusst. Für die vorliegende Arbeit sind die Stellung in der Geschwisterreihe und ihr Einfluss auf Schulleistungen in Mathematik relevant. Über Geschwisterbeziehungen und die Geschwisterkonstellation, sowie die Anzahl und das Geschlecht der Geschwister und ihren Einfluss auf die Schulleistung gibt es verschiedene widersprüchliche Studien. Teils kann die Forschungslage als defizitär betrachtet werden, da in den einzelnen Untersuchungen unterschiedliche Variablen zum Einsatz kamen. Durch diese uneinheitliche Forschungslage ergibt sich die Relevanz dieser Untersuchung.
Um eine empirische Untersuchung möglich zu machen, ist eine theoretische Aufarbeitung der Thematik nötig. In Kapitel 2 werden allgemeine Begrifflichkeiten und unterschiedliche Definitionen zum Thema Geschwisterbeziehung sowie ein historischer Abriss dargestellt. Weiters wird auf die Merkmale der Geschwisterbeziehung, welche Nähe und Rivalität zwischen den Geschwistern beinhalten, eingegangen. Ein weiterer Punkt befasst sich mit bedeutsamen Einflüssen auf die Geschwisterbeziehung und mit Gemeinsamkeiten bzw. Unterschieden in der Beziehungsdynamik von Geschwistern. Kapitel 3 widmet sich der Geschwisterkonstellationsforschung und ist unterteilt in die Bereiche Traditionelle Geschwisterkonstellationsforschung, weiterführende Forschungslage und aktueller Forschungsstand. In diesem Kapitel erfolgt auch die Darstellung der unterschiedlichen Geburtsplätze, wie beispielsweise die Situation des ältesten Kindes in einer Familie und die Gegenüberstellung geschlechtsspezifischer Positionen. Zusätzlich werden auch der Altersabstand und die Anzahl der Geschwister angeführt. In einem eigenen nächsten Kapitel 4 wird auf die Situation von Einzelkindern eingegangen und Vorurteile bzw. Chancen und Defizite dieser Position beschrieben. Kapitel 5 nähert sich mit Definitionen dem Begriff Schulleistung. In weiterer Folge werden die Determinanten der Schulleistung kurz angeführt, bevor in einem weiteren Punkt auf Familie und Schulleistung eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschwisterbeziehung
- 2.1. Allgemeines
- 2.2. Historischer Abriss
- 2.3. Definition Begriff „Geschwister“
- 2.4. Merkmale der Geschwisterbeziehung
- 2.5. Nähe und Distanz bzw. Rivalität in der Geschwisterbeziehung
- 2.5.1. Nähe
- 2.5.2. Rivalität
- 2.5.3. Auswirkungen auf die Geschwisterbeziehung
- 2.6. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Geschwistern
- 2.7. Resümee
- 3. Geschwisterkonstellationen
- 3.1. Forschungsansätze
- 3.1.1. Traditionelle Geschwisterkonstellationsforschung
- 3.1.2. Weiterführende Forschung
- 3.1.3. Aktueller Forschungsstand
- 3.2. Geburtsrangplatz in der Geschwisterreihe
- 3.2.2. Situation des ältesten/erstgeborenen Kindes
- 3.2.3. Situation der zweiten und mittleren Kinder
- 3.2.4. Situation des jüngsten Kindes
- 3.3. Altersabstand der Geschwister
- 3.4. Anzahl der Geschwister
- 3.5. Geschlecht der Geschwister und seine Bedeutung
- 3.6. Geschlechtsspezifische Beschreibungen
- 3.6.1 Zwei Brüder - Erstgeborener und Zweitgeborener
- 3.6.2 Zwei Schwestern - Erstgeborene und Zweitgeborene
- 3.6.3 Unterschiede in Brüder- und Schwesternbeziehungen
- 3.6.4 Älterer Bruder und jüngere Schwester
- 3.6.5 Ältere Schwester und jüngerer Bruder
- 3.7. Resümee
- 3.1. Forschungsansätze
- 4. Einzelkinder
- 4.1. Wandel der Familie
- 4.2. Definition Begriff „Einzelkind“
- 4.3. Situation und Merkmale des Einzelkindes
- 4.4. Vorurteile
- 4.5. Chancen und Defizite
- 4.6. Resümee
- 5. Schulleistung - Allgemeines
- 5.1. Definition Begriff „Schulleistung“
- 5.2. Faktoren der Schulleistung
- 5.3. Familie und Schulleistung
- 5.3.1 Einfluss der Familiengröße auf Schulleistung
- 5.3.2 Genetische Faktoren
- 5.3.3 Schichtzugehörigkeit
- 5.4. Geschwister und Schulleistung
- 5.4.1 Geschlechtsunterschiede und Schulleistung
- 5.4.2 Anzahl der Geschwister und Schulleistung
- 5.4.3 Einfluss der Geschwisterkonstellation auf Schulleistung
- 5.5. Resümee
- 6. Empirische Untersuchung
- 6.1. Beschreibung der Messinstrumente
- 6.2. Durchführung der Untersuchung
- 7. Beschreibung der Stichprobe
- 8. Zielsetzung
- 9. Bildung der Fragestellungen und Hypothesen
- 10. Statistische Auswertung
- 10.1. Allgemeines zur Auswertung
- 10.2. Auswertung der Hypothesen
- 10.2.1 Auswertung der Hypothese 1
- 10.2.2 Auswertung der Hypothese 2
- 10.2.3 Auswertung der Hypothese 3
- 10.2.4 Auswertung der Hypothese 4
- 10.2.5 Auswertung der Hypothese 5
- 10.2.6 Auswertung der Hypothese 6
- 11. Interpretation Ergebnisse und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht empirisch den Einfluss der Geschwisterkonstellation auf die mathematische Schulleistung in der Sekundarstufe I. Die Arbeit stützt sich auf die traditionelle Geschwisterkonstellationstheorie nach Alfred Adler und konzentriert sich auf die Stellung in der Geschwisterreihe und deren Auswirkungen auf die mathematischen Leistungen. Es werden widersprüchliche Forschungsergebnisse zu Geschwisterbeziehungen, Geschwisteranzahl und -geschlecht im Hinblick auf die Schulleistung aufgegriffen und kritisch bewertet.
- Einfluss der Geschwisterposition auf die mathematische Schulleistung
- Auswirkungen der Geschwisteranzahl auf die Schulleistung
- Bedeutung des Geschlechts der Geschwister für die Schulleistung
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand zur Geschwisterkonstellation
- Empirische Überprüfung der Hypothesen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt das Hauptziel der Arbeit: die empirische Überprüfung des Einflusses der Geschwisterkonstellation auf die Schulleistung, insbesondere in Mathematik. Es wird auf die Relevanz der Studie aufgrund widersprüchlicher Forschungsbefunde hingewiesen und der Aufbau der Arbeit skizziert. Die Kapitel 2 bis 5 befassen sich mit der theoretischen Aufarbeitung, während Kapitel 6 bis 11 den empirischen Teil umfassen.
2. Geschwisterbeziehung: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über Geschwisterbeziehungen. Es werden verschiedene Definitionen des Begriffs "Geschwister" vorgestellt, gefolgt von einem historischen Abriss der Geschwisterforschung. Wesentliche Merkmale wie Nähe, Rivalität und deren Auswirkungen auf die Geschwisterdynamik werden detailliert beschrieben. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Geschwisterbeziehungen werden ebenso beleuchtet, um ein fundiertes Verständnis für die Komplexität dieser Beziehungen zu schaffen.
3. Geschwisterkonstellationen: Kapitel 3 befasst sich eingehend mit der Geschwisterkonstellationsforschung. Es werden verschiedene Forschungsansätze, von traditionellen Ansätzen bis zum aktuellen Forschungsstand, dargestellt und kritisch bewertet. Der Fokus liegt auf dem Geburtsrangplatz, dem Altersabstand, der Anzahl und dem Geschlecht der Geschwister und deren jeweiliger Bedeutung für die Geschwisterdynamik. Geschlechtsspezifische Konstellationen (z.B., zwei Brüder, zwei Schwestern) und deren spezifische Charakteristika werden detailliert analysiert.
4. Einzelkinder: Dieses Kapitel widmet sich der Situation von Einzelkindern. Es beleuchtet den Wandel der Familienstrukturen, definiert den Begriff „Einzelkind“ und beschreibt die spezifischen Merkmale, Chancen und Herausforderungen, denen Einzelkinder begegnen. Vorurteile gegenüber Einzelkindern werden adressiert und kritisch reflektiert.
5. Schulleistung - Allgemeines: Kapitel 5 definiert den Begriff "Schulleistung" und beleuchtet die verschiedenen Faktoren, die sie beeinflussen. Der Fokus liegt auf dem Einfluss der Familie, insbesondere der Familiengröße, genetischer Faktoren und der Schichtzugehörigkeit. Der Einfluss von Geschwistern auf die Schulleistung wird ausführlich diskutiert, wobei die Geschwisteranzahl und die Geschwisterkonstellation im Mittelpunkt stehen. Verschiedene Forschungsarbeiten zu diesem Thema werden vorgestellt und analysiert.
Schlüsselwörter
Geschwisterkonstellation, Geschwisterbeziehung, Schulleistung, Mathematik, Sekundarstufe I, Geburtsrangplatz, Altersabstand, Geschwisteranzahl, Geschlecht, Einzelkind, Empirische Untersuchung, Alfred Adler.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Einfluss der Geschwisterkonstellation auf die mathematische Schulleistung
Was ist das Thema dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht empirisch den Einfluss der Geschwisterkonstellation auf die mathematische Schulleistung in der Sekundarstufe I. Sie konzentriert sich auf die Stellung in der Geschwisterreihe und deren Auswirkungen auf die mathematischen Leistungen. Widersprüchliche Forschungsergebnisse zu Geschwisterbeziehungen, Geschwisteranzahl und -geschlecht im Hinblick auf die Schulleistung werden aufgegriffen und kritisch bewertet.
Welche Aspekte der Geschwisterkonstellation werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Aspekte der Geschwisterkonstellation, darunter die Geschwisterposition (Geburtsrangplatz), die Geschwisteranzahl, den Altersabstand zwischen den Geschwistern und das Geschlecht der Geschwister. Es wird auch der Unterschied zwischen Einzelkindern und Kindern mit Geschwistern analysiert.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die traditionelle Geschwisterkonstellationstheorie nach Alfred Adler. Sie berücksichtigt jedoch auch neuere Forschungsergebnisse und kritische Auseinandersetzungen mit dem bestehenden Forschungsstand.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil umfasst Kapitel 2 bis 5 und behandelt die Geschwisterbeziehung, Geschwisterkonstellationen, Einzelkinder und allgemeine Aspekte der Schulleistung. Der empirische Teil (Kapitel 6 bis 11) beschreibt die empirische Untersuchung, die Stichprobe, die Zielsetzung, die Fragestellungen und Hypothesen, die statistische Auswertung und die Interpretation der Ergebnisse.
Welche Forschungsfragen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Geschwisterposition, der Geschwisteranzahl und des Geschlechts der Geschwister auf die mathematische Schulleistung. Konkrete Hypothesen werden formuliert und empirisch überprüft.
Welche Methoden werden in der empirischen Untersuchung verwendet?
Die Arbeit beschreibt die verwendeten Messinstrumente, die Durchführung der Untersuchung und die statistische Auswertung der Daten. Die genauen Methoden werden in den Kapiteln 6 bis 10 detailliert erläutert.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Die Arbeit erwartet Ergebnisse, die den Einfluss der Geschwisterkonstellation auf die mathematische Schulleistung belegen oder widerlegen. Die Interpretation der Ergebnisse und eine Diskussion der Ergebnisse erfolgen in Kapitel 11.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Wissenschaftler, Pädagogen und alle, die sich für die Thematik Geschwisterkonstellation und deren Einfluss auf die Schulleistung interessieren. Sie ist auch für Studierende der Pädagogik und Psychologie relevant.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geschwisterkonstellation, Geschwisterbeziehung, Schulleistung, Mathematik, Sekundarstufe I, Geburtsrangplatz, Altersabstand, Geschwisteranzahl, Geschlecht, Einzelkind, Empirische Untersuchung, Alfred Adler.
- Quote paper
- Mag. Sandra Holzreiter (Author), 2007, Der Einfluss der Geschwisterkonstellation auf die mathematische Schulleistung in der Sekundarstufe I, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115381