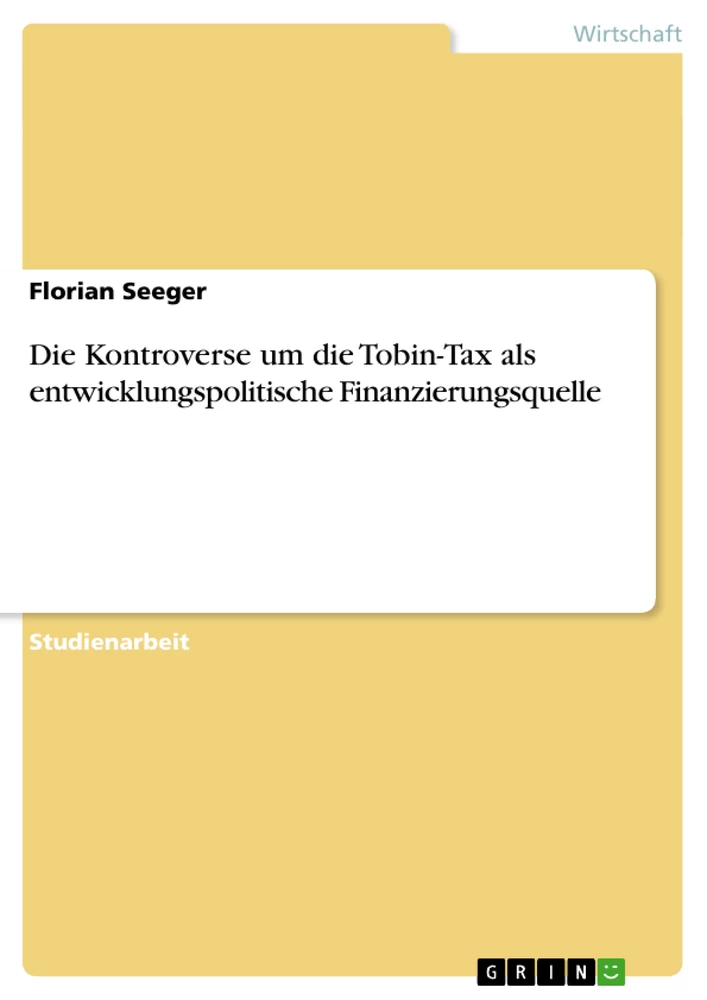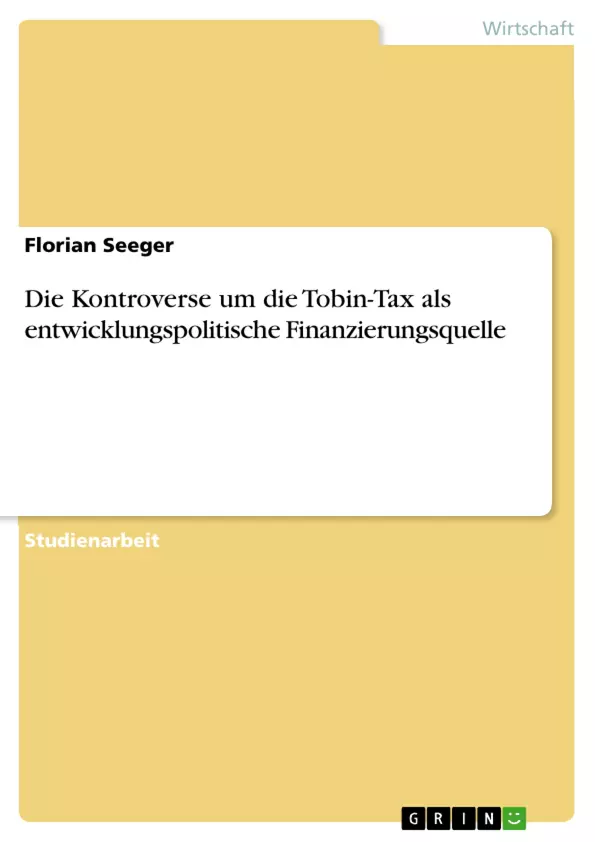Diese Seminararbeit befasst sich mit der Kontroverse um die so genannte Tobin-Steuer als entwicklungspolitische Finanzierungsquelle.
Zunächst wird hierbei Tobins Konzept kurz vorgestellt. Danach wird dargestellt, warum es Mitte der neunziger Jahre zu einer Renaissance dieses in den späten siebziger Jahren entwickelten Ansatzes gekommen ist. Schließlich wird zu beantworten versucht, ob die Tobin-Steuer die von ihren Befürwortern zugeschriebenen Erwartungen erfüllen kann, in dem sie hinsichtlich der Kriterien Finanzierungsfunktion, Lenkungsfunktion, technischer Durchsetzbarkeit sowie politischer Realisierbarkeit überprüft wird. Hierbei bedient sich der Autor den gegenwärtigen wissenschaftlichen Abhandlungen zu dieser Thematik, um so eine eigene Einschätzung vornehmen zu können. Als Weiterentwicklung des ursprünglichen Modells von Tobin soll die zweistufige Devisentransaktionssteuer des Frankfurter Wirtschaftswissenschaftlers Paul Bernd Spahn vorgestellt und kurz auf ihre Sinnhaftigkeit hin überprüft werden.
Mangels empirischer Daten wird schließlich das chilenische Modell einer Kapitalverkehrskontrolle betrachtet, dass mit einigen Abstrichen als die einzige realisierte Variante einer Tobin-Steuer betrachtet werden kann.
Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass Tobins ursprüngliches Konzept bereits an dem Kriterium der politischen Realisierbarkeit scheitert und die Erfüllung der restlichen Kriterien zumindest in Frage gestellt werden kann. Schlussfolgerung dieser Seminararbeit ist, dass zur Mittelgewinnung für öffentliche Entwicklungsfinanzierung andere Quellen aufgetan werden sollten, da Devisentransaktionssteuern tendenziell ungeeignet sind, entsprechende Beträge zu generieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Konzept der Tobin-Steuer
- 2.1 Die Wiederentdeckung der Tobin-Steuer
- 3. Anforderungen innovativer Finanzierungsquellen
- 3.1 Finanzierungsfunktion
- 3.2 nachhaltige Lenkungsfunktion
- 3.3 Technische Durchsetzbarkeit
- 3.4 Politische Realisierbarkeit
- 4. Mögliche Alternativen
- 4.1 Zweistufige Devisentransaktionssteuer („Spahn-Steuer“)
- 4.2 Mindestreservepflicht
- 5. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Eignung der Tobin-Steuer als Finanzierungsquelle für Entwicklungshilfe. Die Arbeit analysiert das ursprüngliche Konzept, seine Wiederbelebung in den 1990er Jahren und die aktuelle Kontroverse um seine Umsetzung. Im Fokus steht die Bewertung der Tobin-Steuer anhand von Kriterien wie Finanzierungsfähigkeit, Lenkungswirkung, technischer Umsetzbarkeit und politischer Machbarkeit.
- Bewertung der Tobin-Steuer als Finanzierungsinstrument für Entwicklungshilfe
- Analyse der politischen und wirtschaftlichen Machbarkeit der Tobin-Steuer
- Untersuchung alternativer Finanzierungsmodelle für Entwicklungszusammenarbeit
- Diskussion der Vor- und Nachteile der Tobin-Steuer im Vergleich zu anderen Ansätzen
- Bewertung der Effektivität der Tobin-Steuer zur Stabilisierung der Wechselkurse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den wachsenden Finanzierungsbedarf der Entwicklungshilfe angesichts globaler Herausforderungen wie AIDS, Naturkatastrophen und bewaffneter Konflikte. Sie hebt die Diskrepanz zwischen benötigten Mitteln und verfügbaren Ressourcen hervor und stellt die Tobin-Steuer als einen viel diskutierten Lösungsansatz vor. Die Einleitung führt in die Thematik ein und umreißt den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Analyse der Tobin-Steuer und möglicher Alternativen konzentriert.
2. Das Konzept der Tobin-Steuer: Dieses Kapitel präsentiert das ursprüngliche Konzept der Tobin-Steuer von James Tobin, die als internationale Steuer auf Devisentransaktionen konzipiert wurde, um kurzfristige Spekulationen zu reduzieren und Wechselkursstabilität zu fördern. Es wird die Wiederentdeckung und die aktuelle Relevanz der Tobin-Steuer im Kontext der Entwicklungsfinanzierung erläutert. Der Abschnitt legt den Fokus auf die historische Entwicklung und die Begründung der aktuellen Debatte um die Tobin-Steuer als Finanzierungsquelle.
3. Anforderungen innovativer Finanzierungsquellen: Dieses Kapitel definiert und analysiert die Anforderungen an eine effektive Finanzierungsquelle für Entwicklungshilfe. Es werden die Kriterien Finanzierungsfunktion, Lenkungsfunktion, technische Durchsetzbarkeit und politische Realisierbarkeit detailliert untersucht und im Bezug zur Tobin-Steuer bewertet. Der Abschnitt liefert eine umfassende Bewertung der Tobin-Steuer anhand von vier entscheidenden Kriterien, um deren Eignung als Finanzierungsinstrument zu beurteilen.
4. Mögliche Alternativen: Dieses Kapitel stellt alternative Finanzierungsmodelle zur Tobin-Steuer vor, unter anderem die zweistufige Devisentransaktionssteuer nach Spahn und die Mindestreservepflicht nach chilenischem Vorbild. Es werden die Stärken und Schwächen dieser Alternativen im Vergleich zur Tobin-Steuer diskutiert. Der Abschnitt bewertet mögliche alternative Ansätze zur Finanzierung von Entwicklungshilfe und vergleicht diese mit der Tobin-Steuer.
Schlüsselwörter
Tobin-Steuer, Entwicklungshilfe, Finanzierungsquellen, Devisentransaktionen, Wechselkursstabilität, politische Realisierbarkeit, Spahn-Steuer, Mindestreservepflicht, Entwicklungsfinanzierung, internationale Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Die Tobin-Steuer als Finanzierungsquelle für Entwicklungshilfe
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Eignung der Tobin-Steuer als Finanzierungsquelle für Entwicklungshilfe. Sie analysiert das Konzept der Tobin-Steuer, ihre Wiederbelebung und die aktuelle Debatte um ihre Umsetzung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bewertung der Steuer anhand von Kriterien wie Finanzierungsfähigkeit, Lenkungswirkung, technischer Umsetzbarkeit und politischer Machbarkeit. Zusätzlich werden alternative Finanzierungsmodelle betrachtet.
Welche Aspekte der Tobin-Steuer werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet das ursprüngliche Konzept der Tobin-Steuer, ihre Wiederentdeckung in den 1990er Jahren und die aktuelle Kontroverse um ihre Einführung. Es werden die historischen Entwicklungen und die Begründung der aktuellen Debatte ausführlich dargestellt. Die Analyse umfasst die Bewertung der Tobin-Steuer als Finanzierungsinstrument für Entwicklungshilfe sowie die Untersuchung ihrer politischen und wirtschaftlichen Machbarkeit.
Welche Kriterien werden zur Bewertung der Tobin-Steuer verwendet?
Die Eignung der Tobin-Steuer wird anhand folgender Kriterien bewertet: Finanzierungsfunktion (wie viel Geld kann generiert werden?), Lenkungsfunktion (welche Auswirkungen hat sie auf das Finanzsystem?), technische Durchsetzbarkeit (ist eine Umsetzung überhaupt möglich?) und politische Realisierbarkeit (welche politischen Hürden gibt es?).
Welche alternativen Finanzierungsmodelle werden diskutiert?
Die Seminararbeit stellt alternative Finanzierungsmodelle vor, darunter die zweistufige Devisentransaktionssteuer (auch „Spahn-Steuer“ genannt) und die Mindestreservepflicht. Die Stärken und Schwächen dieser Alternativen werden im Vergleich zur Tobin-Steuer diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Das Konzept der Tobin-Steuer, Anforderungen innovativer Finanzierungsquellen, Mögliche Alternativen und Zusammenfassung und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Tobin-Steuer und ihrer Alternativen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Tobin-Steuer, Entwicklungshilfe, Finanzierungsquellen, Devisentransaktionen, Wechselkursstabilität, politische Realisierbarkeit, Spahn-Steuer, Mindestreservepflicht, Entwicklungsfinanzierung, internationale Zusammenarbeit.
Was ist das Fazit der Seminararbeit? (ohne detaillierte Ergebnisse zu verraten)
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bietet eine abschließende Bewertung der Eignung der Tobin-Steuer als Finanzierungsquelle für Entwicklungshilfe im Vergleich zu den vorgestellten Alternativen. Es wird ein Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen gegeben.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Die Seminararbeit richtet sich an alle, die sich für die Finanzierung von Entwicklungshilfe, internationale Finanzpolitik und alternative Finanzierungsmodelle interessieren. Sie ist besonders relevant für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften und Entwicklungszusammenarbeit.
- Quote paper
- Florian Seeger (Author), 2007, Die Kontroverse um die Tobin-Tax als entwicklungspolitische Finanzierungsquelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115398