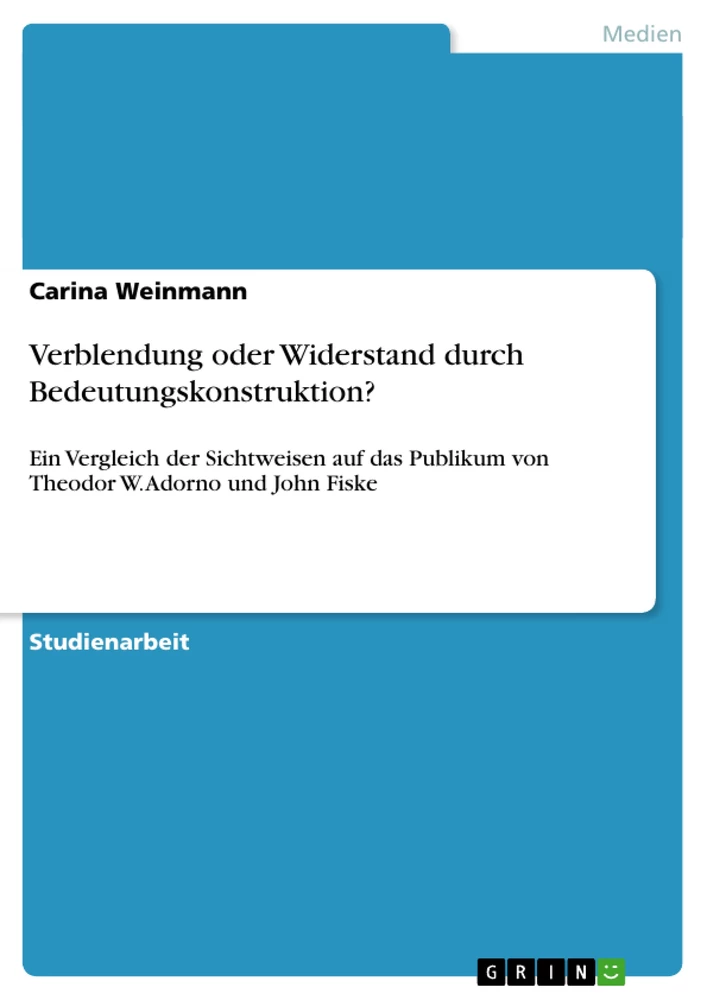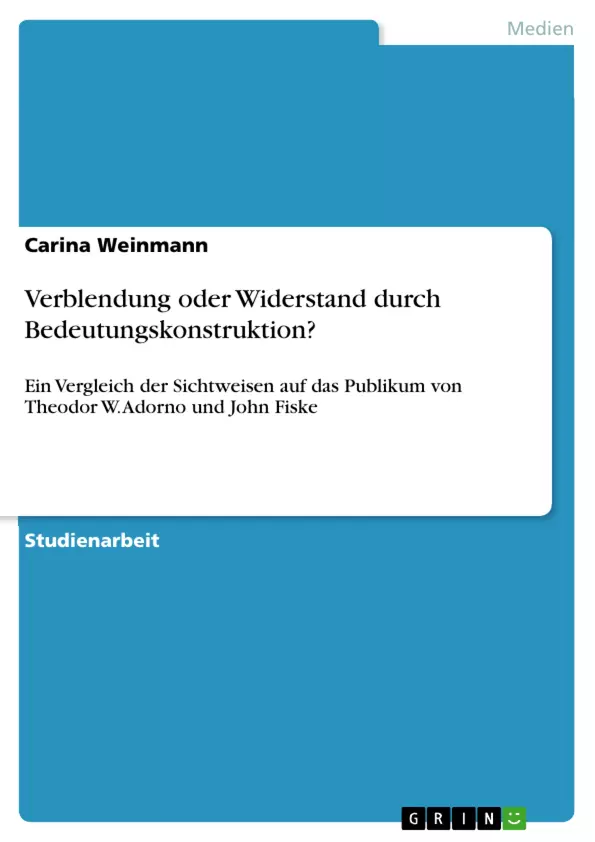Ziel der vorliegenden Arbeit sowie dieses Vergleichs ist zum einen, die Denkprozesse, Schlussfolgerungen und Erklärungen der beiden für ihre Sichtweise des Publikums nachzuvollziehen und ihre Überlegungen hinsichtlich der Möglichkeiten, die zur Bekämpfung des Kapitalismus dienen können, aufzuzeigen.
Dazu werde ich zunächst Adornos Sichtweise der Massenmedien im Gesamten und ihrer Auswirkung auf das Publikum nachzeichnen. Diese Sichtweise soll dann in einem anschließenden Abschnitt zu seinem Blick auf das Fernsehen als damals neues Medium pointiert werden. Aus dieser Darstellung seiner – wie sich zeigen wird – extrem negativen Einstellung gegenüber den Massenmedien und ihren Folgen für das Publikum wird eindeutig hervorgehen, weshalb der einzelne Rezipient innerhalb seiner Theorie wenig ausrichten kann. Adornos alternative Ansätze zur Verbesserung der Lage möchte ich in diesem Rahmen allerdings nicht auslassen, da ihre Form seinen Eindruck des unmündigen Publikums noch einmal verdeutlichen.
Zur Nachzeichnung der Position John Fiskes werde ich zunächst seine Sichtweise der Gesellschaft und Identität der Menschen herausarbeiten, um zeigen zu können, wie sich aus seiner Sicht das Publikum konstituiert. Dem anschließen wird sich die Ausführung des Verhältnisses dieses Publikums zu den Medien, bevor ich abschließend darstellen werde, worin für Fiske – ausgehend vom einzelnen Individuum und Rezipienten – eine Bekämpfung des Kapitalismus möglich ist.
In einem abschließenden Fazit möchte ich dann noch einmal reflektieren, welchen Grund es dafür geben kann, dass Adorno und Fiske zu solch unterschiedlichen Einschätzungen hinsichtlich des Publikums gelangen. Wie kann es sein, dass beide im Grunde dasselbe politische Ziel verfolgen, ihr Feindbild teilen, jedoch der eine zu dem Schluss kommt, dass das Publikum machtlos ist, während der andere ihm ein großes Maß an Macht zuspricht? Liegt dies einzig und allein an der unterschiedlichen Blickrichtung oder liegen eventuell andere Faktoren vor, die die Einstellung von Adorno und Fiske beeinflusst haben? Und schließlich: können diese Faktoren einen Hinweis darauf geben, welcher der beiden Recht hat?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Einordnung: Die Theorien und ihr Zusammenhang mit den Medien
- Die Kritische Theorie und Theodor W. Adorno
- Die Cultural Studies und John Fiske
- Theodor W. Adorno: Verblendung des Publikums durch die „Kulturindustrie“
- Die „Kulturindustrie“ und ihre Folgen für das Publikum
- Das Fernsehen als Spitze der „Kulturindustrie“
- Adornos Vorschläge zur Rettung des Publikums
- John Fiske: Widerstand des Publikums durch Bedeutungskonstruktion
- Die Gesellschaft als Bündel sozialer Formationen
- Zum Verhältnis Text – Publikum
- Bedeutungskonstruktion: Macht, Widerstand und Vergnügen
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Sichtweise des Publikums in der Kritischen Theorie und den Cultural Studies. Sie analysiert die unterschiedlichen Perspektiven von Theodor W. Adorno und John Fiske, die beide das Schicksal der unterdrückten Arbeiterklasse am Herzen liegen haben und die „Ungleichheiten des Kapitalismus“ bekämpfen wollen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Denkprozesse, Schlussfolgerungen und Erklärungen der beiden Theoretiker hinsichtlich des Publikums nachzuvollziehen und ihre Überlegungen zur Bekämpfung des Kapitalismus aufzuzeigen.
- Die Rolle der Massenmedien in der kapitalistischen Gesellschaft
- Die Auswirkungen der „Kulturindustrie“ auf das Publikum
- Die Bedeutung der Bedeutungskonstruktion für das Publikum
- Die Möglichkeiten des Widerstands gegen die „Kulturindustrie“
- Die unterschiedlichen Perspektiven von Adorno und Fiske auf das Publikum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Publikumsdefinition in der Medien- und Kommunikationswissenschaft ein und stellt die gegensätzlichen Positionen der Kritischen Theorie und der Cultural Studies dar. Sie hebt die Interdisziplinarität und die politische Prägung beider Strömungen hervor und verdeutlicht die unterschiedlichen Blickrichtungen auf das Publikum: die Kritische Theorie betrachtet die Menschen als homogene Masse, während die Cultural Studies vom einzelnen Individuum ausgehen.
Im zweiten Kapitel werden die Kritische Theorie und die Cultural Studies im Kontext der Medien- und Kommunikationswissenschaft eingeordnet. Die Kritische Theorie wird als Forschungstradition vorgestellt, die von der Frankfurter Schule um Max Horkheimer begründet wurde und sich mit der Frage der Reproduktion der antagonistischen Gesellschaft auseinandersetzt. Adornos besondere Kompetenz im Bereich der Medienkritik wird hervorgehoben, und seine frühen Arbeiten zur Musik und zum Radio als Vorläufer seiner umfassenden Medientheorie dargestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich Adornos Sichtweise der Massenmedien und ihrer Auswirkungen auf das Publikum. Es wird die „Kulturindustrie“ als ein Instrument der Verblendung des Publikums beschrieben, das durch die Verbreitung von standardisierten und manipulativen Inhalten die kritische Denkfähigkeit der Menschen untergräbt. Das Fernsehen wird als Spitze der „Kulturindustrie“ dargestellt, und Adornos Vorschläge zur Rettung des Publikums werden beleuchtet.
Das vierte Kapitel behandelt John Fiskes Sichtweise des Publikums. Es wird seine Vorstellung von der Gesellschaft als einem Bündel sozialer Formationen erläutert, die die Identität der Menschen prägen. Das Verhältnis des Publikums zu den Medien wird aus der Perspektive der Bedeutungskonstruktion betrachtet, die den Rezipienten ein hohes Maß an Autonomie und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Medieninhalten zuspricht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Kritische Theorie, die Cultural Studies, Theodor W. Adorno, John Fiske, die Kulturindustrie, das Publikum, Bedeutungskonstruktion, Widerstand, Medienkommunikation, Massenmedien, Fernsehen, Kapitalismus, Gesellschaft, Identität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Adornos Sicht auf das Publikum?
Theodor W. Adorno sieht das Publikum als weitgehend manipulierbare Masse, die durch die „Kulturindustrie“ verblendet und entmündigt wird.
Wie unterscheidet sich John Fiskes Position davon?
Fiske (Cultural Studies) spricht dem Publikum Macht zu; Rezipienten konstruieren aktiv eigene Bedeutungen und leisten so Widerstand gegen den Kapitalismus.
Was versteht Adorno unter der „Kulturindustrie“?
Ein System der kommerziellen Unterhaltung, das standardisierte Güter produziert, um die kritische Denkfähigkeit der Menschen zu unterdrücken.
Was bedeutet „Bedeutungskonstruktion“ bei Fiske?
Es beschreibt den Prozess, bei dem Individuen Medieninhalte basierend auf ihrer eigenen sozialen Identität interpretieren und für sich nutzbar machen.
Warum bewerten beide Theoretiker das Fernsehen so unterschiedlich?
Adorno sieht im Fernsehen das Maximum an Manipulation; Fiske sieht darin einen Text, der vielfältige, auch subversive Lesarten ermöglicht.
- Citation du texte
- Carina Weinmann (Auteur), 2008, Verblendung oder Widerstand durch Bedeutungskonstruktion?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115404