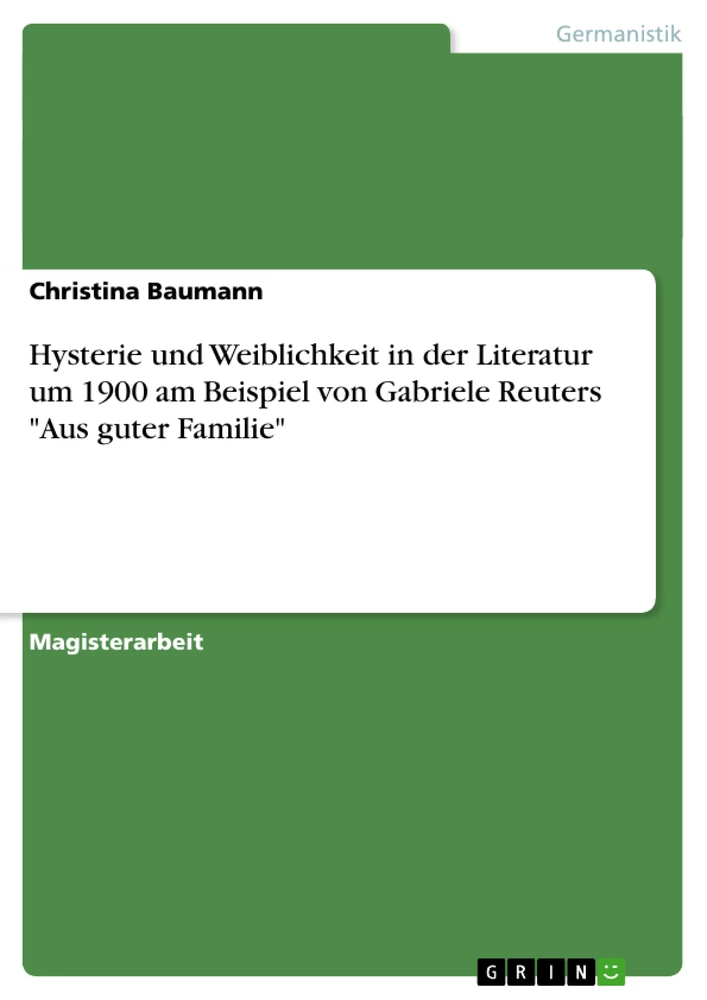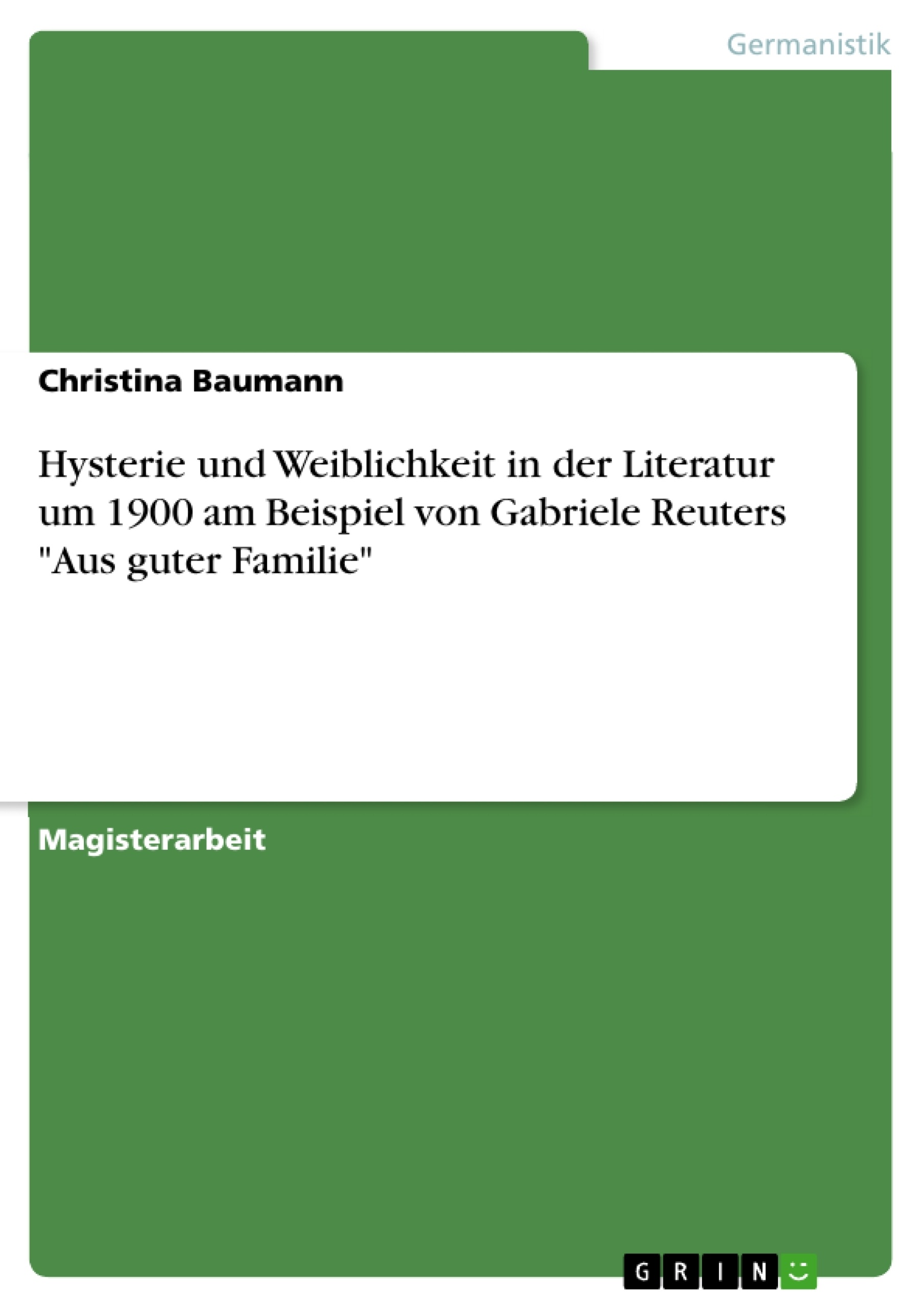Der erste Teil dieser Arbeit behandelt die Diskurse der Hysterie. Dabei soll zunächst ein knapper historischer Überblick über die medizinisch-psychiatrischen Theorien der Hysterie am Ende des 19. Jahrhunderts gegeben werden. Im Anschluss daran liegt der Fokus auf den um die Jahrhundertwende zirkulierenden Konzeptionen von Weiblichkeit und Krankheit respektive Hysterie.
Der zweite Teil dieser Arbeit behandelt den literarischen Kontext der Jahrhundertwende. Der Fokus liegt dabei vor allem auf den Lebensbedingungen der schreibenden Frauen dieser Zeit. In einem nächsten Schritt soll anhand der Texte weiblicher und männlicher Signatur skizziert werden, wie diese AutorInnen die herrschenden Deutungen um Weiblichkeit und weiblicher Psychopathologie behandeln und welche Unterschiede gegebenenfalls signifikant sind. Bei den analysierten Texten handelt es sich um Theodor Fontanes Roman „Cécile“ (1887), Hedwig Dohms Novelle „Werde, die du bist!“ (1894) und dem Roman „Halbtier“ (1897) von Helene Böhlau.
Die Analyse des Romans „Aus guter Familie“ von Gabriele Reuter bildet den Hauptteil der vorliegenden Arbeit. Der ‚Leidensweg’ der Protagonistin Agathe Heidling soll anhand der Faktoren nachgezeichnet werden, die die Zerstörung ihrer Identität und Individualität bedingen und die letztendlich zur Internierung in eine Nervenheilanstalt führen. Neben der im Vordergrund stehenden textimmanenten Interpretation sollen immer wieder die theoretischen Ausführungen Irigarays zu Weiblichkeit und weiblicher Subjektivität miteinbezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hysterie-Diskurse
- 2.1 Hysteriekonzepte im medizinisch-psychiatrischen Diskurs
- 2.2 Weiblichkeit um die Jahrhundertwende
- 2.3 Sigmund Freud
- 2.3.1 ,,Studien über Hysterie“ – Der Fall Anna O.
- 2.3.2 ,,Bruchstück einer Hysterie-Analyse“ – Der Fall Dora
- 2.4 Hysteriekonzepte im feministischen Poststrukturalismus
- 2.4.1 Luce Irigaray
- 3. Literatur um 1900
- 3.1 Andere Hysterikerinnen
- 4. „Aus guter Familie. Leidensgeschichte eines Mädchens“
- 4.1 Erziehung zur Weiblichkeit
- 4.2 Doppelmoral der Gesellschaft
- 4.3 Sexualität – gesellschaftliche Norm und individuelles Begehren
- 4.4 Agathes Wahnsinn
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Gabriele Reuter in ihrem Roman „Aus guter Familie“ die herrschenden Hysterie-Diskurse und Weiblichkeitsideologien des späten 19. Jahrhunderts darstellt. Ziel ist es, Reiters Umgang mit kulturell geprägten Vorstellungen von Weiblichkeit und hysterischer Weiblichkeit zu analysieren und zu ergründen, ob der Roman einen affirmativen oder subversiven Umgang mit traditionellen Konzeptionen von Weiblichkeit zeigt.
- Historische Konzepte von Hysterie und ihre medizinisch-psychiatrische Einordnung
- Vorstellungen von Weiblichkeit um 1900 und deren gesellschaftliche Konstruktion
- Freud'sche Konzepte der Hysterie und deren Relevanz für die Interpretation des Romans
- Feministische Perspektiven auf Hysterie und Weiblichkeit
- Analyse der Darstellung von Weiblichkeit und der Kritik an gesellschaftlichen Normen in Gabriele Reiters Roman „Aus guter Familie“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die geschichtswissenschaftliche Entwicklung des Geschlechterverständnisses, beginnend mit dem "Ein-Geschlecht-Modell" bis hin zum "Zwei-Geschlecht-Modell". Sie führt den Wandel vom Verständnis der Frau als unvollkommener Mann hin zur Konstruktion von zwei unterschiedlichen biologischen und psychischen Geschlechtscharakteren aus. Dieser Wandel wird mit der Entstehung der modernen Medizin und der zunehmenden Pathologisierung weiblicher Differenz verbunden. Die Einführung des Konzepts der Hysterie als "kulturelles Deutungsmuster" für weibliche "Anormalität" und die spätere kritische Auseinandersetzung mit der Konstruktion von Weiblichkeit als kulturelles Konstrukt bilden den thematischen Rahmen für die folgende Analyse von Gabriele Reiters Roman.
2. Hysterie-Diskurse: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Diskurse der Hysterie im 19. Jahrhundert. Es werden die medizinisch-psychiatrischen Konzepte der Hysterie, die Vorstellungen von Weiblichkeit um die Jahrhundertwende und die Relevanz der Arbeiten von Sigmund Freud (insbesondere die Fälle Anna O. und Dora) behandelt. Zusätzlich wird die Perspektive des feministischen Poststrukturalismus, speziell die Ansätze von Luce Irigaray, in die Analyse einbezogen, um verschiedene Perspektiven auf die Konstruktion und Interpretation von Hysterie und Weiblichkeit zu beleuchten. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der kulturellen und gesellschaftlichen Kontexte, in denen Reiters Roman entstanden ist.
3. Literatur um 1900: Dieses Kapitel (wenngleich in Auszügen) untersucht den Kontext der Literatur um 1900 und beleuchtet die Darstellung von Frauen und Hysterie in der Literatur der Zeit. Es schafft eine breitere Perspektive auf die spezifischen Themen und Herausforderungen, die Gabriele Reuter in ihrem Werk "Aus guter Familie" aufgreift. Es geht um die Frauenrolle in dieser Zeit und wie das literarische Umfeld Reiters Werk beeinflusst hat und umgekehrt.
4. „Aus guter Familie. Leidensgeschichte eines Mädchens“: Die ausführliche Analyse von Gabriele Reiters Roman steht im Mittelpunkt dieses Kapitels. Es werden die Erziehung Agathes zur Weiblichkeit, die Doppelmoral der Gesellschaft, Agathes unterdrücktes sexuelles Begehren und schließlich ihr "Wahnsinn" im Kontext der vorangegangenen Kapitel analysiert. Die Analyse deckt auf, wie Reiters Roman die konstruierten Normen und Erwartungen an Frauen hinterfragt und die Folgen der Unterdrückung weiblicher Bedürfnisse und Wünsche aufzeigt. Hier wird die zentrale These der Arbeit verifiziert oder falsifiziert, inwiefern der Roman einen affirmativen oder subversiven Umgang mit traditionellen Konzeptionen von Weiblichkeit zeigt.
Schlüsselwörter
Hysterie, Weiblichkeit, Gabriele Reuter, „Aus guter Familie“, Wilhelminische Gesellschaft, Geschlechterkonstruktionen, feministischer Poststrukturalismus, medizinischer Diskurs, Sexualität, Doppelmoral, gesellschaftliche Normen, Individuum.
Häufig gestellte Fragen zu "Aus guter Familie. Leidensgeschichte eines Mädchens"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Gabriele Reiters Roman "Aus guter Familie. Leidensgeschichte eines Mädchens" im Kontext der herrschenden Hysterie-Diskurse und Weiblichkeitsideologien des späten 19. Jahrhunderts. Es wird untersucht, wie Reuter mit kulturell geprägten Vorstellungen von Weiblichkeit und hysterischer Weiblichkeit umgeht und ob der Roman einen affirmativen oder subversiven Umgang mit traditionellen Konzeptionen von Weiblichkeit zeigt.
Welche Themen werden im Roman behandelt?
Der Roman thematisiert die Erziehung Agathes zur Weiblichkeit, die Doppelmoral der Gesellschaft, Agathes unterdrücktes sexuelles Begehren und ihren "Wahnsinn". Zentrale Aspekte sind die konstruierten Normen und Erwartungen an Frauen sowie die Folgen der Unterdrückung weiblicher Bedürfnisse und Wünsche.
Welche historischen Konzepte von Hysterie werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet medizinisch-psychiatrische Konzepte der Hysterie im 19. Jahrhundert, Vorstellungen von Weiblichkeit um 1900 und die Relevanz der Arbeiten von Sigmund Freud (Fälle Anna O. und Dora). Zusätzlich werden feministische Perspektiven, insbesondere die von Luce Irigaray, einbezogen.
Wie wird der Roman im Kontext der Literatur um 1900 eingeordnet?
Das Kapitel zur Literatur um 1900 untersucht die Darstellung von Frauen und Hysterie in der Literatur dieser Zeit. Es schafft einen Kontext, um die spezifischen Themen und Herausforderungen zu verstehen, die Gabriele Reuter in ihrem Werk aufgreift und wie das literarische Umfeld Reiters Werk beeinflusst hat und umgekehrt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert Reiters Umgang mit kulturell geprägten Vorstellungen von Weiblichkeit und hysterischer Weiblichkeit. Das Ziel ist es zu ergründen, ob der Roman einen affirmativen oder subversiven Umgang mit traditionellen Konzeptionen von Weiblichkeit zeigt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hysterie, Weiblichkeit, Gabriele Reuter, „Aus guter Familie“, Wilhelminische Gesellschaft, Geschlechterkonstruktionen, feministischer Poststrukturalismus, medizinischer Diskurs, Sexualität, Doppelmoral, gesellschaftliche Normen, Individuum.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Hysterie-Diskursen (inkl. Freud und feministischem Poststrukturalismus), ein Kapitel zur Literatur um 1900, eine detaillierte Analyse von "Aus guter Familie" und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse zusammen.
Wie wird der Wandel im Geschlechterverständnis dargestellt?
Die Einleitung beleuchtet die geschichtswissenschaftliche Entwicklung des Geschlechterverständnisses, vom "Ein-Geschlecht-Modell" zum "Zwei-Geschlecht-Modell" und die damit verbundene Pathologisierung weiblicher Differenz. Die Entstehung des Hysterie-Konzepts als Deutungsmuster weiblicher "Anormalität" wird ebenfalls thematisiert.
- Citation du texte
- Christina Baumann (Auteur), 2008, Hysterie und Weiblichkeit in der Literatur um 1900 am Beispiel von Gabriele Reuters "Aus guter Familie", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115429