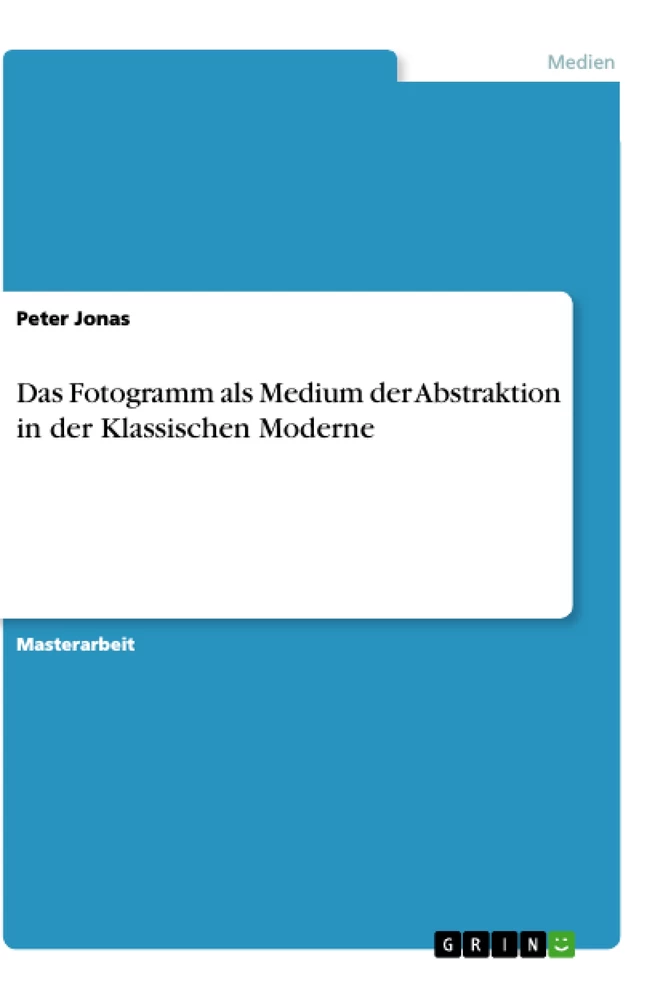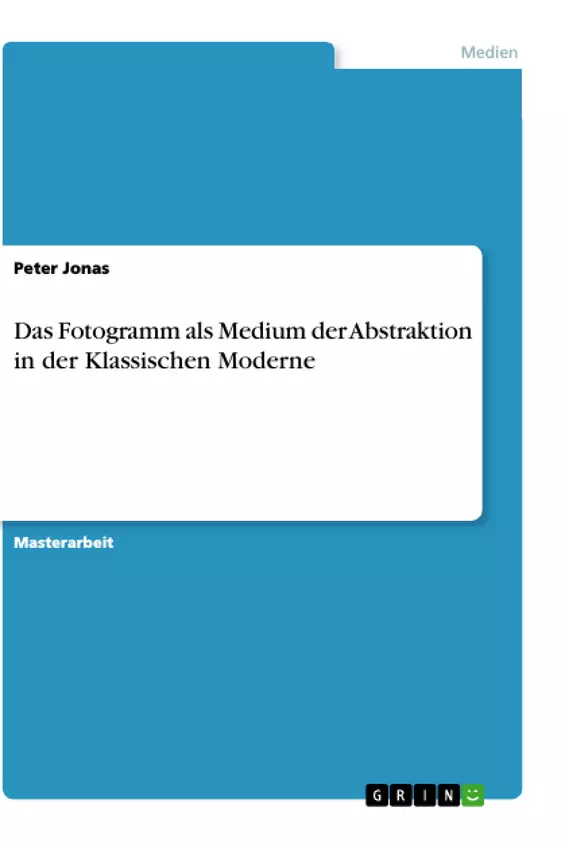Die Arbeit behandelt das Fotogramm als Medium der Abstraktion in der klassischen Moderne. Der Autor unterteilt die Geschichte des Fotogramms in drei Phasen, die durch zwei lange Pausen unterbrochen werden. Im 19. Jhd. diente die Technik zur wissenschaftlichen Dokumentation. Die zweite Phase, die von Christian Schad, Man Ray und Moholy-Nagy eingeleitet wurde, beginnt gleichzeitig mit dem Aufschwung abstrakter Bildstrategien. Die Hypothese, das Fotogramm sei für Abstraktionen besonders geeignet, wird geprüft.
Seine Anwendung in der sogenannten Klassischen Moderne, dem Zeitraum vom Untergang der Belle Époque bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, wird anhand einer Analyse programmatischer Ansprüche und praktischer Bildbeispiele aus Dadaismus, Surrealismus und Neuem Sehen beschrieben. Dabei stand nicht eine Intensivierung des Ausdrucks durch Reduktion im Mittelpunkt, dies wurde erst beim zweiten Comeback des Fotogramms in der Postmoderne ein Beweggrund. Es ging vielmehr um die Suche nach Wegen einer Bilderzeugung ohne den Einfluss des Menschen, um zu einer unmittelbaren Weltwahrnehmung und Welterkenntnis zu gelangen. In Anlehnung an die Écriture automatique wird der Zufall als Gestaltungsmittel gegen den inneren Zensor eingesetzt.
Die Eigenschaften der Materie und ihre visuellen Relationen sollen unverfälscht quasi von selbst sprechen. Weil damit auch ein Sichtbarwerden des Optisch-Unbewussten verbunden ist, kommt der Bewegung des Neuen Sehens auch eine aufklärerische und pädagogische Bedeutung zu. Das fotogrammatische Bild wird eingebettet in eine materialistische Ideologie als neue Acheiropoieta, als nicht von Menschenhand geschaffen, gesehen; eine Objektmetaphysik, der bereits bei Talbot auftaucht. Mit dem Tod von Moholy-Nagy 1946 beginnt die zweite Latenzzeit des Fotogramms, die erst in den 1980er endet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1. Forschungsfrage
- 1.2. Forschungsstand
- 1.3. Mediale Klärung
- 2. Wege zum Fotogramm
- 2.1. Kontaktkopie
- 2.2. cliché verre
- 2.3. Luminogramm
- 2.4. Röntgenbilder
- 2.5. Manipulationen direkt am Bildträger
- 2.6. Chemigramm
- 2.7. Digitales Fotogramm
- 2.8. Zusammenfassung der Fertigungsvarianten
- 2.9. Historische Wurzeln und Anwendung
- 3. Wege zur Abstraktion
- 3.1. Romantik
- 3.2. Japonismus
- 3.3. Der fotografische Diskurs im 19. Jahrhundert
- 3.4. Futurismus
- 3.5. Alvin Langdon Coburn
- 4. Fotogrammatische Positionen
- 4.1. Das Fotogramm im Dadaismus
- 4.1.1. Die Dada-Haltung
- 4.1.2. Schöpferische Prinzipien
- 4.1.3. Christian Schad (1894 – 1982)
- 4.1.4. Kurt Schwitters (1887 – 1948)
- 4.1.4. Zusammenschau
- 4.2. Das Fotogramm im Surrealismus
- 4.2.1. Das surrealistische Prinzip
- 4.2.2. Man Ray
- 4.2.3. Das Fotogramm bei anderen Surrealisten
- 4.3. Die Abstraktion im Dadaismus und Surrealismus
- 4.4. László Moholy-Nagy
- 5. Abschluss
- 5.1. Resümee
- 5.2. Ausblick
- 6. Quellenverzeichnis
- 6.1. Bildnachweis
- 6.2. Literatur
- 6.2.1. Publikationen
- 6.2.2. Quellen im Internet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Masterarbeit von Dr. Peter Jonas widmet sich dem Fotogramm als Medium der Abstraktion in der Klassischen Moderne. Die Arbeit beleuchtet die Geschichte des Fotogramms und seine verschiedenen Anwendungsformen im 19. Jahrhundert, um anschließend dessen Rolle in der Avantgarde des 20. Jahrhunderts, insbesondere im Dadaismus und Surrealismus, zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der Beziehung zwischen dem Fotogramm und der Abstraktion, insbesondere im Kontext der Strömungen der Klassischen Moderne.
- Die Entwicklung des Fotogramms als technische Methode
- Die ästhetischen und konzeptuellen Aspekte der Abstraktion in der Kunst
- Die Rezeption des Fotogramms als Medium der Abstraktion in der Klassischen Moderne
- Die Rolle des Zufalls und des Automatismus in der fotogrammatischen Praxis
- Die Bedeutung der Materialität und der "Sprache der Materie" im Fotogramm
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Forschungsfrage ein, die sich auf das Verhältnis von Fotogramm und Abstraktion in der Klassischen Moderne fokussiert. Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Wege zum Fotogramm, von frühen Drucktechniken und Lichtpausen bis hin zu Röntgenbildern und digitalen Verfahren, ausführlich beschrieben und in ihrem historischen Kontext eingeordnet. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der Abstraktion in der Kunst, beginnend mit der Romantik und dem Einfluss ostasiatischer Kunst, dem Japonismus, und dem fotografischen Diskurs im 19. Jahrhundert. Das vierte Kapitel widmet sich den fotogrammatischen Positionen im Dadaismus und Surrealismus. Es werden wichtige Künstler wie Christian Schad, Kurt Schwitters, Man Ray und László Moholy-Nagy vorgestellt und deren Beiträge zum Fotogramm als Medium der Abstraktion beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Fotogramm, Abstraktion, Klassische Moderne, Dadaismus, Surrealismus, Man Ray, László Moholy-Nagy, Christian Schad, Kurt Schwitters, Zufall, Automatismus, Materialität, Sprache der Materie, Neue Sehen, Licht, Schatten, Objektivität, Produktion, Reproduktion, Avantgarde, Ästhetik
- Quote paper
- Peter Jonas (Author), 2021, Das Fotogramm als Medium der Abstraktion in der Klassischen Moderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154331